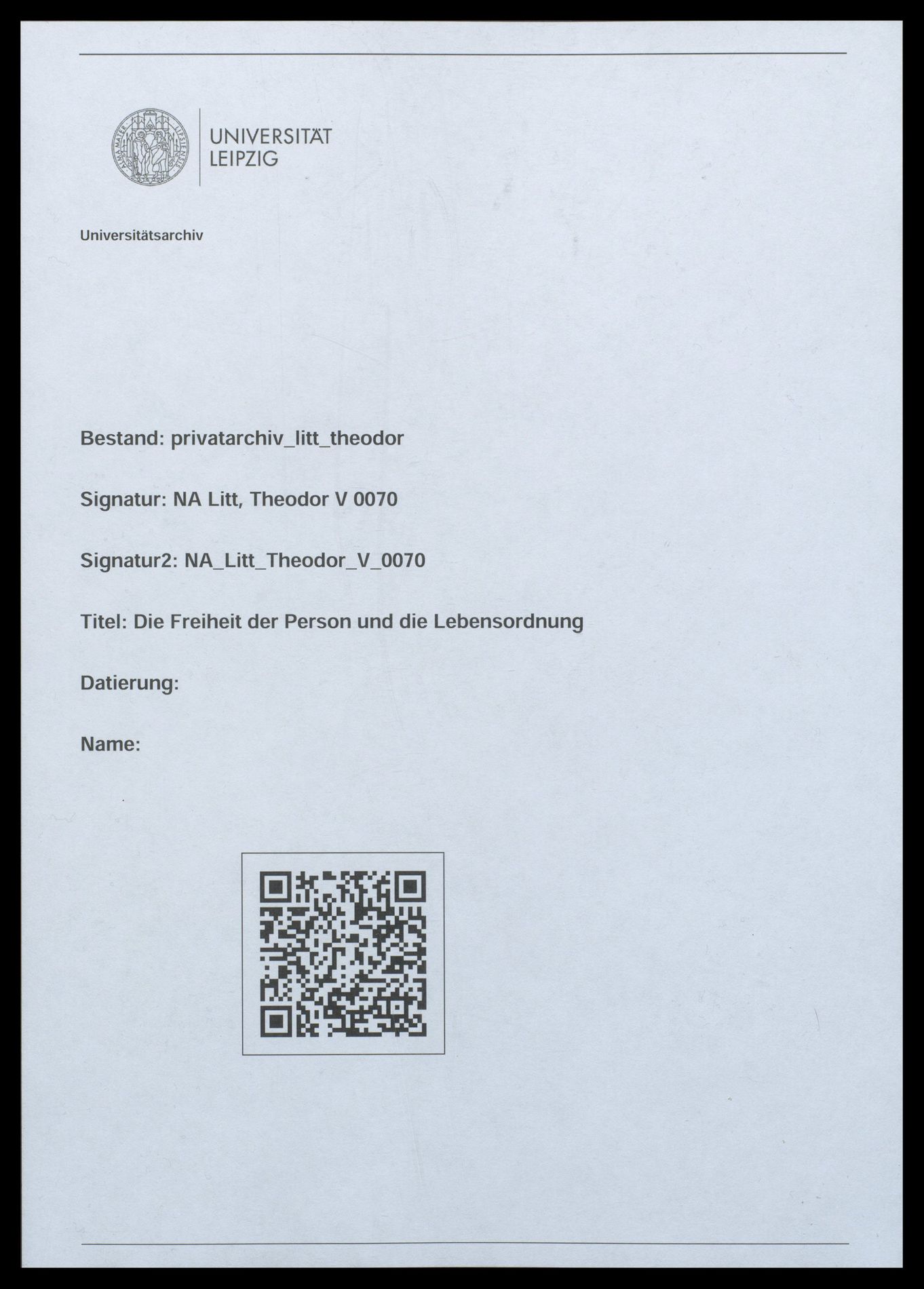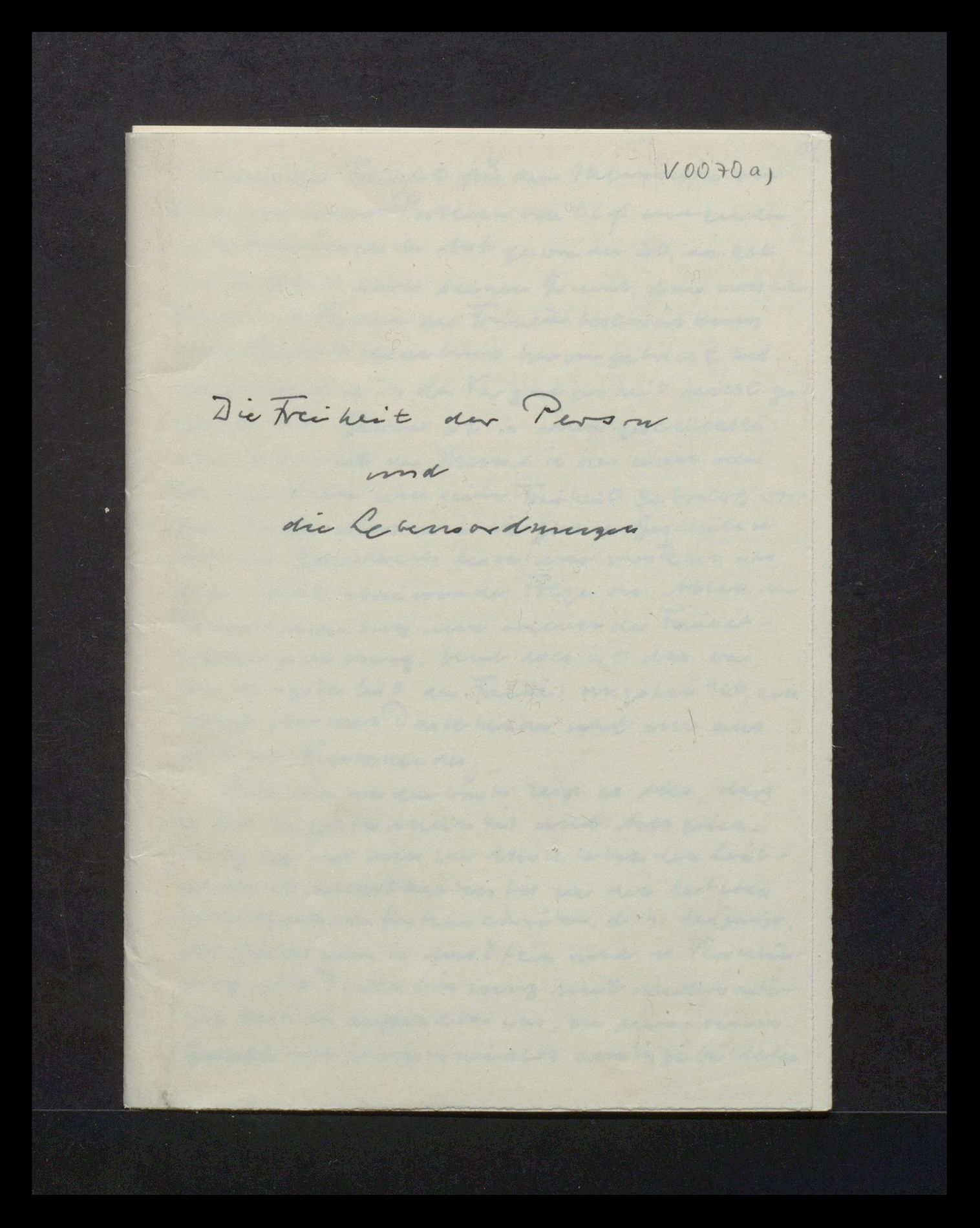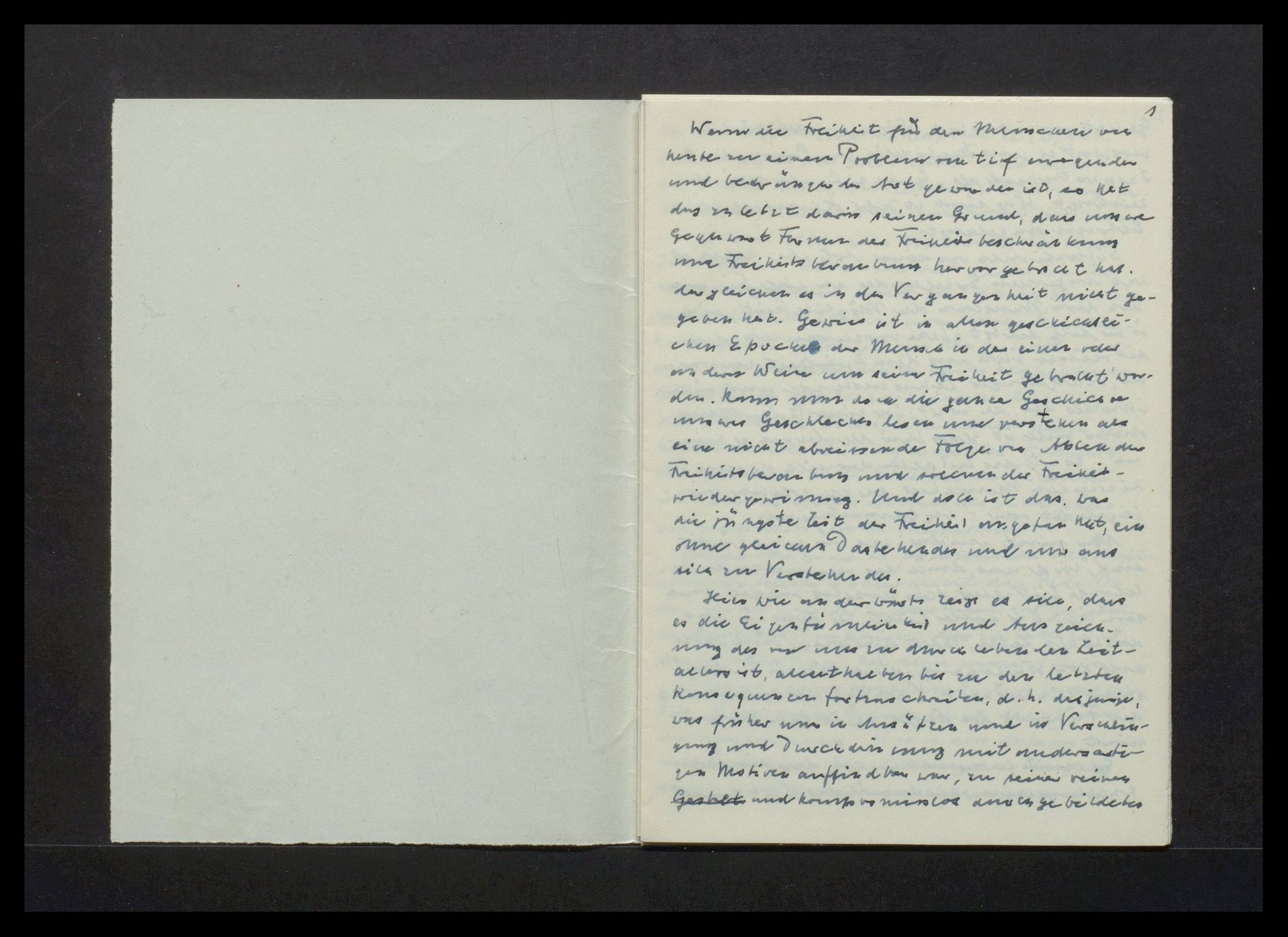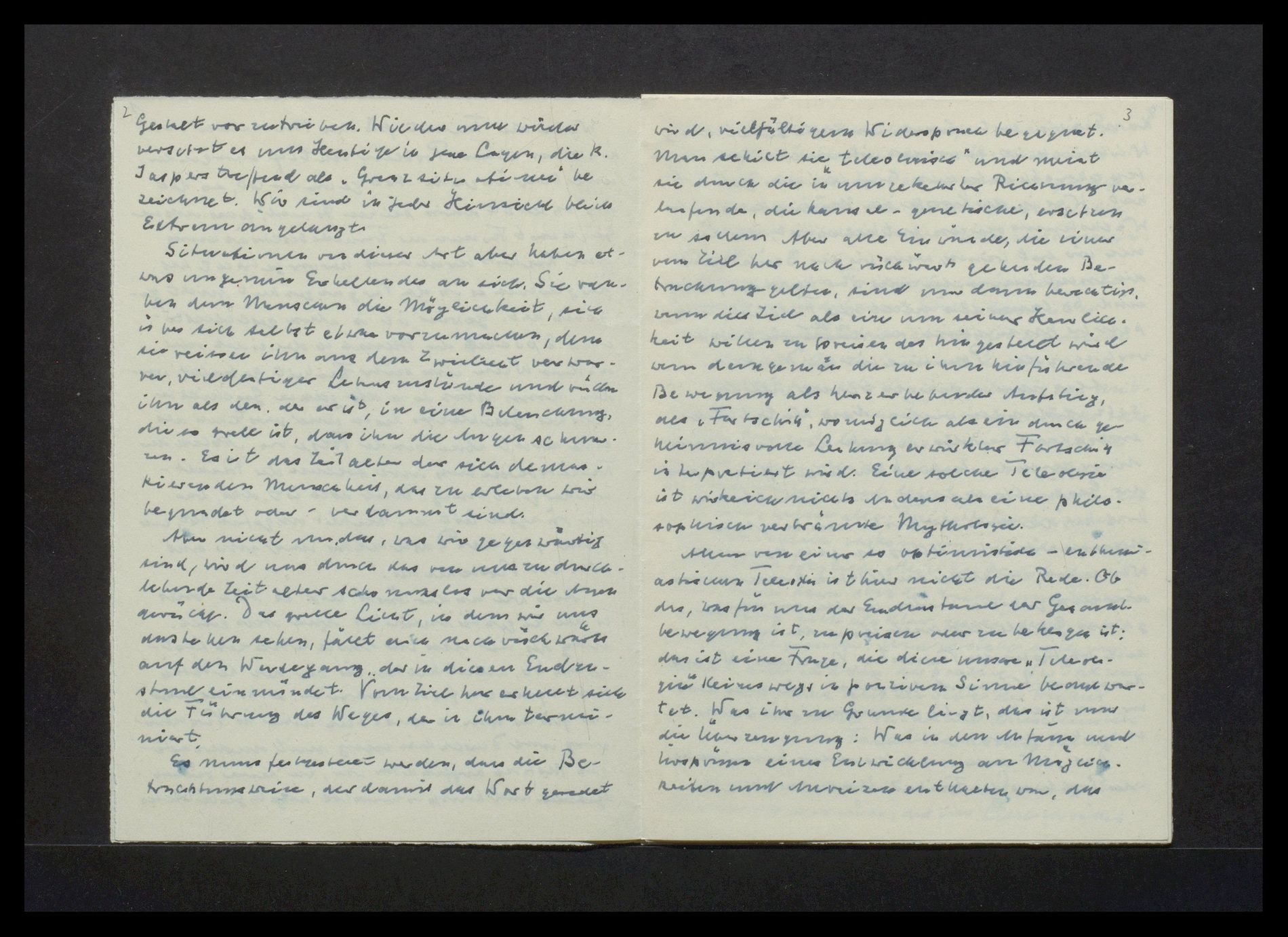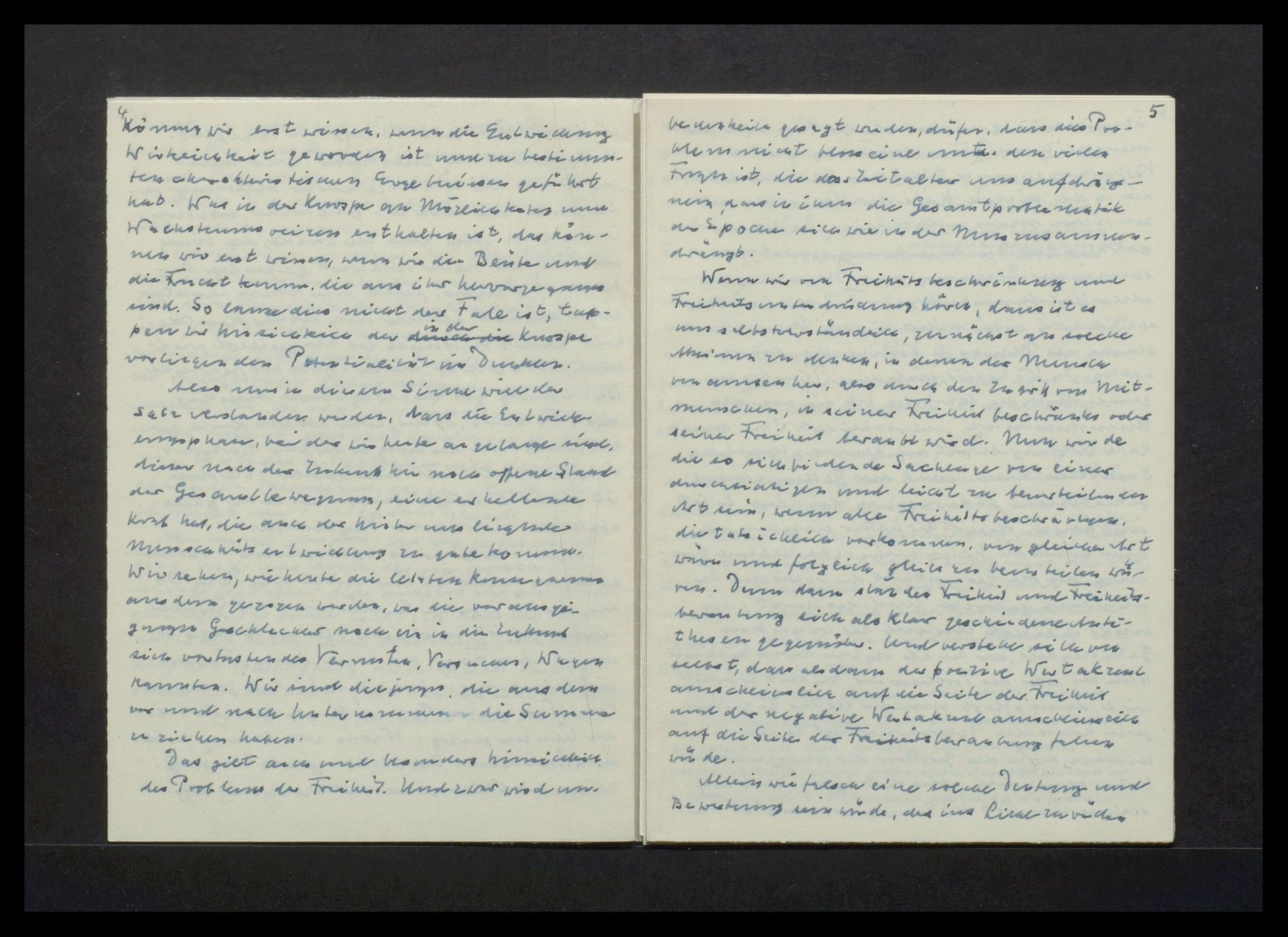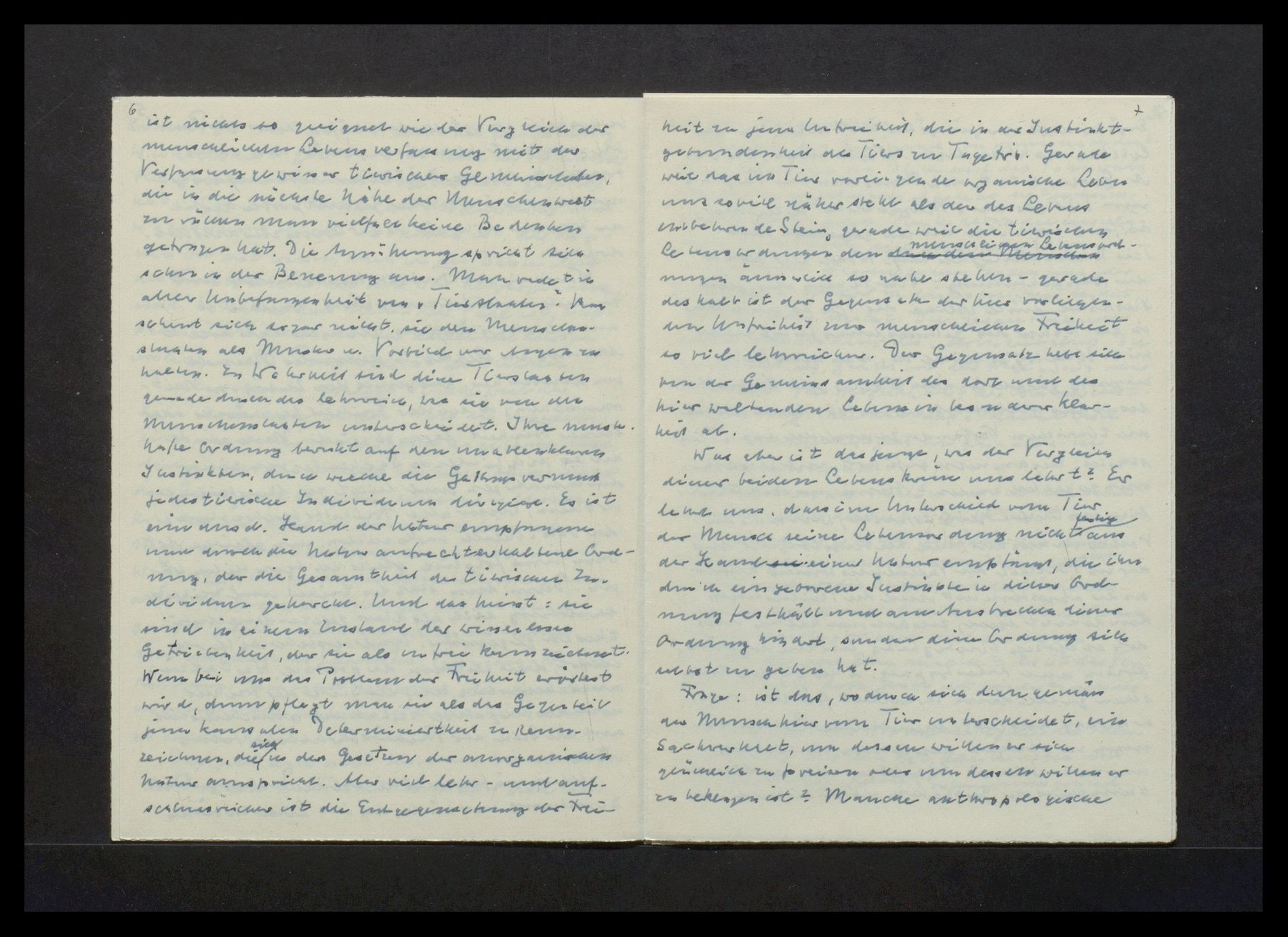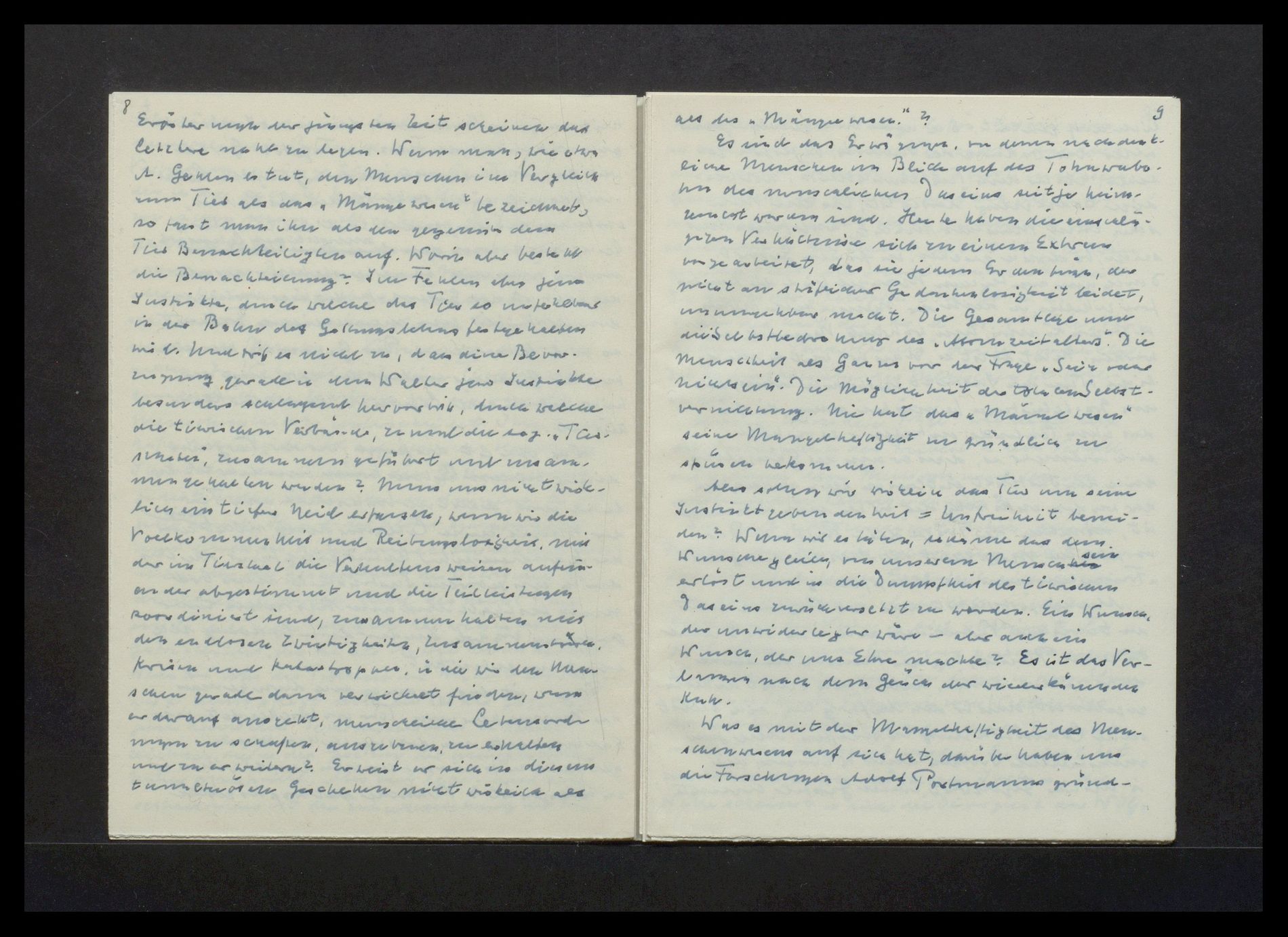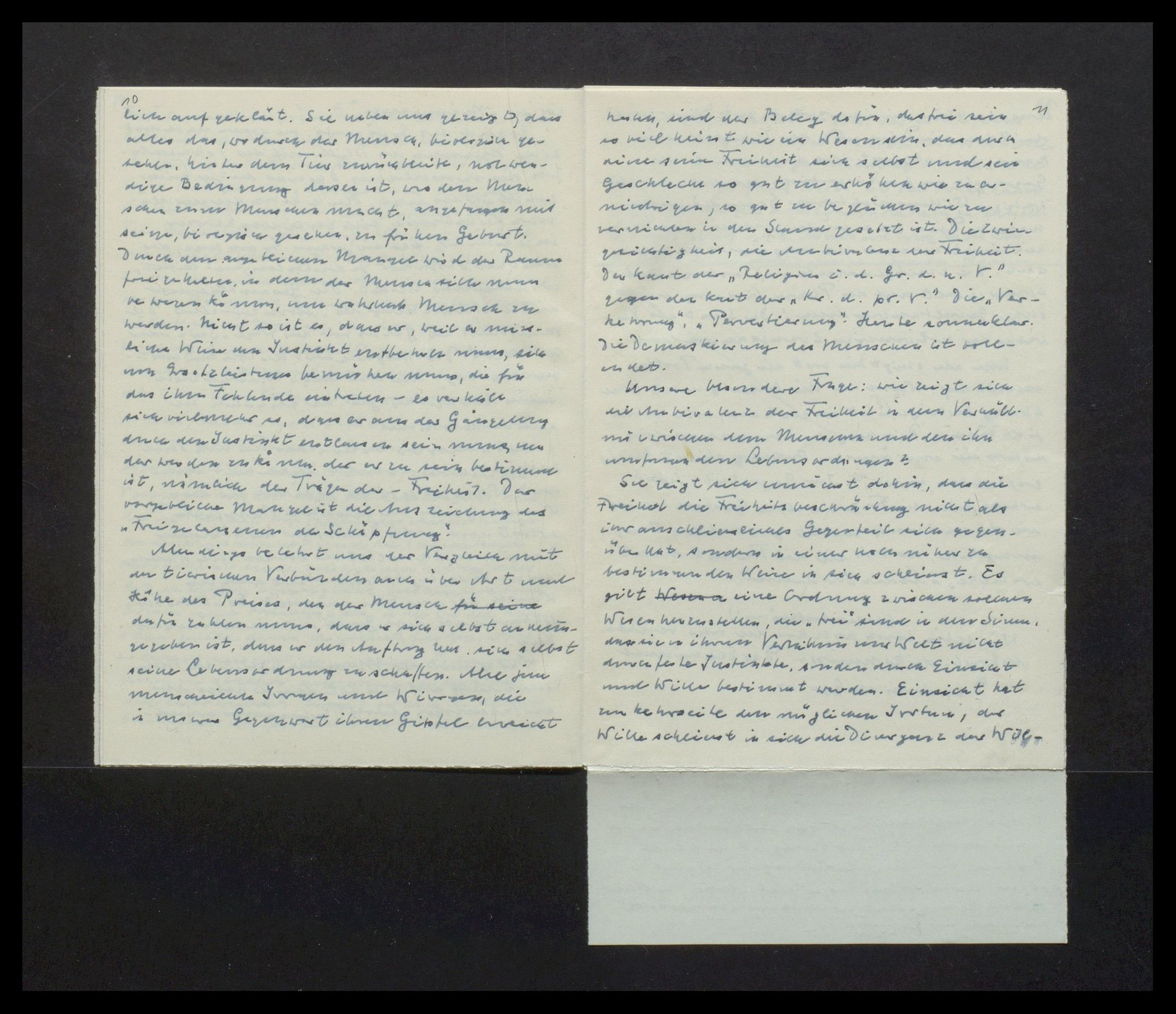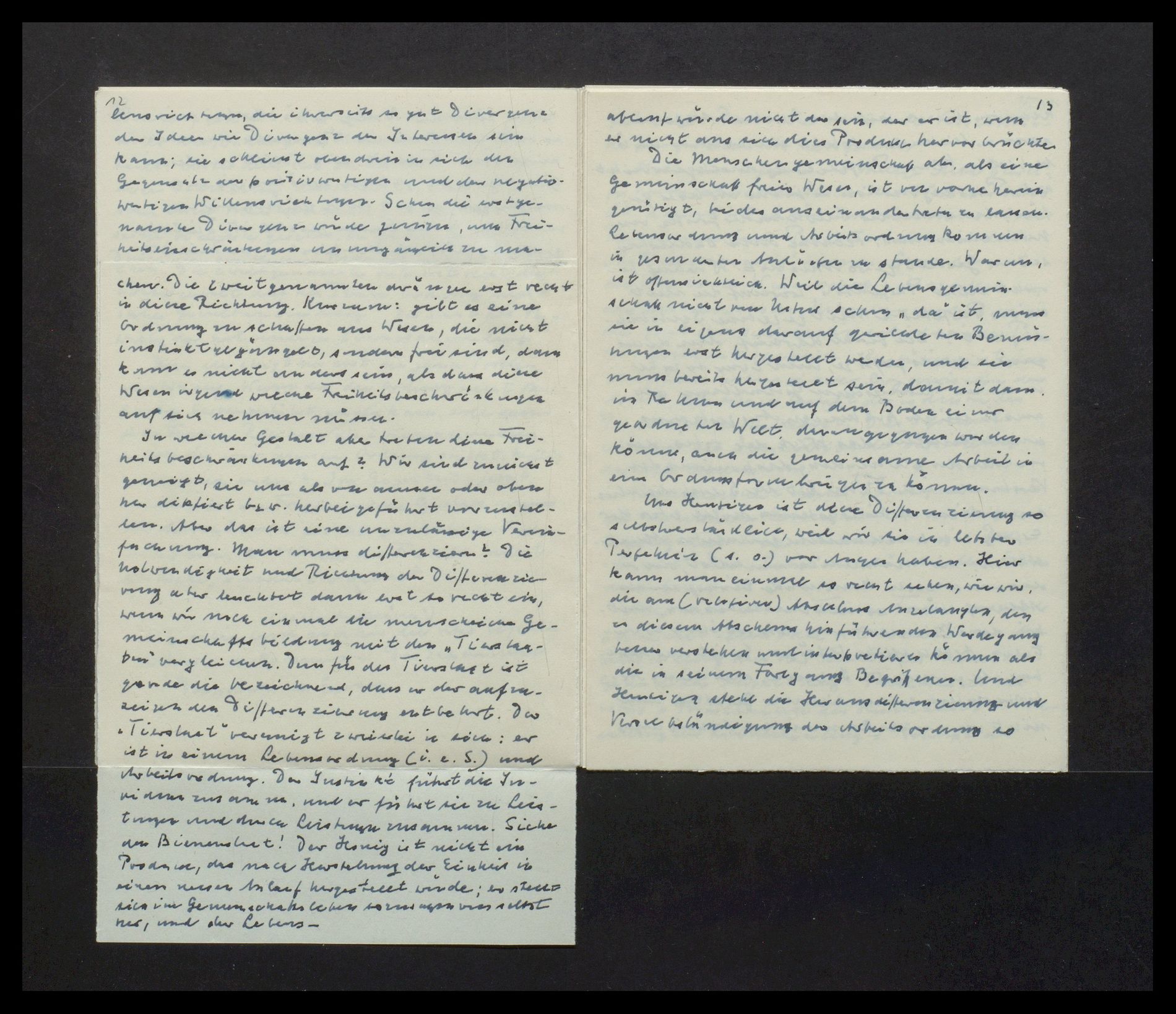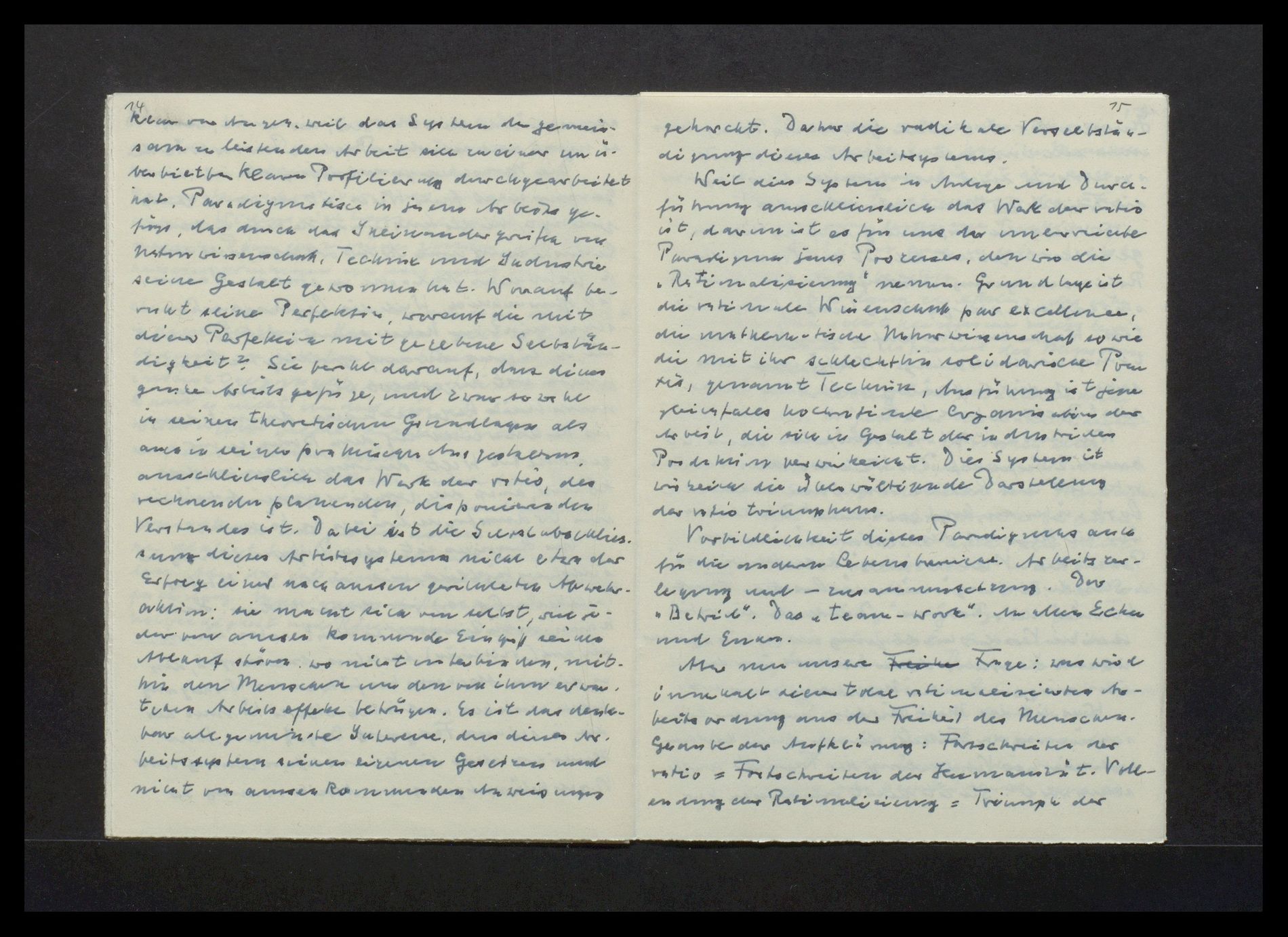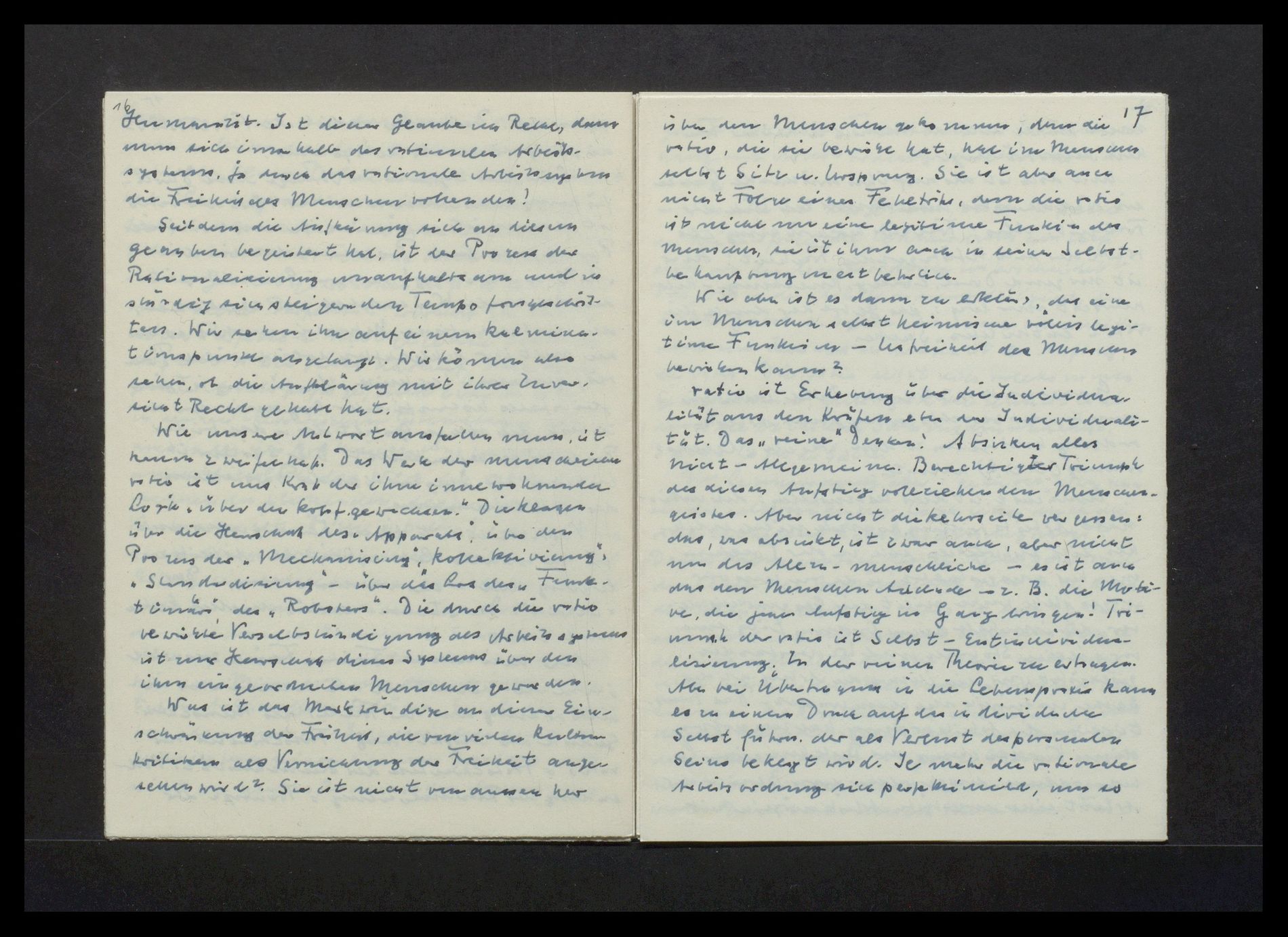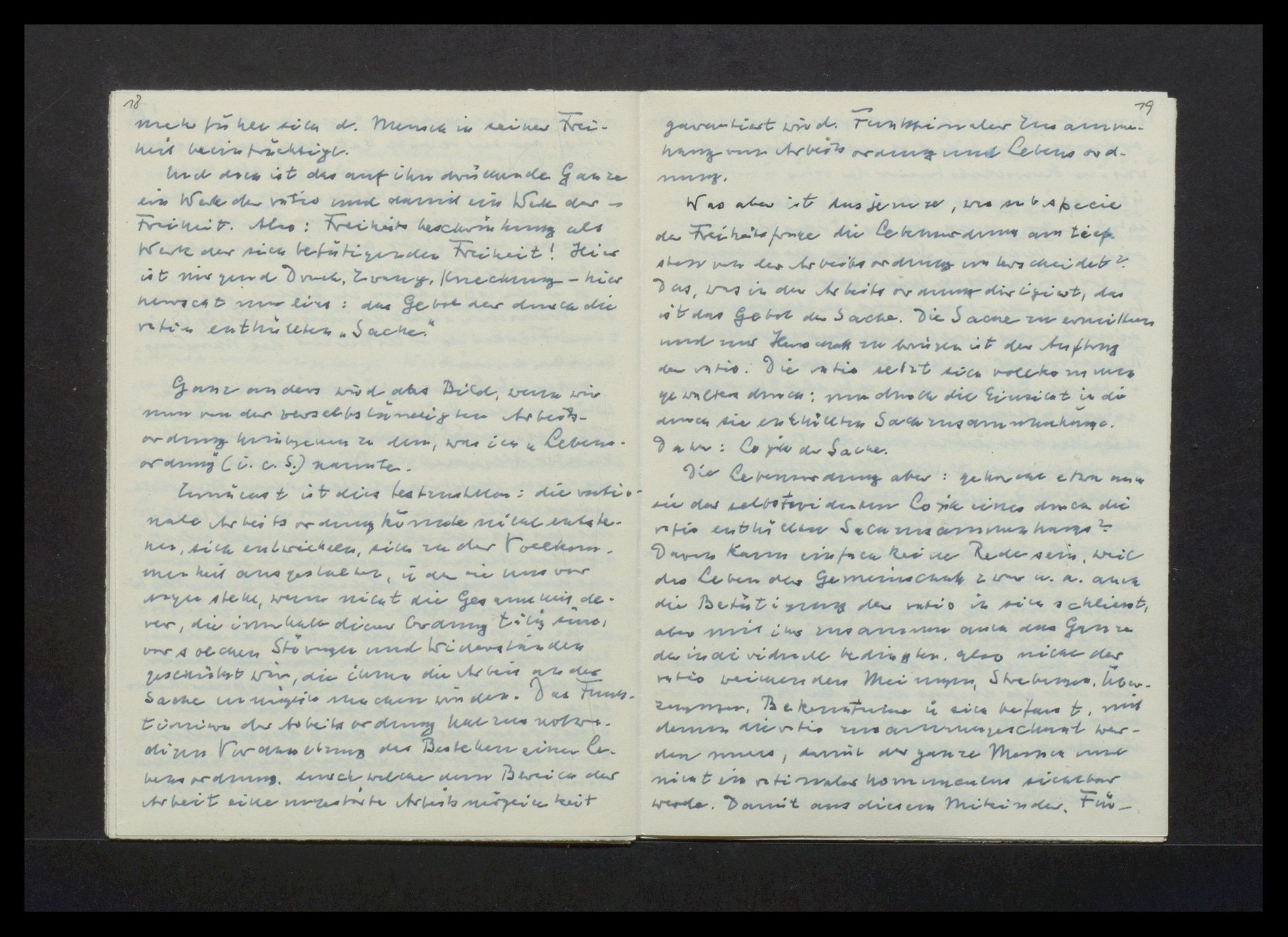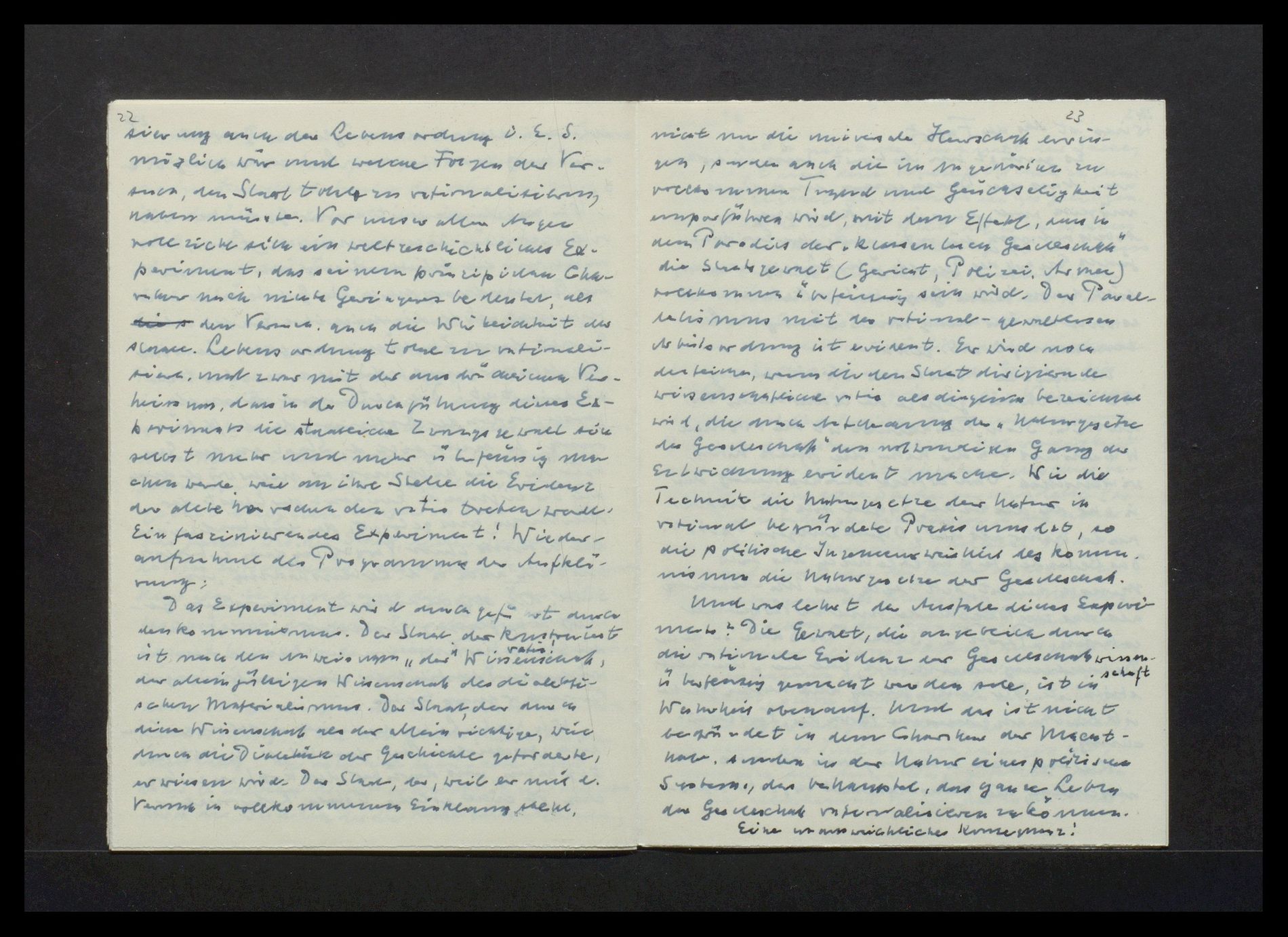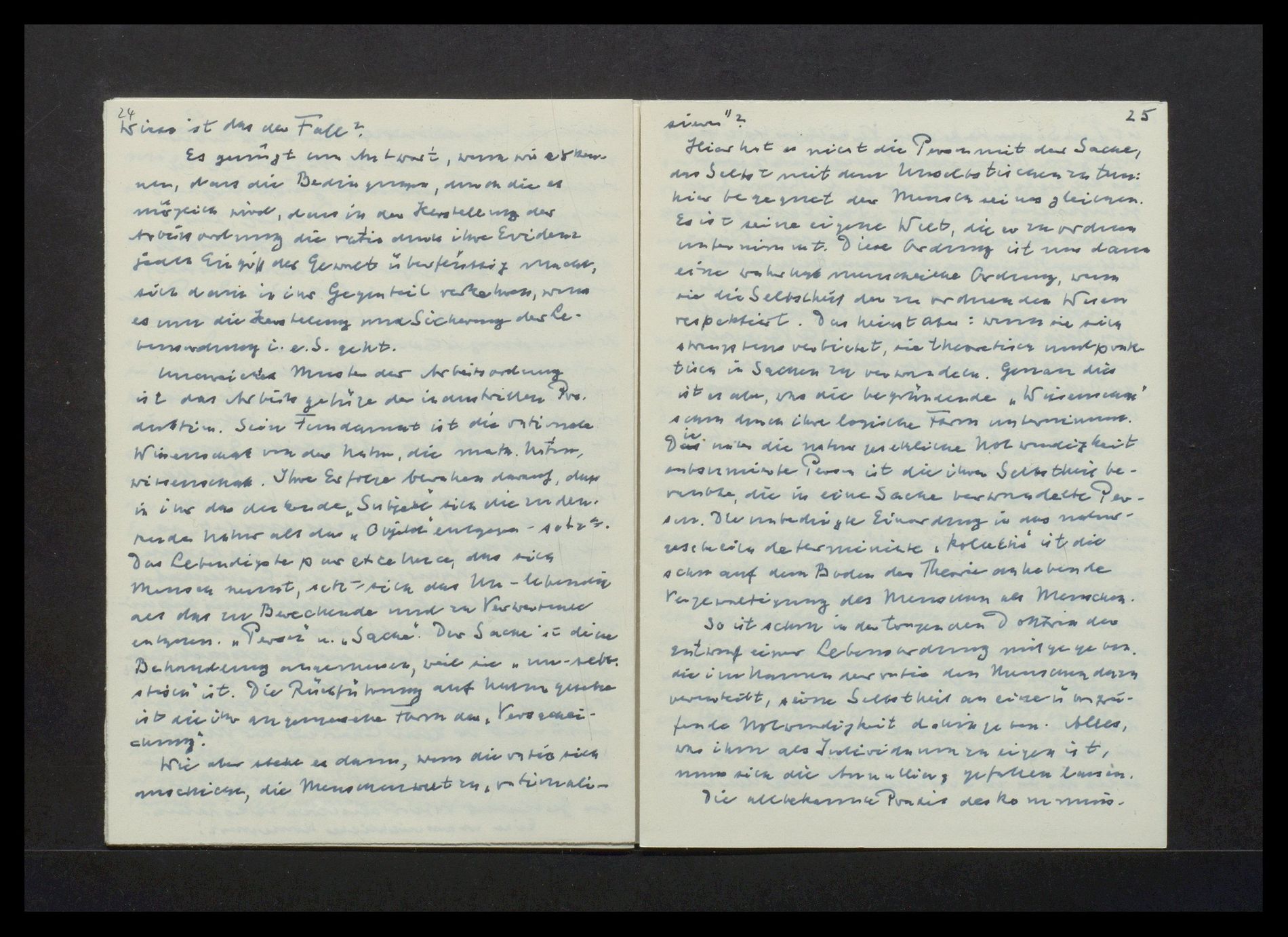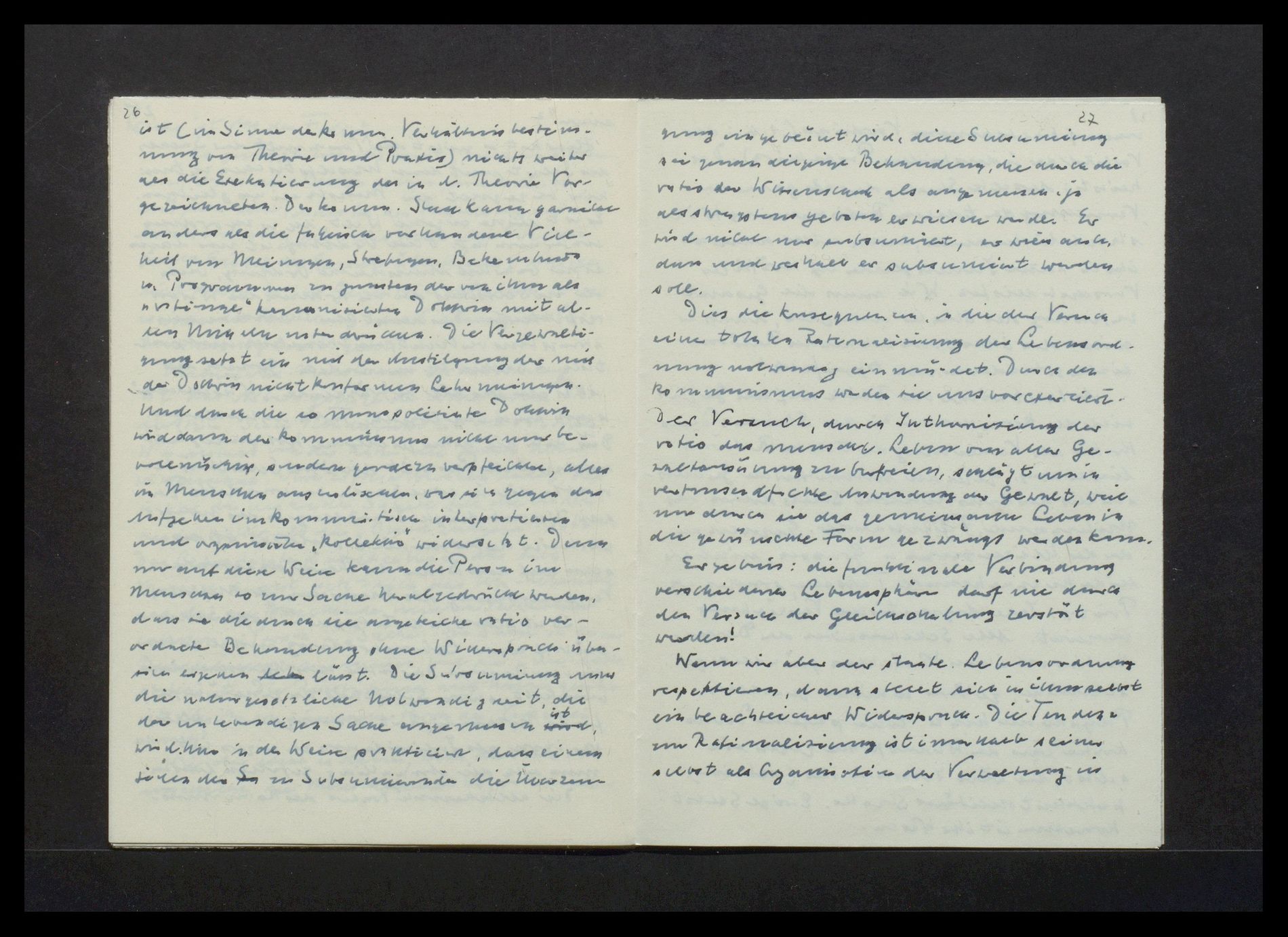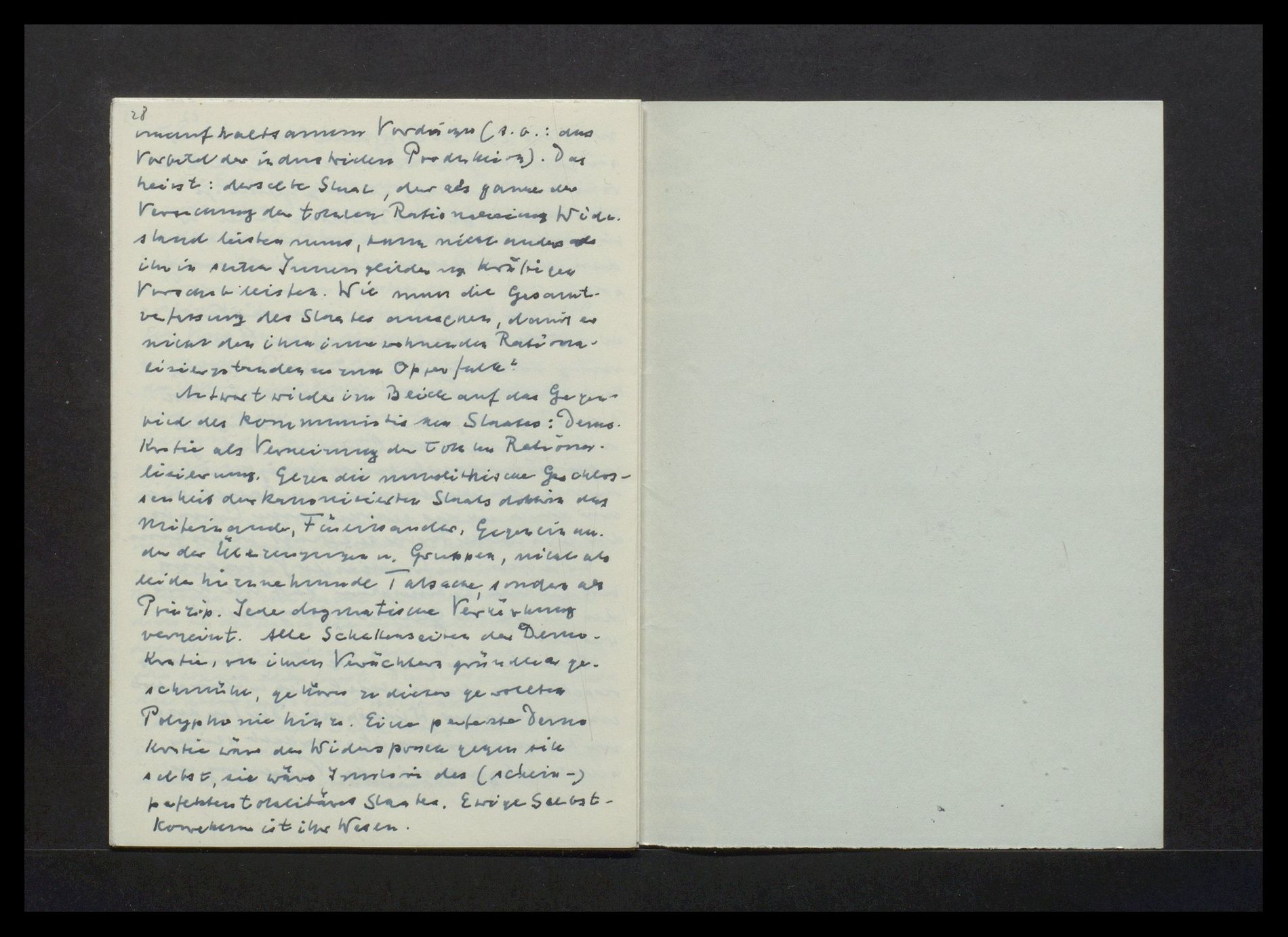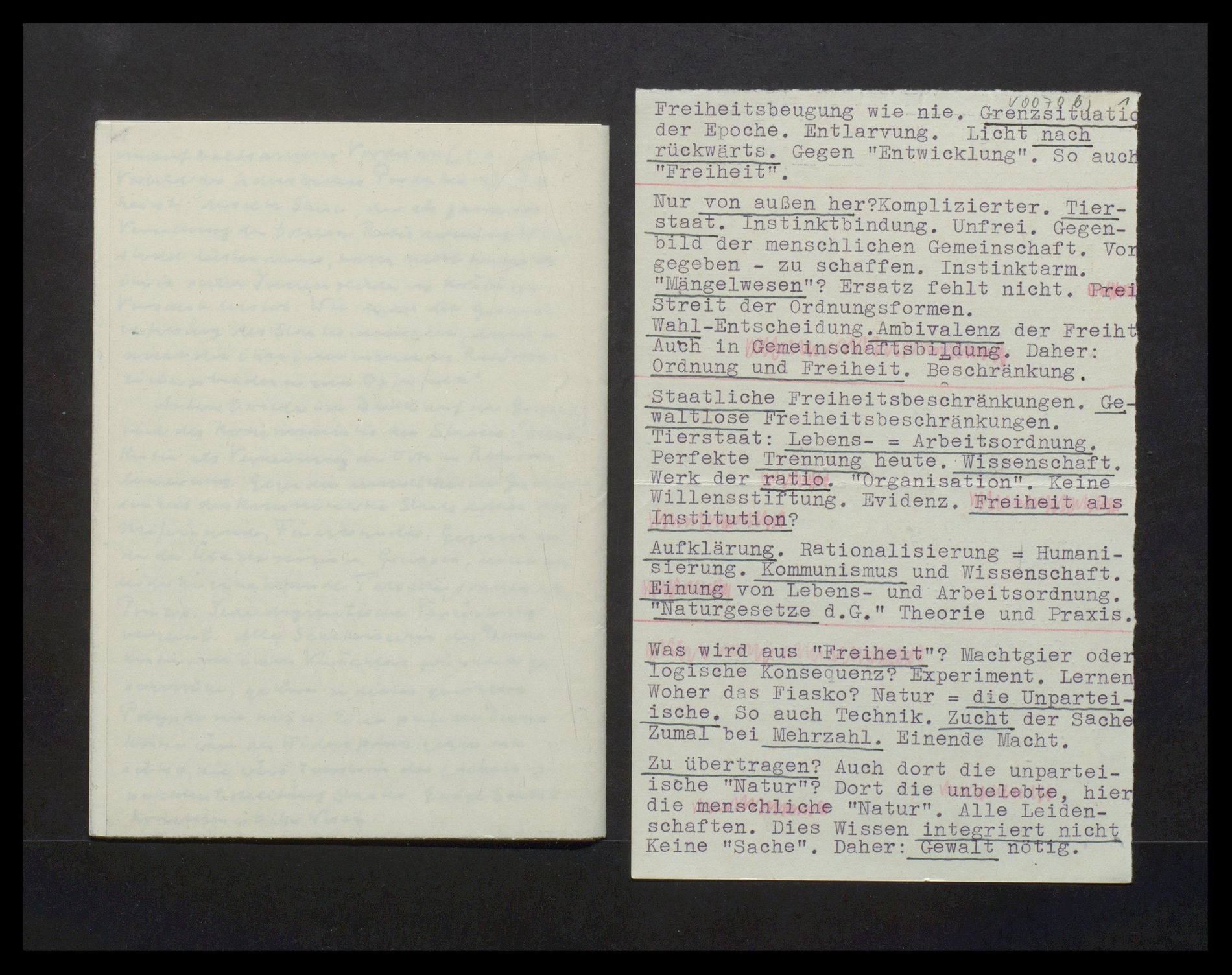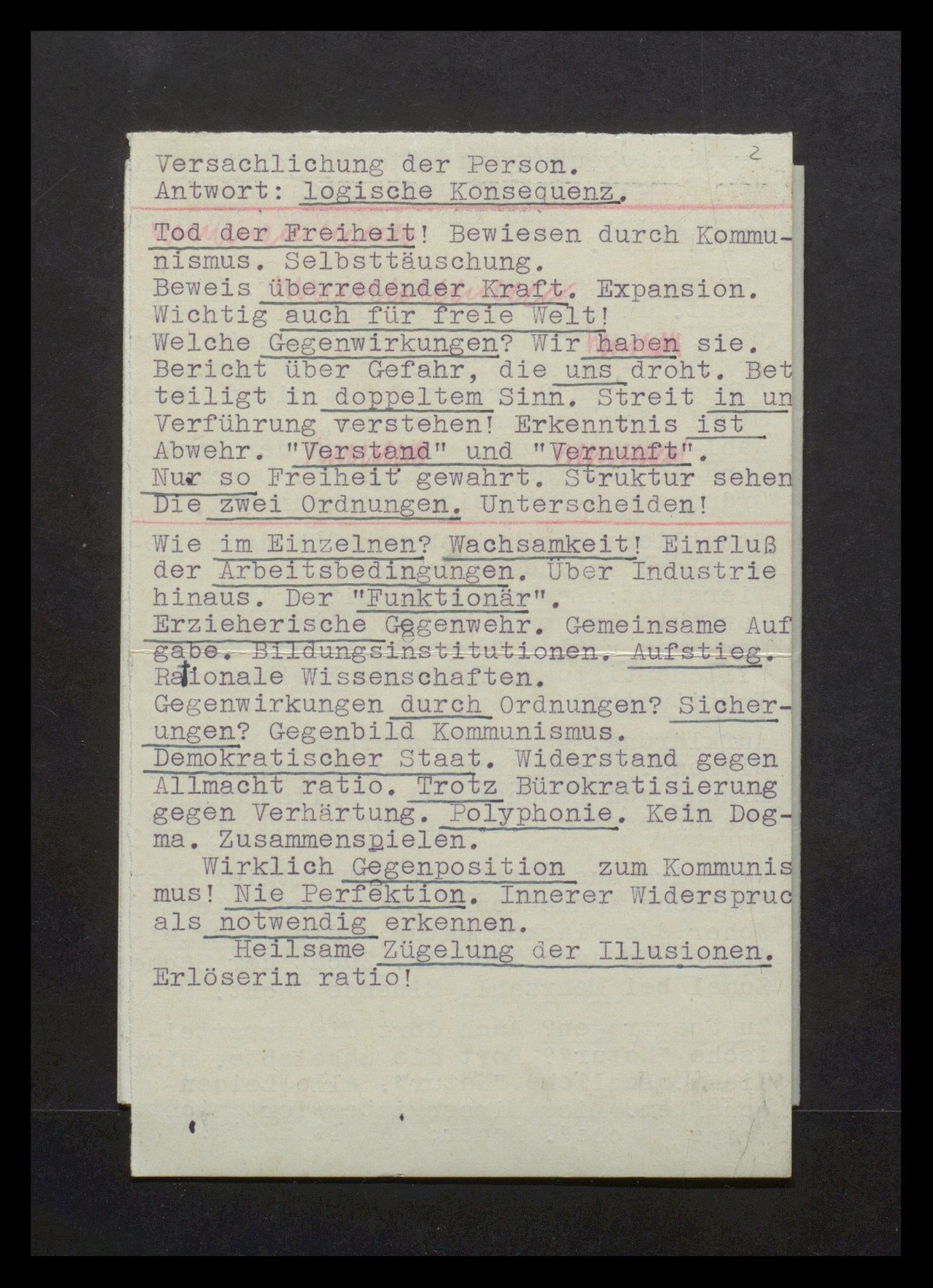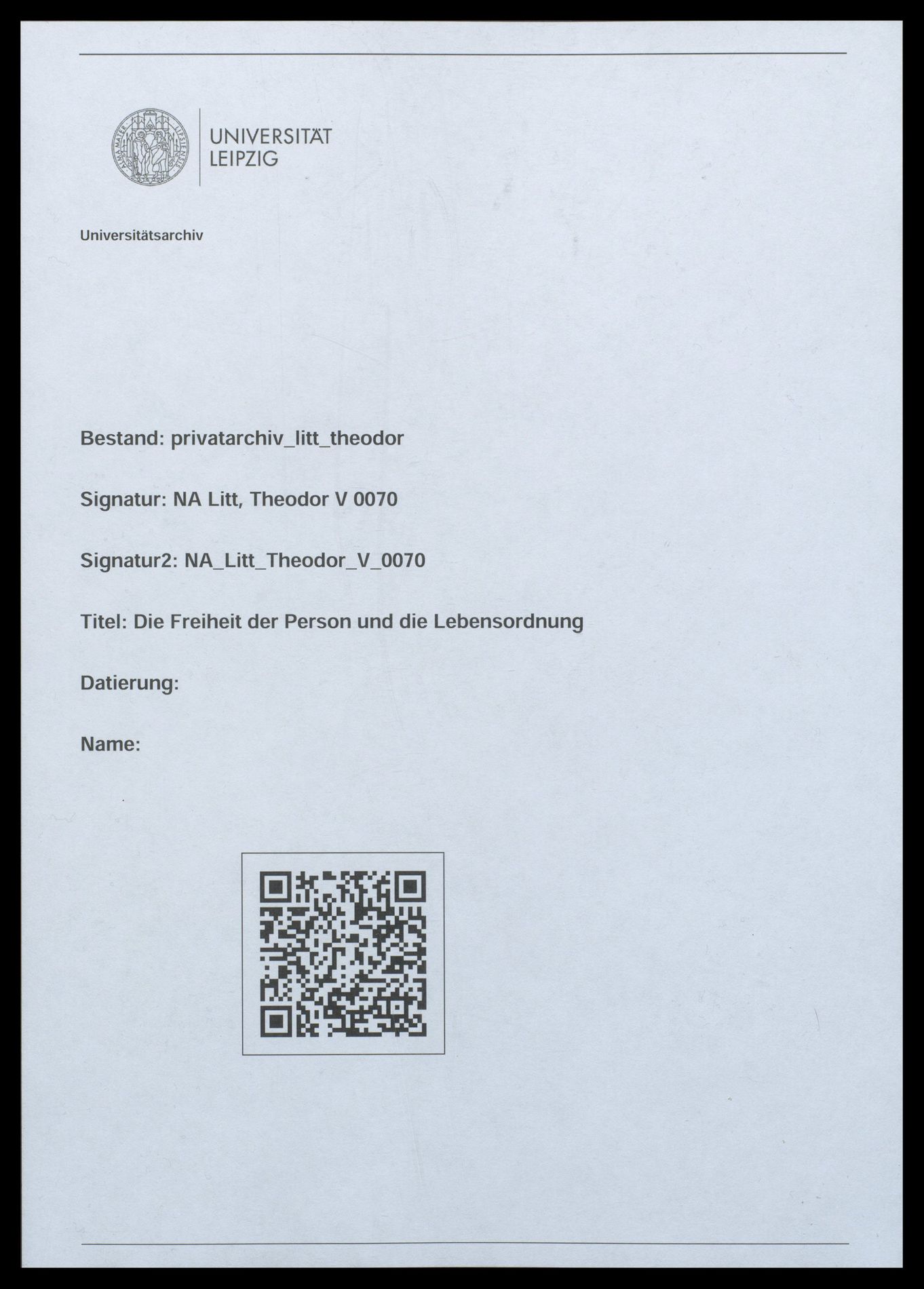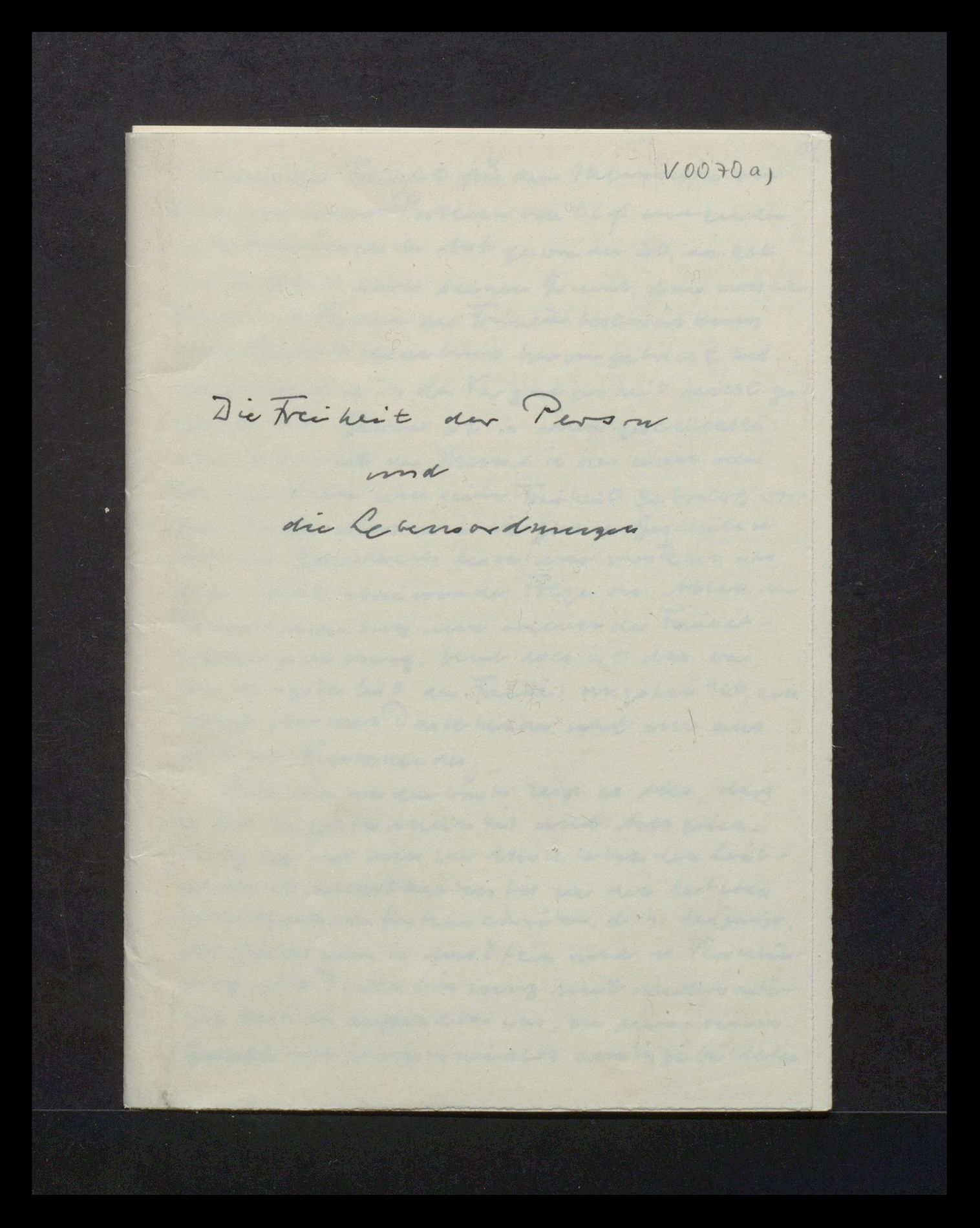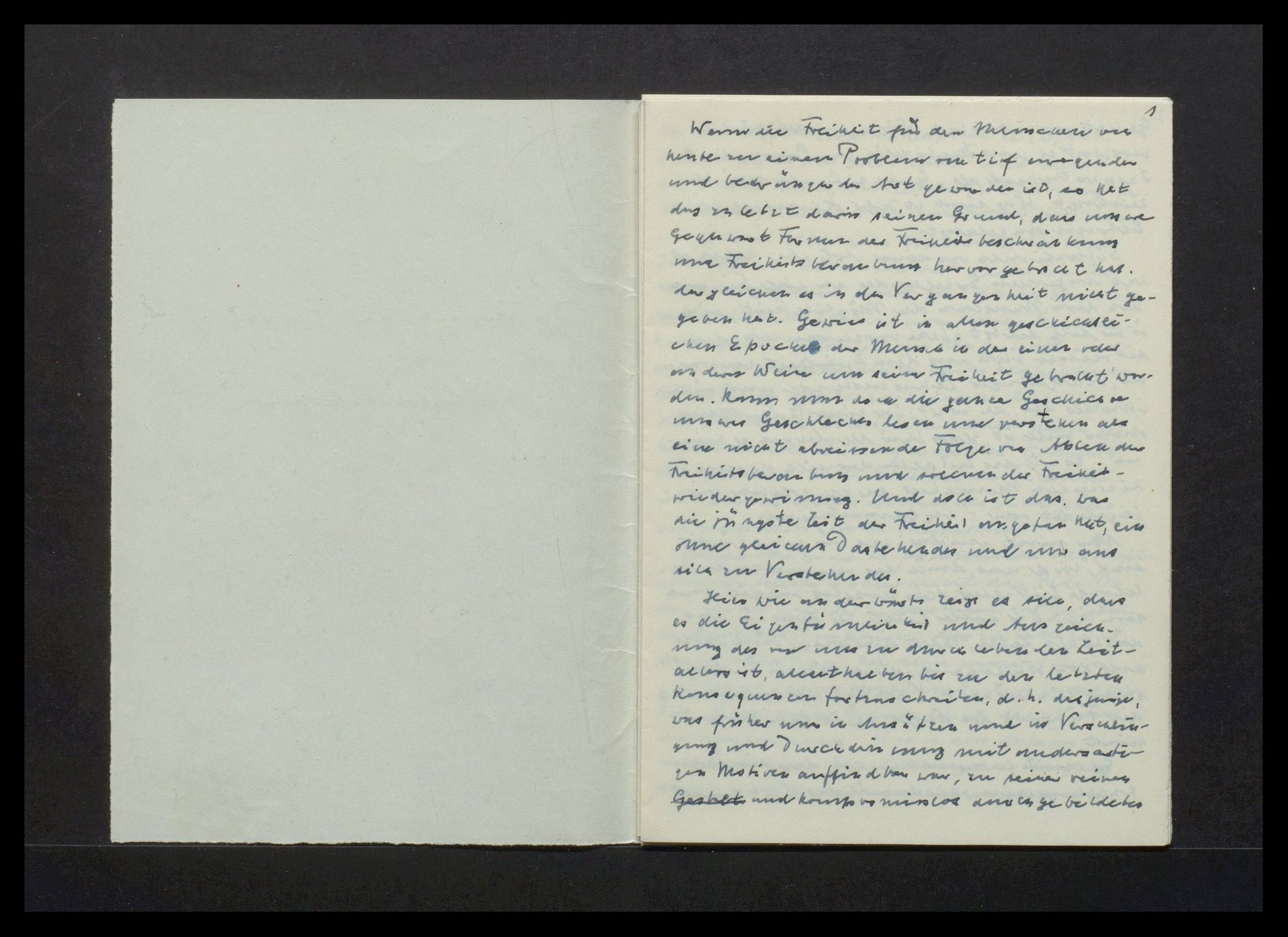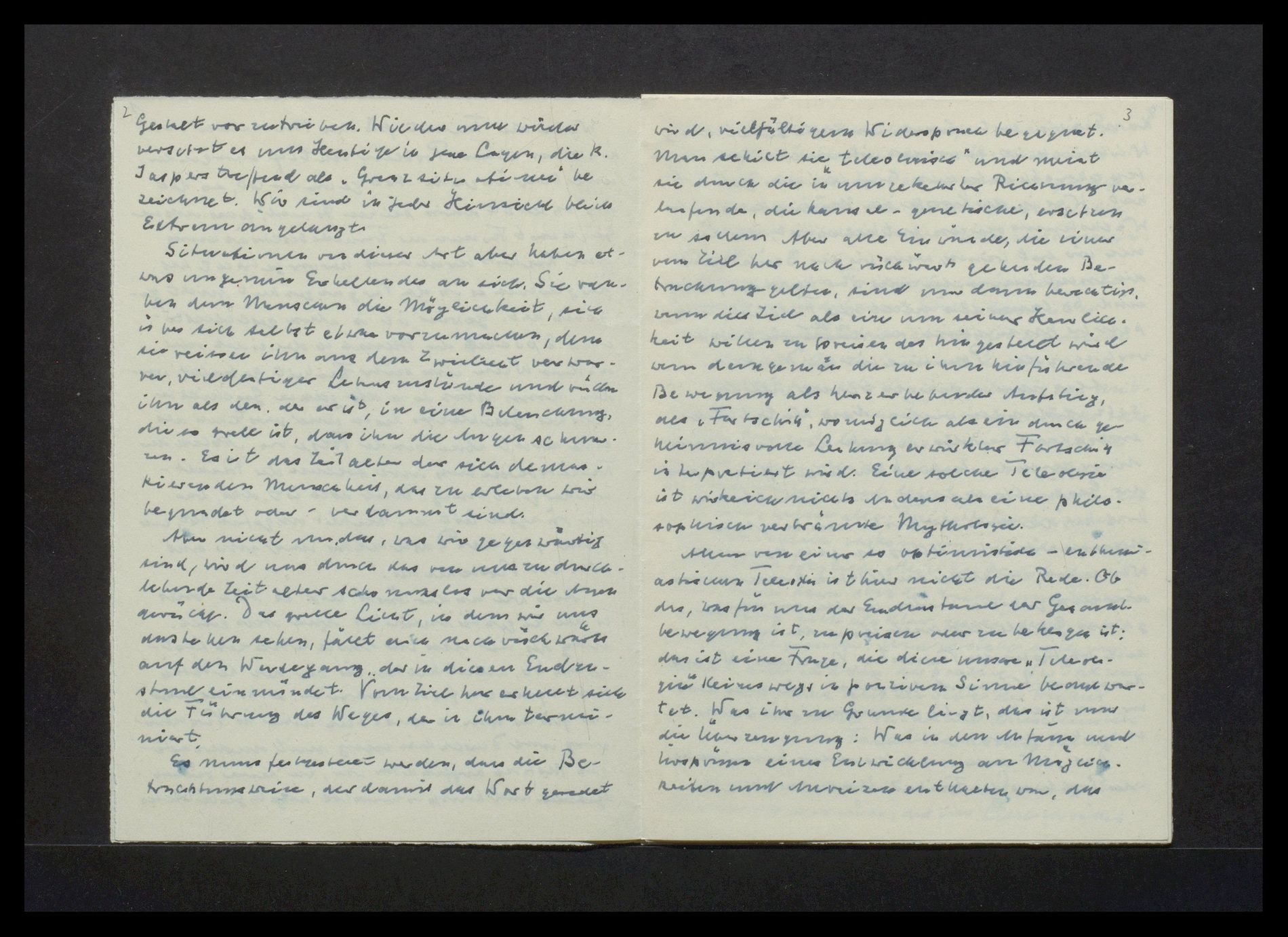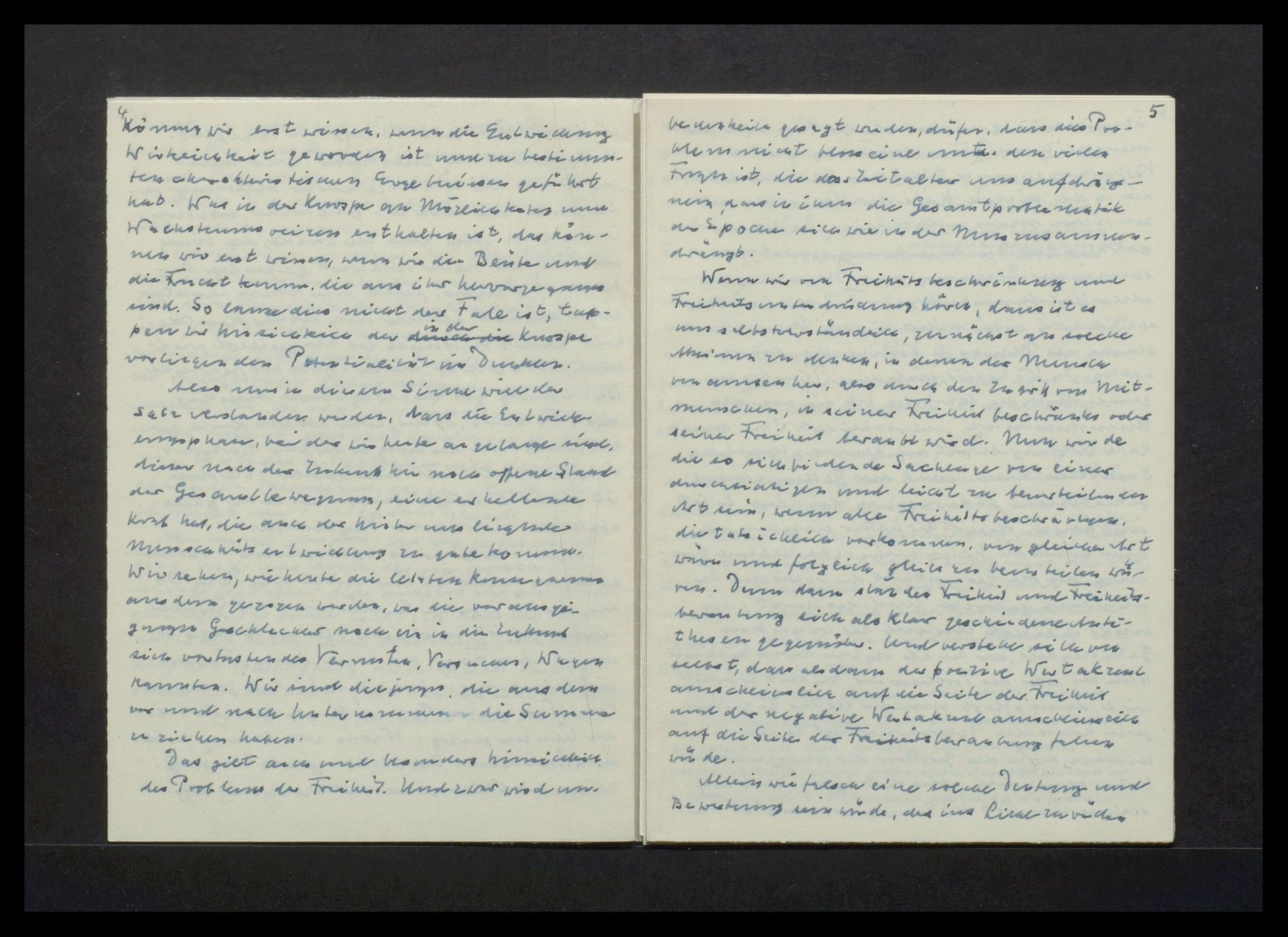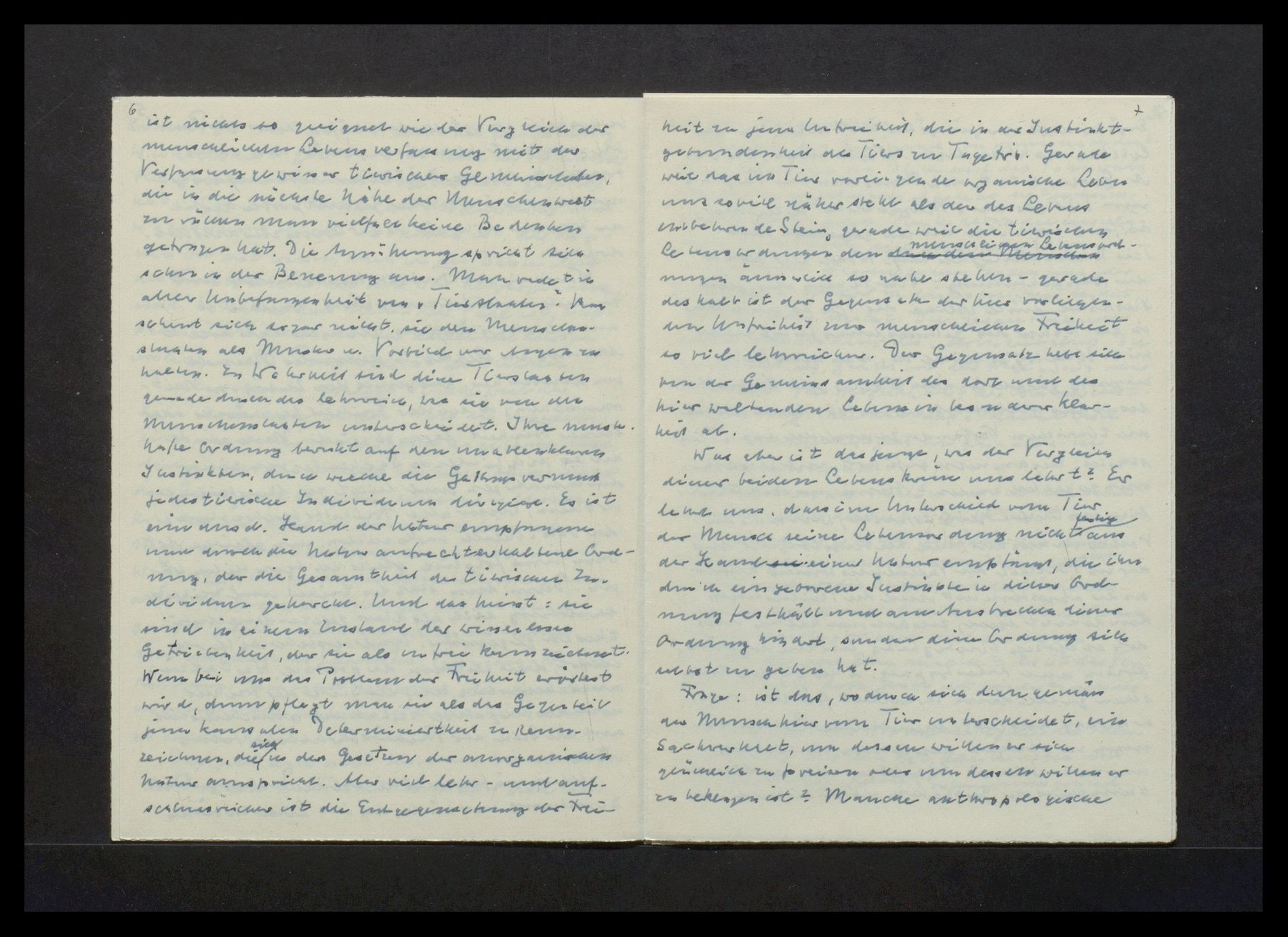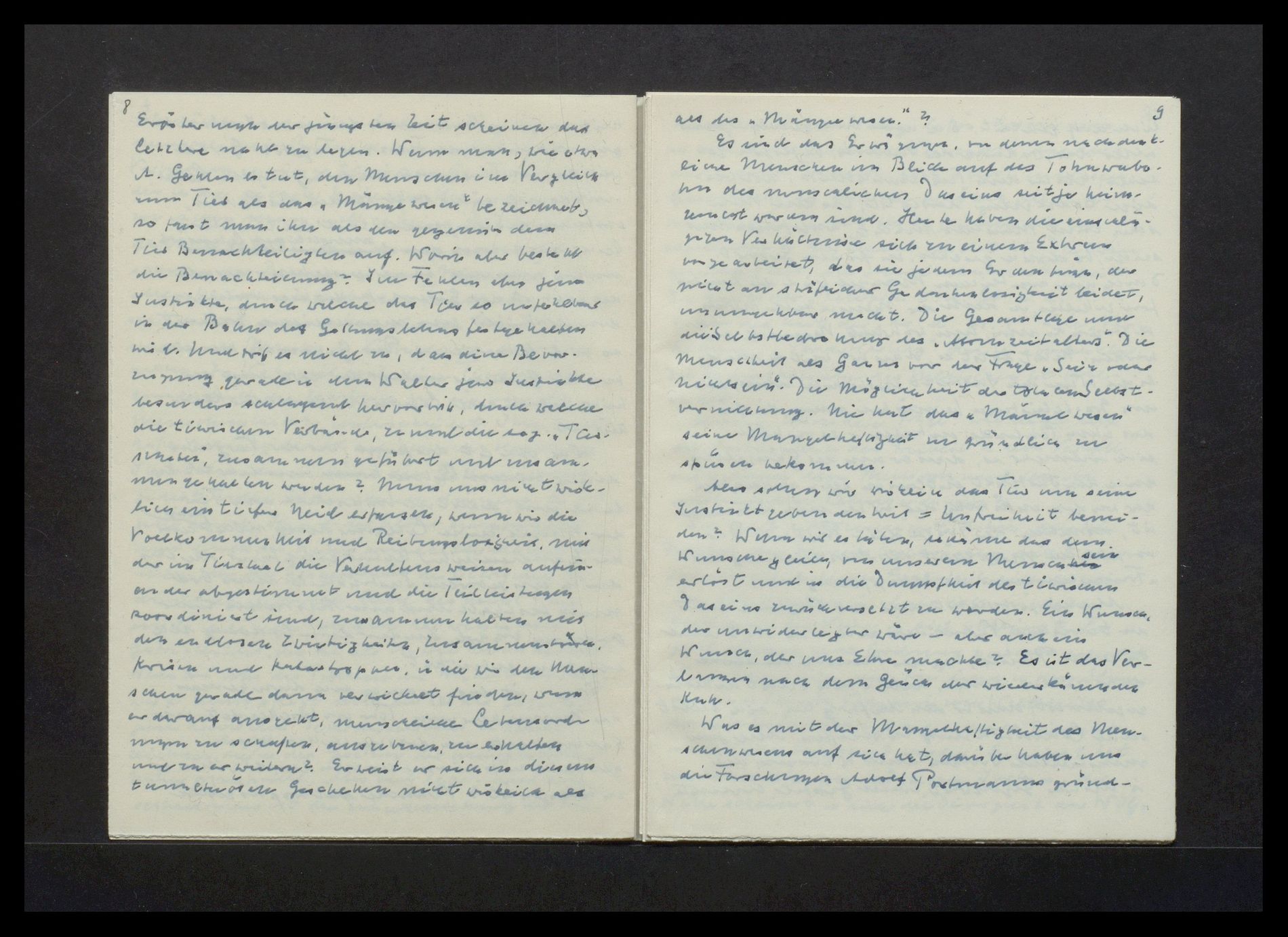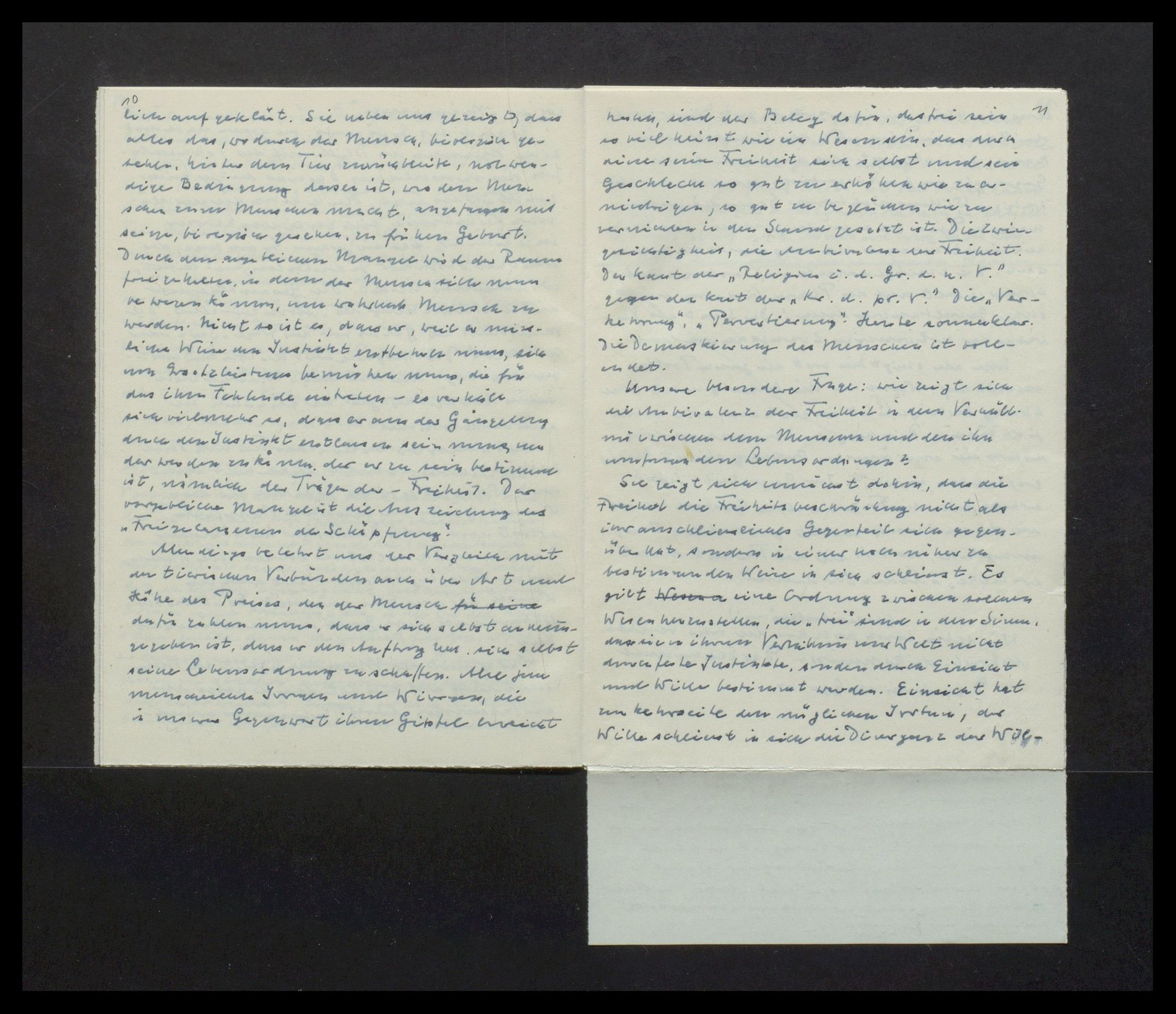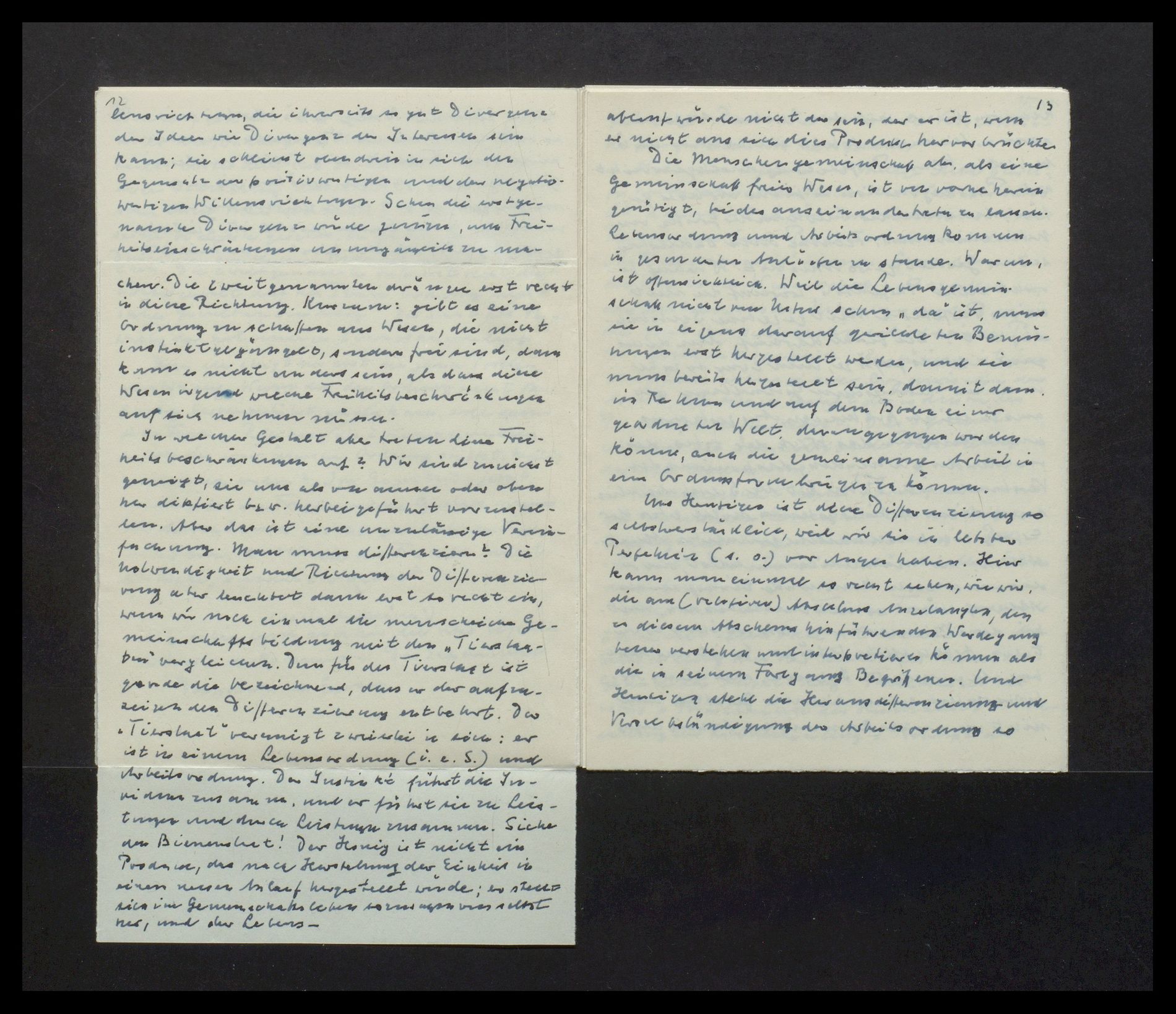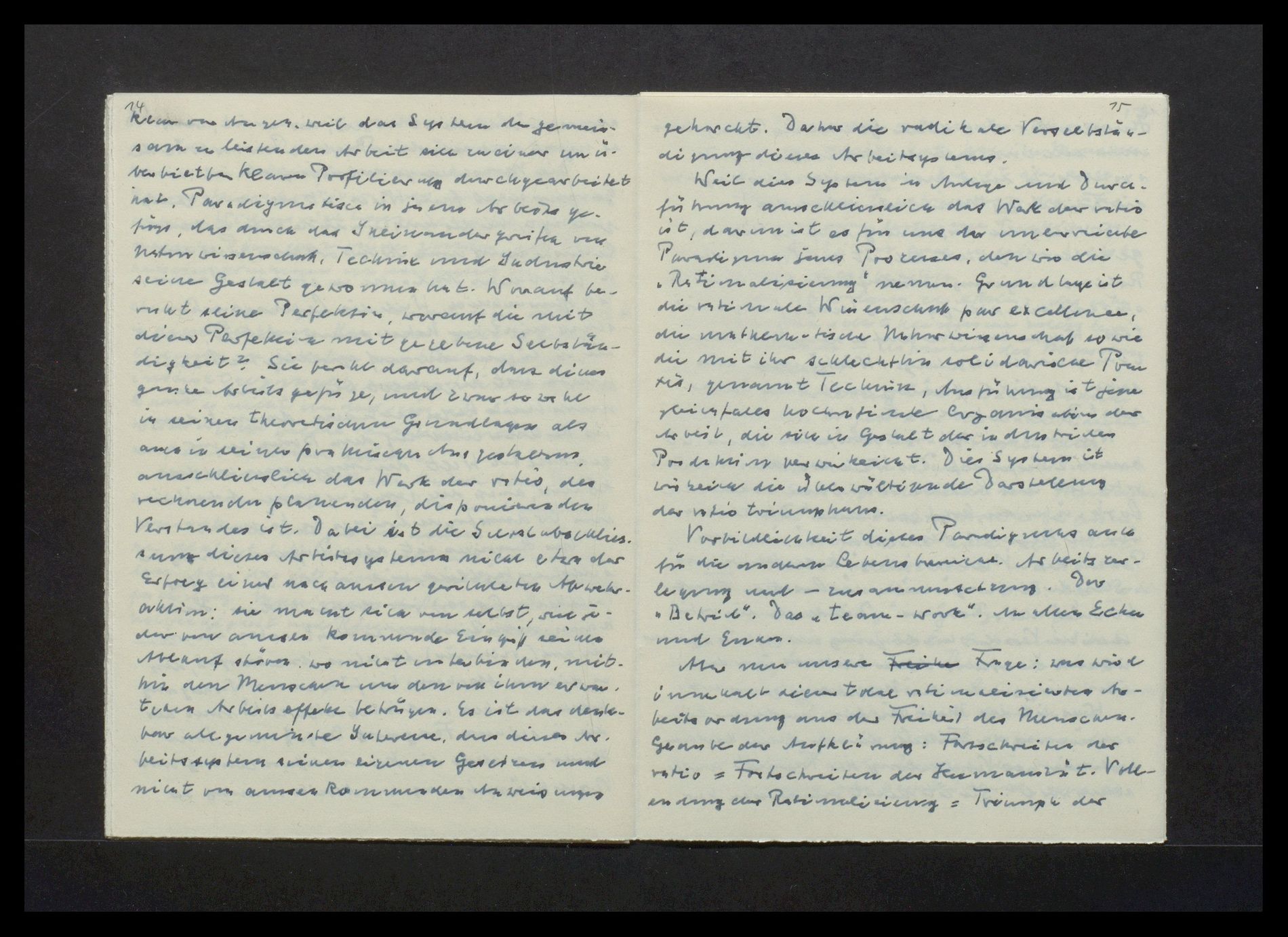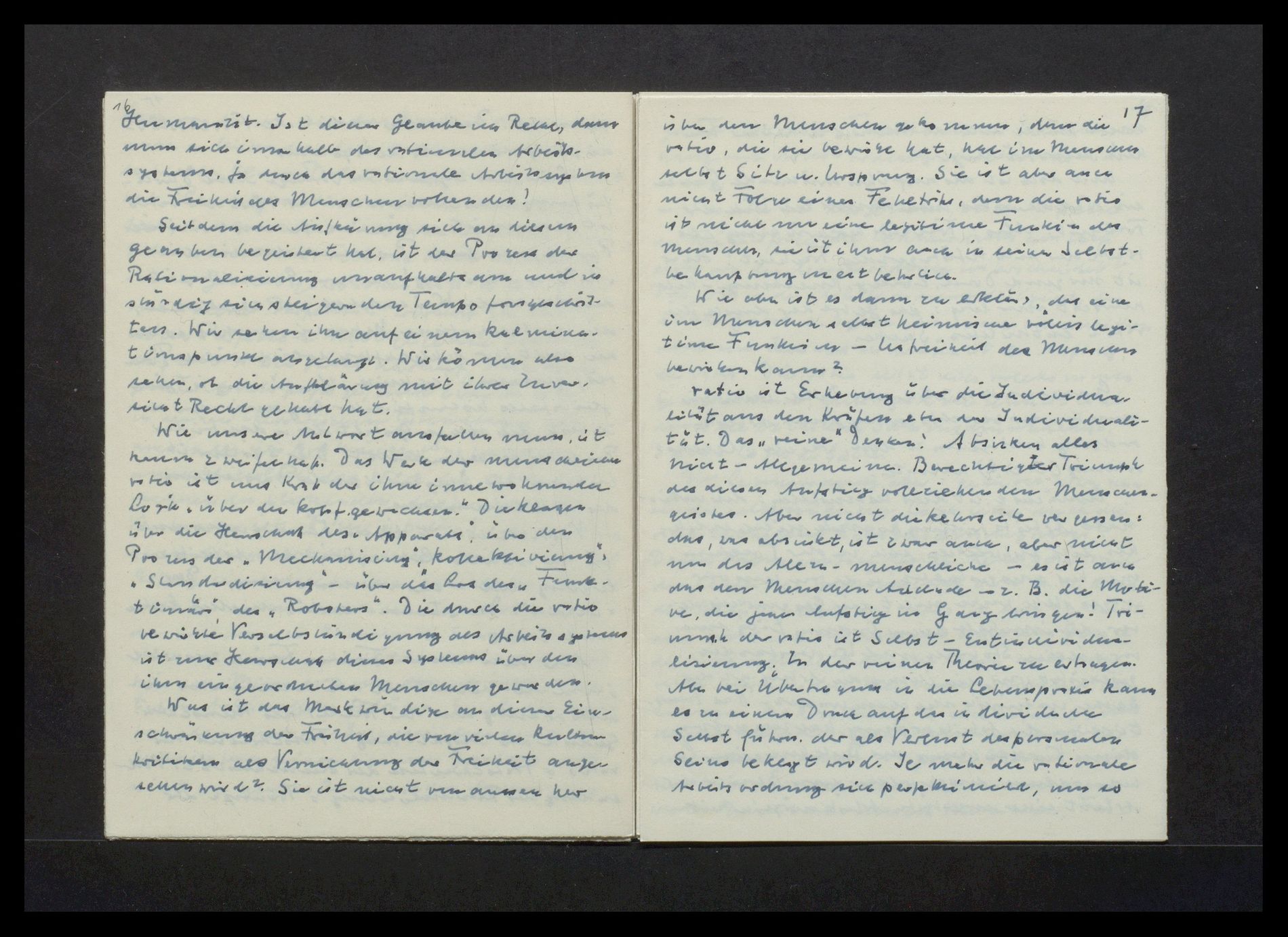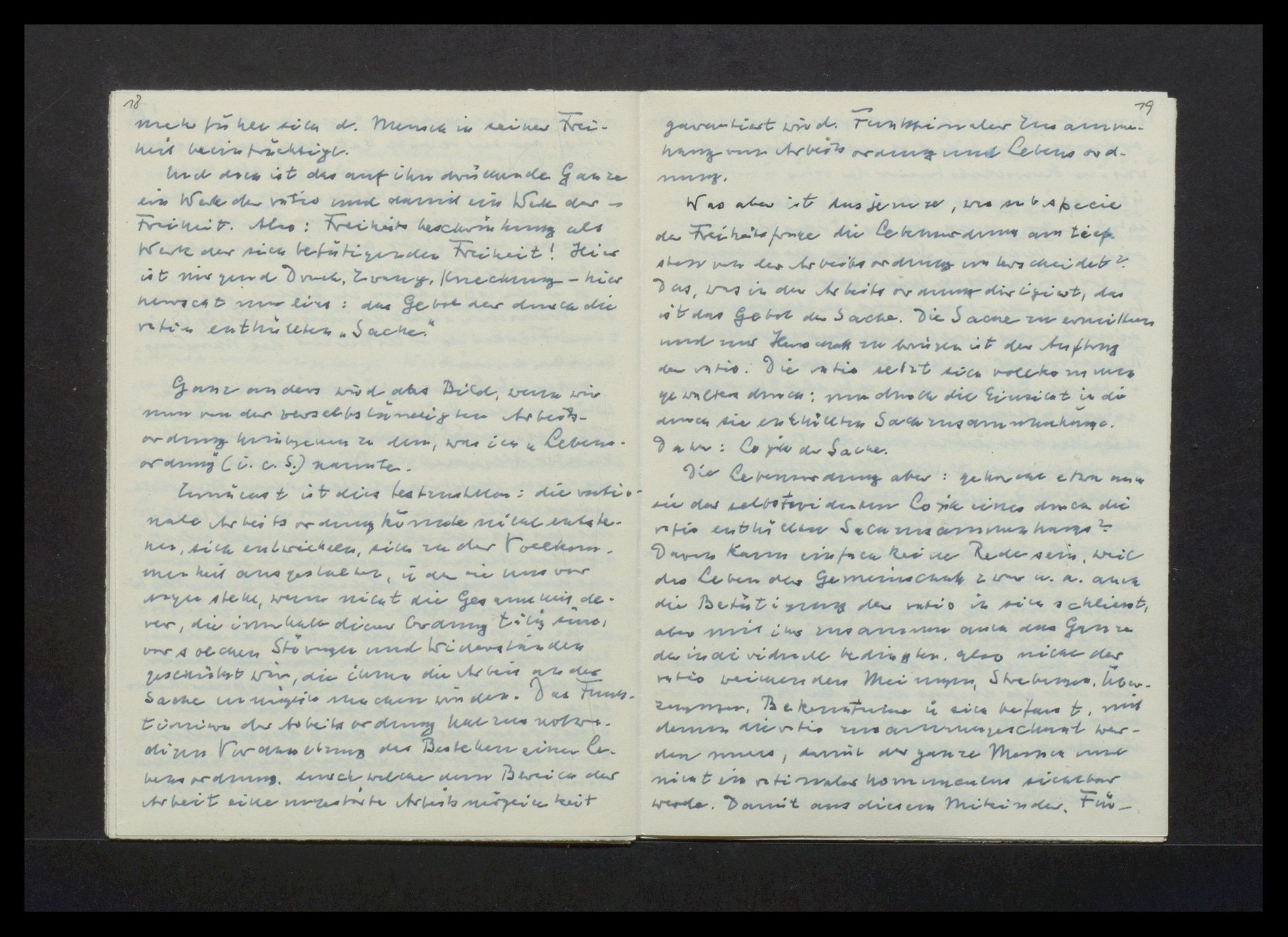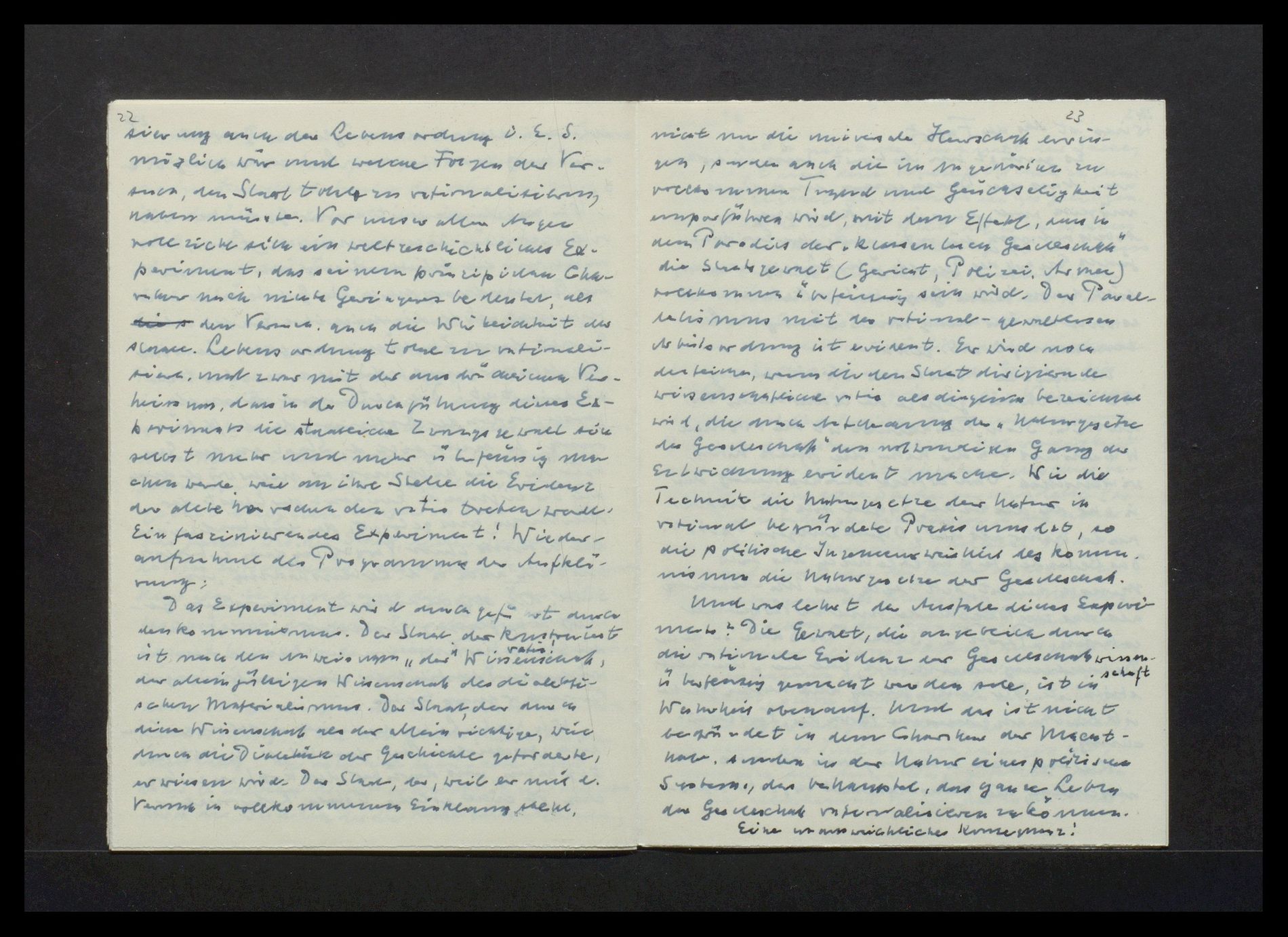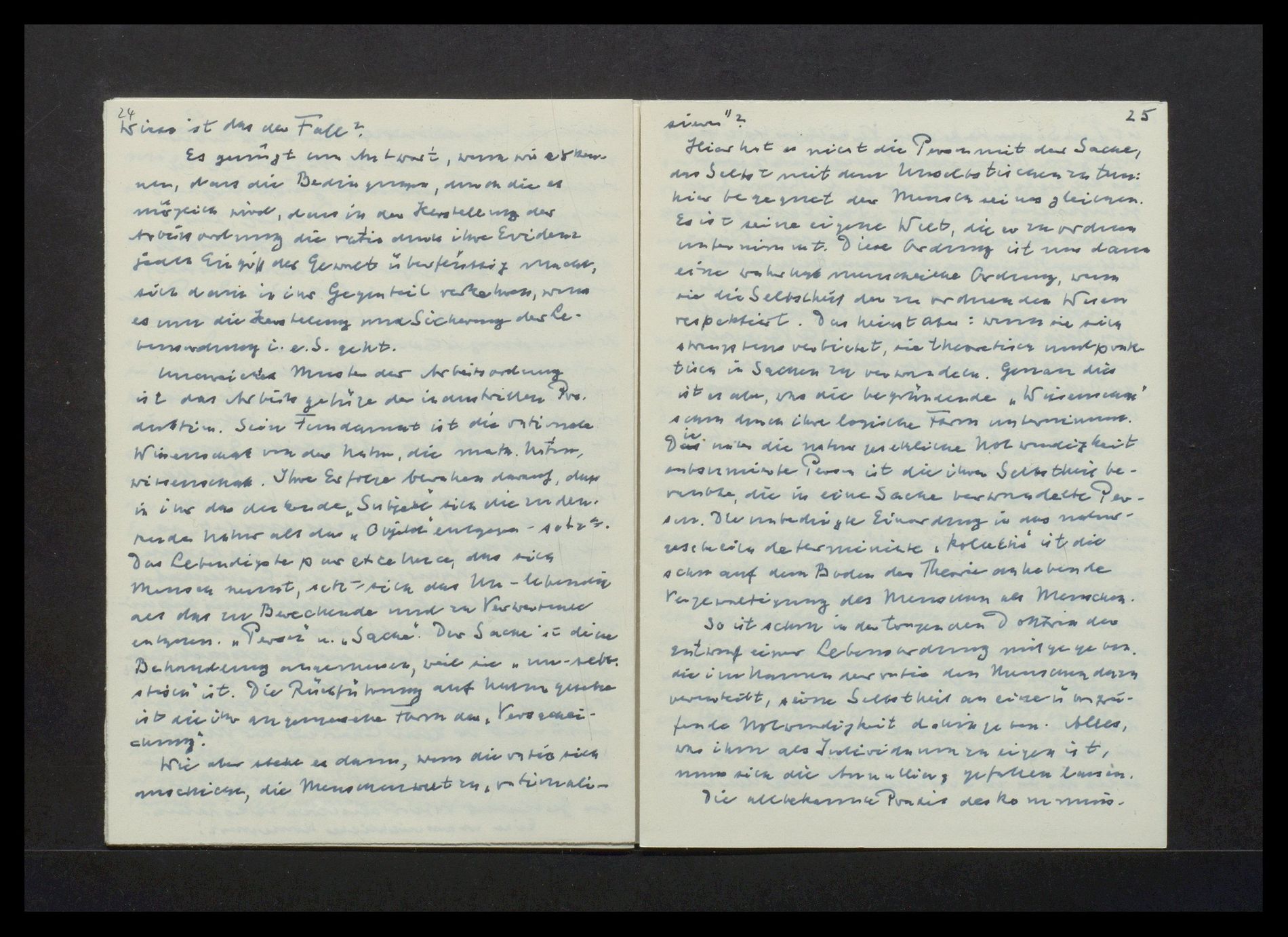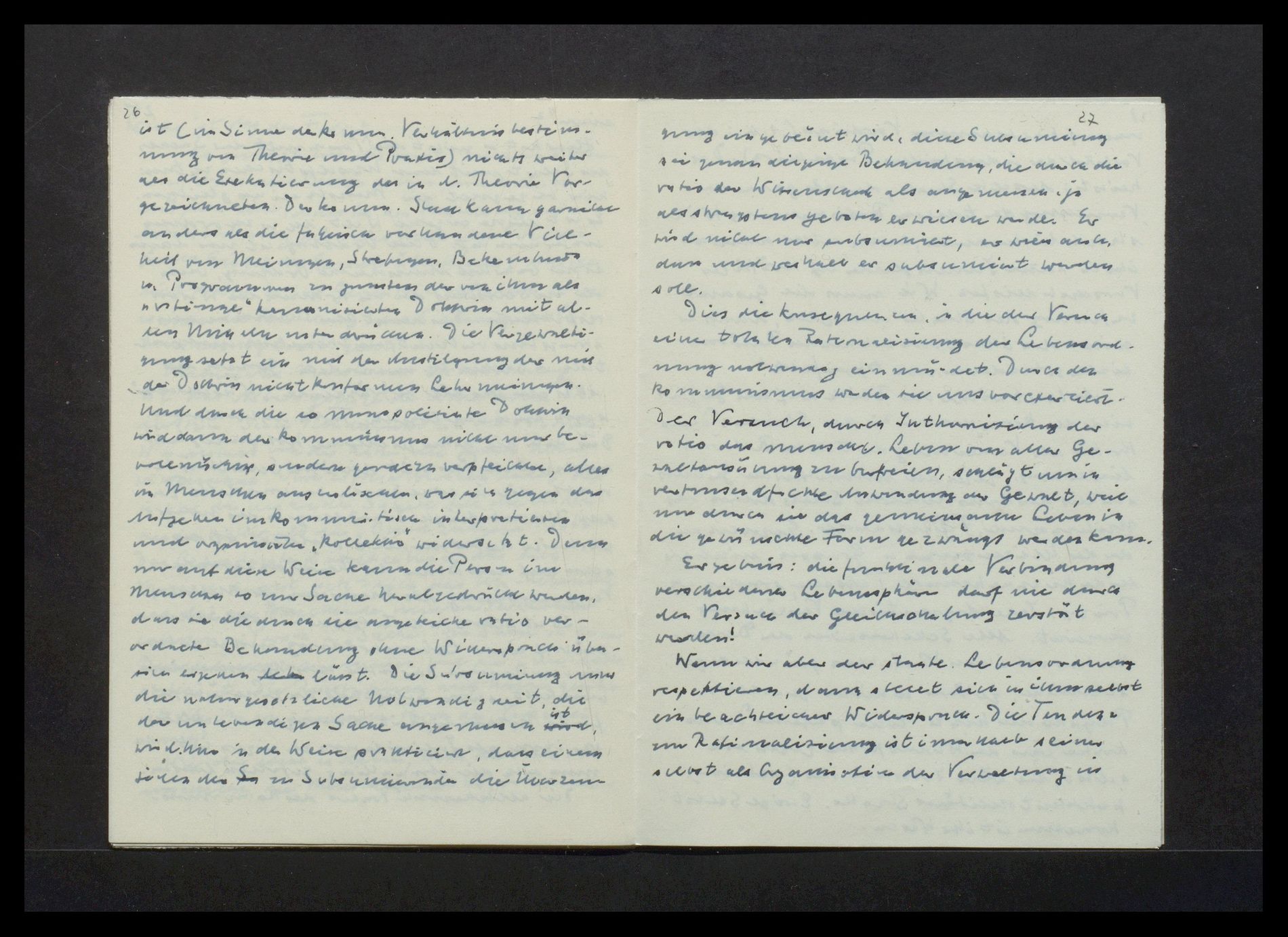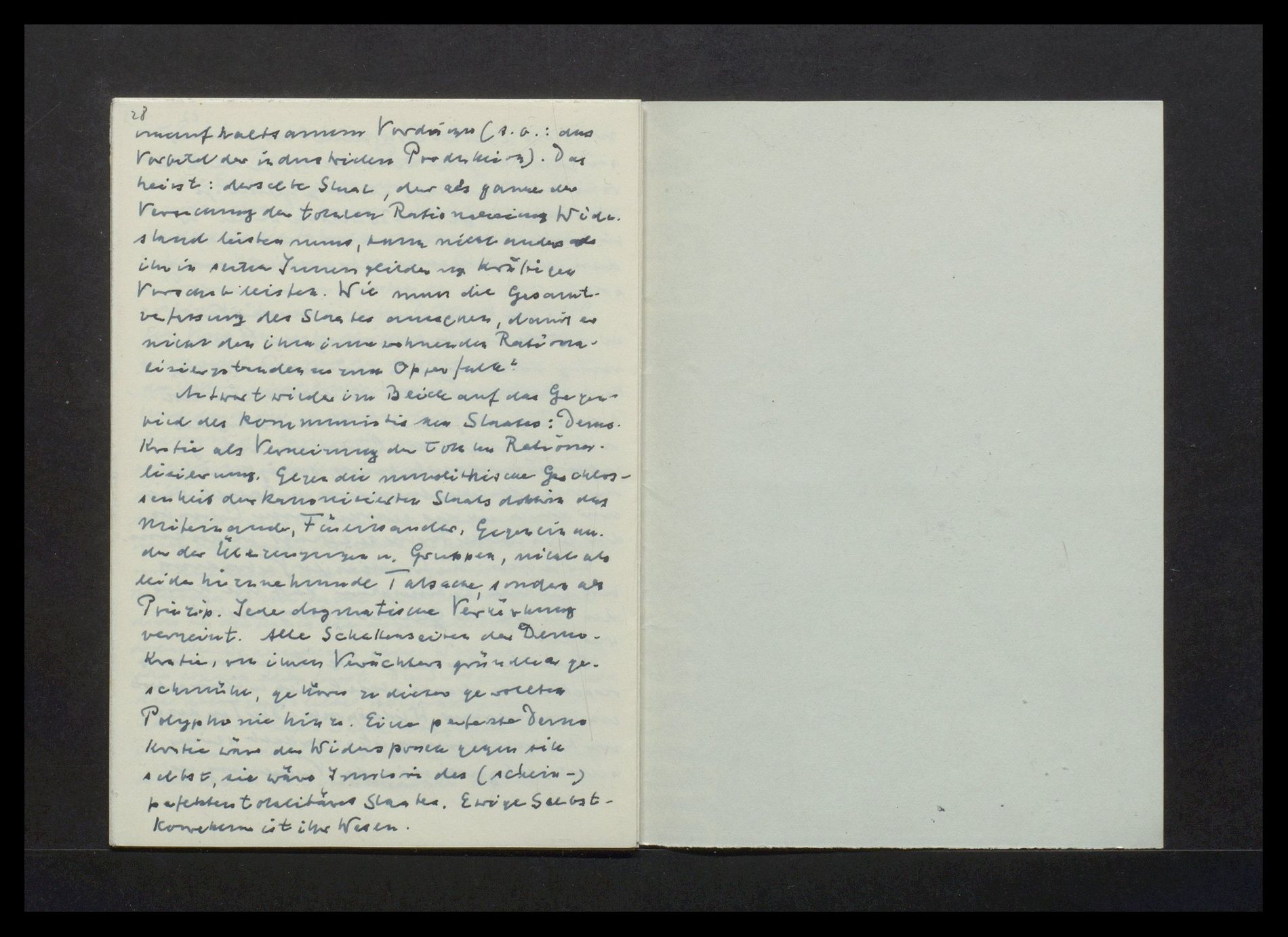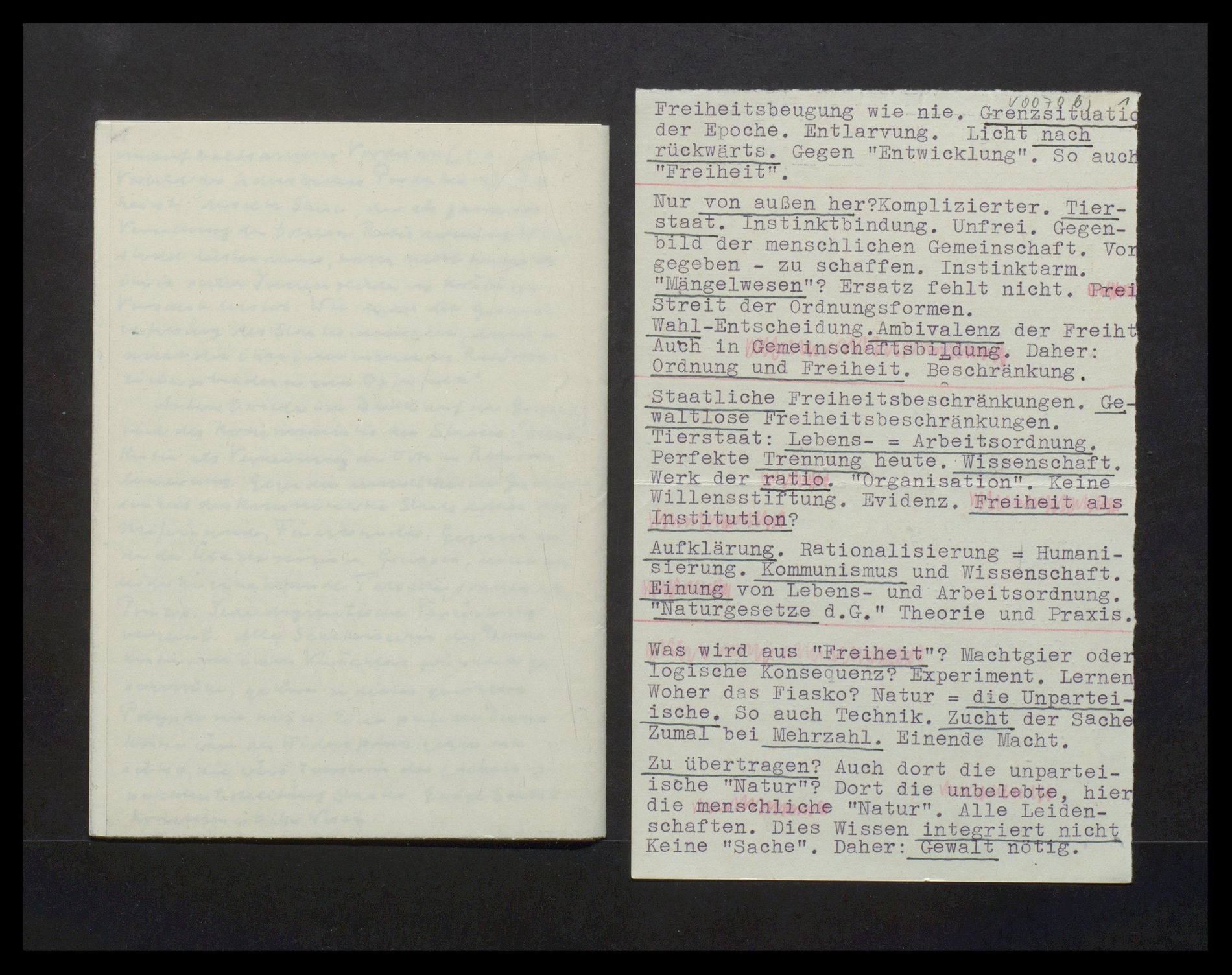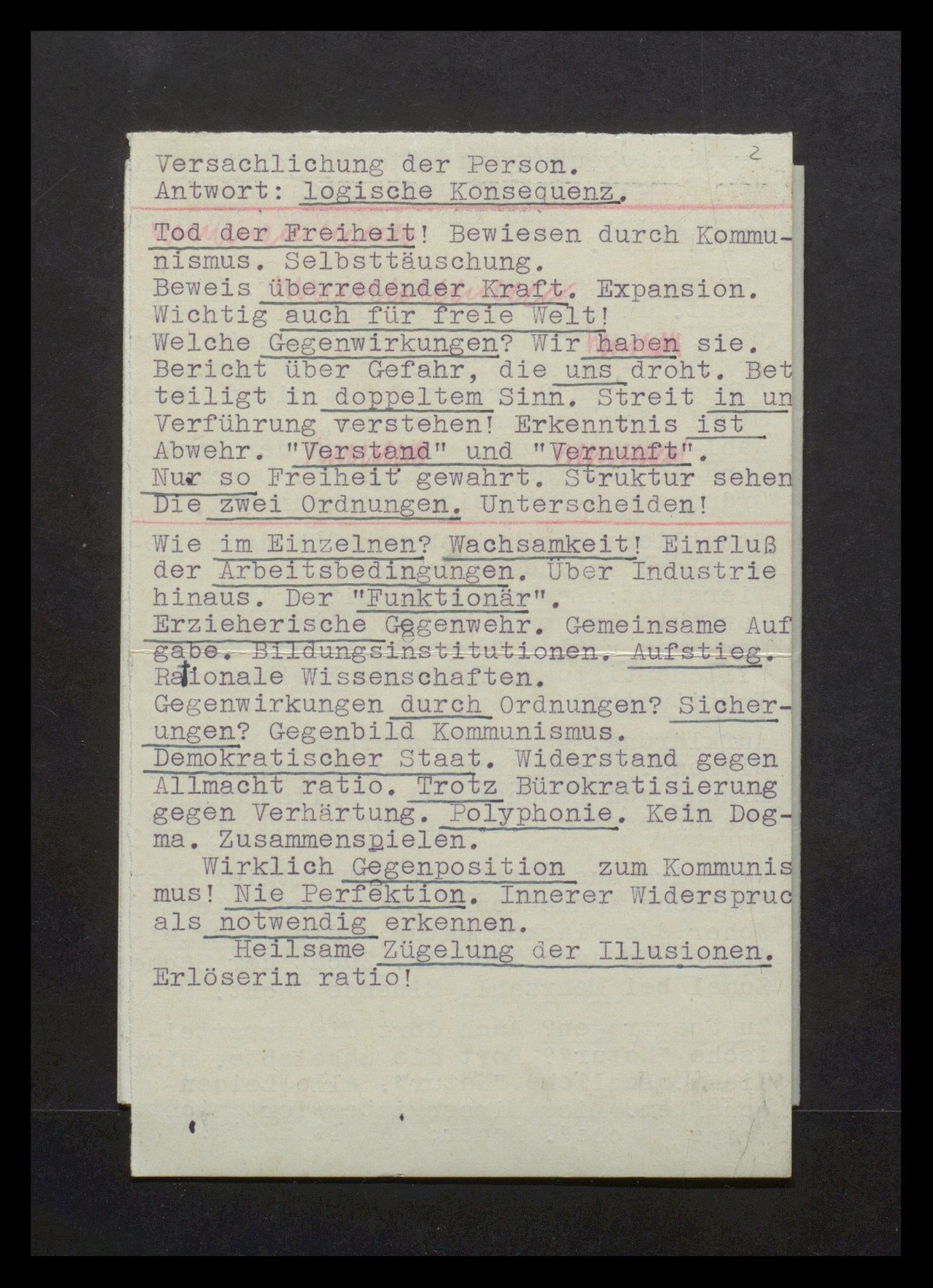| Bemerkungen | vgl. A 196
Die Freiheit der Person und die Lebensordnung, Separatabzug aus dem Werk Erziehung zur Freiheit, S. 195-236, (1959); Dokumentenabschrift: V 0070a
(undatiert)
Titelblatt
Die Freiheit der Person
und
die Lebensordnung
1
Wenn die Freiheit für den Menschen von
heute zu einem Problem von tief erregender
und bedrängender Art geworden ist, so hat
das zuletzt darin seinen Grund, dass unsere
Gegenwart Formen der Freiheitsbeschränkung
und Freiheitsberaubung hervorgebracht hat,
dergleichen es in der Vergangenheit nicht ge-
geben hat. Gewiss ist in allen geschichtli-
chen Epochen der Mensch in der einen oder
anderen Weise um seine Freiheit gebracht wor-
den. Kann man doch die ganze Geschichte
unseres geschlechts lesen und verstehen als
eine nicht abreissende Folge von Akten der
Freiheitsberaubung und solchen der Freiheit-
wiedergewinnung. Und doch ist das, was
die jüngste Zeit der Freiheit angetan hat, ein
ohne gleichen Dastehendes und nur aus
sich zu Verstehendes.
Hier wie anderwärts zeigt es sich, das
es die Eigentümlichkeit und Auszeich-
nung des von uns zu durchlebenden Zeit-
alters ist, allenthalben bis zu den letzten
Konsequenzen fortzuschreiten, d.h. dasjenige,
was früher nur in Ansätzen und in Verschlin-
gung und Durchdringung mit andersarti-
gen Motiven auffindbar war, zu seiner reinen
Gestalt und kompromislos durchgebildeter
2
Gestalt vorzutrieben. Wieder und wieder
versetzt es uns Heutige in jene Lagen, die K.
Jaspers treffend als „Grenzsituationen“ be-
zeichnet. Wir sind in jeder Hinsicht beim
Extrem angelangt.
Situationen von dieser Art aber haben et-
was ungemein Erhellendes an sich. Sie rau-
ben dem Menschen die Möglichkeit, sich
über sich selbst etwas vorzumachen, denn
sie reissen ihn aus dem Zwielicht verwor-
ren, vieldeutiger Lebenszustände und rücken
ihn als den, der er ist, in eine Beleuchtung,
die so grell ist, dass ihn die Augen schmer-
zen. Es ist das Zeitalter der sich demas-
kierenden Menschheit, das zu erleben wir
begnadet oder – verdammt sind.
Aber nicht nur das, was wir gegenwärtig
sind, wird uns durch das von uns zu durch-
lebende Zeitalter schonungslos vor die Augen
gerückt. Das grelle Licht, in dem wir uns
dastehen sehen, fällt auch nach rückwärts
auf den Werdegang der in diesen Endzu-
stand einmündet. Vom Ziel her erhellt sich
die Führung des Weges, der in ihm termi-
niert.
Es muss festgestellt werden, dass die Be-
trachtungsweise, der damit das Wort geredet
3
wird, vielfältigem Widerspruch begegnet.
Man sie „teleologisch“ und meint
sie durch die in umgekehrter Richtung ver-
laufende, die kausal-genetische, ersetzen
zu sollen. Aber alle Einwände, die einer
vom Ziel her nach rückwärts gehenden Be-
trachtung gelten, sind nur dann berechtigt,
wenn dies Ziel als eine um seiner Herrlich-
keit willen zu preisendes hingestellt wird
wenn demgemäss die zu ihm hinführende
Bewegung als hererhebender Aufstieg,
als „Fortschritt“, womöglich als ein durch ge-
heimnisvolle Lenkung erwirkter Fortschritt
interpretiert wird. Eine solche Telologie
ist wirklich nichts Anderes als eine philo-
sophische verbrämte Mythologie.
Aber von einer so optimistisch-enthusi-
astischen Teleologie ist hier nicht die Rede. Ob
das, was für uns der der Gesamt-
bewegung ist, zu preisen oder zu beklagen ist:
das ist eine Frage, die diese unsere „Teleolo-
gie“ keineswegs in positven Sinne beantwor-
tet. Was ihr zu Grunde liegt, das ist nur
die Überzeugung: Was in den Anfängen und
Ursprüngen einer Entwicklung an Möglich-
keiten und Anreizen enthalten war, das
4
können wir erst wissen, wenn die Entwicklung
Wirklichkeit geworden ist und zu bestimm-
ten charakteristischen Ergebnissen geführt
hat. Was in der knospe an Möglichkeiten und
Wachstumsreizen enthalten ist, das kön-
nen wir erst wissen, wenn wir die Beute und
die Frucht kennen, die aus ihr hervorgegangen
sind. So lange dies nicht der Fall ist, tap-
in der
pen wir hinsichtlich der durch die Knospe
vorliegenden Potentialität im Dunkeln.
Also nur in diesem Sinne will der
Satz verstanden werden, dass die Entwick-
lungsphase, bei der wir heute angelangt sind,
dieser nach der Zukunft hin noch offene Stand
der Gesamtbewegung, eine erhellende
Kraft hat, die auch der hinter uns liegenden
Menschheitsentwicklung zu gute kommt.
Wir sehen, wie heute die letzten Konsequenzen
aus dem gezogen werden, was die vorausge-
gangenen Geschlechter noch ein in die Zukunft
sich vortastendes Vermuten, Versuchen, Wagen
kannten. Wir sind diejenigen, die aus dem
vor und nach Unternommenen die Summe
zu ziehen haben.
Das gilt auch und besonders hinsichtlich
des Problems der Freiheit. Und zwar wird un-
5
bedenklich gesagt werden dürfen, dass dies Pro-
blem nicht bloss eine unter den vielen
Fragen ist, die das Zeitalter uns aufdrängt –
nein, dass in ihm die Gesamtproblematik
der Epoche sich wie in der Nuss zusammen-
drängt.
Wenn wir von Freiheitsbeschränkung und
Freiheitsunterdrückung hören, dann ist es
uns selbstverständlich, zunächst an solche
Aktionen zu denken, in denen der Mensch
von aussen her, also durch den Zugriff von Mit-
menschen, in seiner Freiheit beschränkt oder
seiner freiheit beraubt wird. Nun würde
die so sich bildende Sachlage von einer
durchsichtigen und leicht zu beurteilenden
Art sein, wenn alle Freiheitsbeschränkungen,
die tatsächlich vorkommen, von gleicher Art
wären und folglich gleich zu beurteilen wä-
ren. Denn dann ständen Freiheit und Freiheits-
beraubung sich als klar geschiedene Anti-
thesen gegenüber. Und versteht sich von
selbst, dass alsdann der positive Wertakzent
ausschliesslich auf die Seite der Freiheit
und der negative Wertakzent ausschliesslich
auf die Seite der Freiheitberaubung fallen
würde.
Allein wie falsch eine solche Deutung und
Bewertung sein würde, das ins Licht zu rücken
6
ist nichts so geeignet wie der Vergleich der
menschlichen Lebensverfassung mit der
Verfassung gewisser tierischer Gemeinschaften,
die in die nächste Nähe der Menschenwelt
zu rücken man vielfach keine Bedenken
getragen hat. Die Annäherung spricht sich
schon in der Benennung aus. Man redet in
aller Unbefangenheit von „Tierstaaten“.
scheut sich sogar nicht, sie den Menschen-
staaten als Muster u. Vorbild vor Augen zu
halten. In Wahrheit sind diese Tierstaaten
gerade durch das lehrreich, was sie von den
Menschenstaaten unterscheidet. Ihre muster-
hafte Ordnung beruht auf den unablenkbaren
Instinkten, durch welche die
jedes tierische Individuum dirigiert. Es ist
eine aus d. Hand der Natur empfangene
und durch die Natur aufrechterhaltene Ord-
nung, der die Gesamtheit der tierischen In-
dividuen gehorcht. Und das heisst: sie
sind in einem Zustand der wissenlosen
Getriebenheit, der sie als unfrei kennzeichnet.
Wenn bei uns das Problem der Freiheit erörtert
wird, dann pflegt amn sie als das Gegenteil
jener kausalen Determiniertheit zu kenn-
zeichnen, die sich in den Gesetzen der anorganischen
Natur ausspricht. Aber viel lehr- und auf-
schlussreicher ist die Entgegensetzung der Frei-
7
heit zu jener Unfreiheit, die in der Instinkt-
gebundenheit des Tiers zu tage tritt. Gerade
weil das im Tier vorliegende organische Leben
uns so viel näher steht als der des Lebens
entbehrende Stein, gerade weil die tierischen
menschlichen Lebensord-
Lebensordnungen den durch den Menschen
nungen äusserlich so nahe stehen – gerade
deshalb ist der Gegensatz der hier vorliegen-
den Unfreiheit zur menschlichen Freiheit
so viel lehrreicher. Der Gegensatz hebt sich
von der Gemeinsamkeit des dort und des
hier waltenden Lebens in besonderer Klar-
heit ab.
Was aber ist dasjenige, was der Vergleich
dieser beiden Lebenskreise uns lehrt? Er
lehrt uns, dass im Unterschied vom Tier
der Mensch seine Lebensordnung nicht fertig aus
der Hand sie einer Natur empfängt, die ihn
durch eingeborene Instinkte in dieser Ord-
nung festhält und am Ausbrechen dieser
Ordnung hindert, sondern diese Ordnung sich
selbst zu geben hat.
Frage: ist das, wodurch sich demgemäss
der Mensch hier vom Tier unterscheidet, ein
Sachverhalt, um dessen willen er sich
glücklich zu preisen oder um dessen willen er
zu beklagen ist? Manche anthropologische
8
Erörterungen der jüngsten Zeit scheinen das
Letztere nahe zu legen. Wenn man, wie etwa
A. Gehlen es tut, den Menschen im Vergleich
zum Tier als das „Mängelwesen“ bezeichnet,
so fasst man ihn als den gegenüber dem
Tier Benachteiligten auf. Worin aber besteht
die Benachteiligung? Im Fehlen eben jener
Instinkte, durch welche das Tier so unfehlbar
in der Bahn des Gattungslebens festgehalten
wird. Und trift es nicht zu, dass diese Bevor-
zugung gerade in dem Walten jener Instinkte
besonders schlagend hervortritt, durch welche
die tierischen verbände, zumal die sog. „Tier-
staaten“, zusammengeführt und zusam-
mengehalten werden? Muss uns nicht wirk-
lich ein tiefer Neid erfassen, wenn wir die
Vollkommenheit und Reibungslosigkeit, mit
der im Tierstaat die Verhaltensweisen aufein-
ander abgestimmt und die Teileistungen
koordiniert sind, zusammenhalten mit
den endlosen Zwistigekiten, Zusammenstössen,
Krisen und Katastrophen, in die wir den Men-
schen gerade dann verwickelt finden, wenn
er darauf ausgeht, menschliche Lebensord-
nungen zu schaffen, auszubauen, zu erhalten
und zu erweitern? Erweist er sich in diesem
tumultuösen Geschehen nicht wirklich als
9
als das „Mängelwesen“. ?
Es sind das Erwägungen, von denen nachdenk-
liche Menschen im Blick auf das Tohuwabo-
hu des menschlichen Daseins seitje heim-
gesucht worden sind. Heute haben die einschlä-
gigen Verhältnisse sich zu einem Extrem
vorgearbeitet, das sie jedem Erdenbürger, der
nicht an sträflicher Gedankenlosigkeit leidet,
unumgehbar macht. Die Gesamtlage und
die Selbstbedrohung des „Atomzeitalters“. Die
Menschheit als Ganzes vor der Frage „Sein oder
Nichtsein“. Die Möglichkeit der totalen Selbst-
vernichtung. Nie hat das „Mängelwesen“
seine Mangelhaftigkeit so gründlich zu
spüren bekommen.
Aber sollen wir wirklich das Tier um seine
Instinktgebundenheit = Unfreiheit benei-
den? Wenn wir es täten, so käme das dem
sein
Wunsche gleich, von unserem Menschen
erlöst und in die Dumpfheit des tierischen
Daseins zurückversetzt zu werden. Ein Wunsch,
der unwiderlegbar wäre – aber auch ein
Wunsch, der uns Ehre machte? Es ist das Ver-
langen nach dem Glück der wiederkäuenden
Kuh.
Was es mit der Mangelhaftigkeit des Men-
schenwesens auf sich hat, darüber haben uns
die Forschungen Adolf Portmanns gründ-
10
lich aufgeklärt. Sie haben uns gezeigt, dass
alles das, wodurch der Mensch, biologisch ge-
sehen, hinter dem Tier zurückbleibt, notwen-
dige Bedingung dessen ist, was den Men-
schen zum Menschen macht, angefangen mit
seiner, biologisch gesehen, zu frühen Geburt.
Durch den angeblichen Mangel wird der Raum
freigehalten, in dem der Mensch sich muss
bewegen können, um wahrhaft Mensch zu
werden. Nicht so ist es, dass er, weil er miss-
licher Weise am Instinkt entbehren muss, sich
um Ersatzleistungen bemühen muss, die für
das ihm Fehlende eintreten – es verhält
sich vielmehr so, dass er aus der Gängelung
durch den Instinkt entlassen sein muss um
der werden zu können, der er zu sein bestimmt
ist, nämlich der Träger der – Freiheit. Der
vorgebliche Mangel ist die Auszeichnung des
„Freigelassenen der Schöpfung“.
Allerdings belehrt uns der Vergleich mit
den tierischen Verbänden auch über Art und
Höhe des Preises, den der Mensch für seine
dafür zahlen muss, dass er sich selbst anheim-
gegeben ist, dass er den Auftrag hat, sich selbst
seine Lebensordnung zu schaffen. Alle jene
menschlichen Irrgen und Wirrgen, die
in unserer Gegenwart ihren Gipfel erreicht
11
haben, sind der Beleg dafür, das frei sein
so viel heisst wie ein Wesen sein, das durch
diese seine Freiheit sich selbst und sein
Geschlecht so gut zu erhöhen wie zu er-
niedrigen, so gut zu beglücken wie zu
vernichten in den Stand gesetzt ist. Die Zwie-
gesichtigkeit, die Ambivalenz der Freiheit.
Der Kant der „Religion i. d. Gr. d. u. V.“
gegen den Kant der „Kr. d. pr. V.“ Die „Ver-
hehrung“, „Pervertierung“. Heute sonnenklar.
Die Demaskierung des Menschen ist voll-
endet.
Unsere besondere Frage: wie zeigt sich
die Ambivalenz der Freiheit in dem Verhält-
nis zwischen dem Menschen und den ihn
umfassenden Lebensordnungen?
Sie zeigt sich zunächst dahin, dass die
Freiheit die Freiheitsbeschränkung nicht als
ihr ausschliessliches Gegenteil sich gegen-
über hat, sondern in einer noch näher zu
bestimmenden Weise in sich schliesst. Es
gilt Wesen a eine Ordnung zwischen solchen
Wesen herzustellen, die „frei“ sind in dem Sinne,
dass sich in ihrem Verhältnis zur Welt nicht
durch feste Instinkte, sondern durch Einsicht
und Wille bestimmt werden. Einsicht hat
zur Kehrseite den möglichen Irrtum, der
Wille schliesst in sich die Divergenz der Wil-
12
lensrichtungen, die ihrerseits so gut Divergenz
der Ideen wie Divergenz der Interessen sein
kann; sie schliesst obendrein in sich den
Gegensatz der positivwertigen und der negativ-
wertigen Willensrichtungen. Schon die erstge-
nannte Divergenz würde genügen, um Frei-
heitseinschränkungen unumgänglich zu ma-
chen. Die zweitgenannten drängen erst recht
in diese Richtung. Kurzum: gilt es eine
Ordnung zu schaffen aus Wesen, die nicht
instinktgegängelt, sondern frei sind, dann
kann es nicht anders sein, als dass diese
Wesen irgend welche Freiheitsbeschränkungen
auf sich nehmen müssen.
In welcher Gestalt aber treten diese Frei-
heitsbeschränkungen auf? Wir sind zunächst
geneigt, sie uns als von aussen oder oben
her diktiert bzw. herbeigeführt vorzustel-
len. Aber das ist eine unzulässige Verein-
fachung. Man muss differenzieren? Die
Notwendigkeit und Richtung der Differenzie-
rung aber leuchtet dann erst so recht ein,
wenn wir noch einmal die menschlichen Ge-
meinschaftsbildung mit den „Tierstaa-
ten“ vergleichen. Denn für den Tierstaat ist
gerade die bezeichnend, das er der aufzu-
zeigenden Differenzierung entbehrt. Der
„Tierstaat“ vereinigt zweierlei in sich: er
ist in einem Lebensordnung (i. e. S.) und
Arbeitsordnung. Der Instinkt führt die In-
viduen zusammen, und er führt sie zu Leis-
tungen und durch Leistungen zusammen. Siehe
den Bienenstaat! Der Honig ist nicht ein
Produkt, das nach Herstellung der Einheit in
einen neuen Anlauf hergestellt würde; er stellt
sich im Gemeinschaftsleben sozusagen von selbst
her, und der Lebens-
13
ablauf würde nicht der sein, der er ist, wenn
er nicht aus sich dies Produkt hervorbrächte.
Die Menschengemeinschaft aber, als eine
Gemeinschaft freies Wesen, ist von vorne herein
genötigt, beides auseinandertreten zu lassen.
Lebensordnung und Arbeitsordnung kommen
in gesonderten Anläufen zustande. Warum,
ist offensichtlich. Weil die Lebensgemein-
schaft nicht von Natur schon „da“ ist, muss
sie in eigens darauf gerichteten Bemü-
hungen erst hergestellt werden, und sie
muss bereits hergestellt sein, damit dann
im Rahmen und auf dem Boden einer
geordneten Welt, durgegangen werden
könne, auch die gemeinsame Arbeit in
eine Ordnungsform brinden zu können.
Uns Heutigen ist diese Differenzierung so
selbstverständlich, weil wir sie in letzter
Perfektion (s. o.) vor Augen haben. Hier
kann man einmal so recht sehen, wie wir,
die am (relativen) Abschluss Angelangten, den
zu diesem Abschluss hinführenden Werdegang
besser verstehen und interpretieren können als
die in seinem Fortgang Begriffenen. Uns
Heutigen steht die Herausdifferenzierung und
Verselbständigung der Arbeitsordnung so
14
klar vor Augen, weil das System der gemein-
sam zu leistenden Arbeit sich zu einer unü-
berbietbaren klaren Profilierung durchgearbeitet
hat. Paradigmatisch in jenem Arbeitsge-
füge, das durch das Ineinandergreifen von
Naturwissenschaft, Technik und Industrie
seine Gestalt gewonnen hat. Worauf be-
ruht seine Perfektion, worauf die mit
dieser Perfektion mitgegebene Selbstän-
digkeit? Sie beruht darauf, dass dieses
ganze Arbeitsgefüge, und zwar sowohl
in seinen theoretischen Grundlagen als
auch in seiner praktischen Ausgestaltung,
ausschließlich das Werk der ratio, des
rechnenden planenden, disponierenden
Verstandes ist. Dabei ist die Selbstabschlies-
sung dieses Arbeitssystems nicht etwa der
Erfolg einer nach aussen gerichteten Abwehr-
aktion: sie macht sich von selbst, weil je-
der von aussen kommende Eingriff seinen
Ablauf stören, wo nicht unterbinden, mit-
hin den Menschen um den von ihm erwar-
teten Arbeitseffekt betrügen. Es ist das deut-
bar allgemeinste Interesse, das dieses Ar-
beitssystem seinen eigenen Gesetzen und
nicht von aussen kommenden Anweisungen
15
gehorcht. Daher die radikale Verselbstän-
digung dieses Arbeitssystems.
Weil dies System in Anlage und Durch-
führung ausschliesslich das Werk der ratio
ist, darum ist es für uns das unerreichte
Paradigma jenes Prozesses, den wir die
„Rationalisierung“ nennen. Grundlage ist
die rationale Wissenschaft par excellence,
die mathematische Naturwissenschaft so wie
die mit ihr schlechthin solidarische Pra-
xis, genannt Technik. Ausführung ist jene
gleichfalls Organisation der
Arbeit, die sich in Gestalt der industriellen
Produktion verwirklicht. Dies System ist
wirklich die überwältigende Darstellung
der ratio triumphuus.
Vorbildlichkeit dieses Paradigmas auch
für die anderen Lebensbereiche. Arbeitszer-
legung und –zusammensetzung. Der
„Betrieb“. Das „team-work“. An allen Ecken
und Enden.
Aber nun unsere Freihei Frage: was wird
innerhalb dieser total rationalisierten Ar-
beitsordnung aus der Freiheit des Menschen.
Glaube der Aufklärung: Fortschreiten der
ratio = Fortschreiten der Humanität. Voll-
endung der Rationalisierung = Triumph der
16
Humanität. Ist dieser Glaube im Recht, dann
muss sich innerhalb des rationalen Arbeits-
systems, ja durch das rationale Arbeitssystem
die Freiheit des Menschen vollenden!
Seitdem die Aufklärung sich an diesem
Glauben begeistert hat, ist der Prozess der
Rationalisierung unauf haltsam und in
ständig sich steigendem Tempo fortgeschrit-
ten. Wir sehen ihn auf einem Kulmina-
tionspunkt angelangt. Wir können also
sehen, ob die aufklärung mit ihrer Zuver-
sicht Recht gehabt hat.
Wie unsere antwort ausfallen muss, ist
kaum zweifelhaft. Das Werk der menschlichen
ratio ist uns Kraft der ihm innewohnenden
Logik „über den Kopf gewachsen.“ Die Klagen
über die Herrschaft des „Apparats“, über den
Prozess der „Mechanisierung“, „Kollektivierung“,
„Standardisierung“ – über das Los des „Funk-
tionärs“, des „Roboters“. Die durch die ratio
bewirkte Verselbständigung des Arbeitssystems
ist nur Herrschaft dieses Systems über den
ihm eingeordneten Menschen geworden.
Was ist das Merkwürdige an dieser Ein-
schränkung der Freiheit, die von vielen Kultur-
kritikern als Vernichtung der Freiheit ange-
sehen wird? Sie ist nicht von aussen her
17
über den Menschen gekommen, denn die
ratio, die sie bewirkt hat, hat im Menschen
selbst Sitz u. Ursprung. Sie ist aber auch
nicht Folge eines Fehltritts, denn die ratio
ist nicht nur eine legitime Funktion des
Menschen, sie ist ihm auch in seiner Selbst-
behauptung unentbehrlich.
Wie aber ist es dann zu erklären, das eine
im Menschen selbst heimische völlig legi-
time Funktion – Unfreiheit des Menschen
bewirken kann?
ratio ist Erhebung über die Individua-
lität aus den Kräften eben der Individuali-
tät. das „reine“ Denken! Absinken alles
Nicht-Allgemeine. Berechtigter Triumph
des diesen Aufstieg vollziehenden Menschen-
geistes. Aber nicht die Kehrseite vergessen:
das, was absinkt, ist zwar auch, aber nicht
nur das Allzu-menschliche – es ist auch
das den Menschen - z,B. die Moti-
ve, die jenen Aufstieg in Gang bringen! Tri-
umph der Ratio ist Selbst- Entindividua-
lisierung. In der reinen Theorie zu ertragen.
Aber bei Übertragen in die Lebenspraxis kann
es zu einem Druck auf das individuelle
Selbst führen, der als verlust des personalen
Seins beklagt wird. Je mehr die rationale
Arbeitsordnung sich perfektioniert, um so
18
mehr fühlt sich d. Mensch in seiner Frei-
heit beeinträchtigt.
Und doch ist das auf ihn drückende Ganze
ein Werk der ratio und damit ein Werk der –
Freiheit. also: Freiheitsbeschränkung als
Werk der sich betätigenden Freiheit! Hier
ist nirgend Druck, Zwang, Knechtung – hier
herrscht nur eins: das Gebot der durch die
ratio enthüllten „Sache“.
Ganz anders das Bild, wenn wir
nun von der verselbständigten Arbeits-
ordnung hinübergehen zu dem, was ich „Lebens-
ordnung“ (i. c. S.) nannte.
Zunächst ist dies festzustellen: die ratio-
nale Arbeitsordnung könnte nicht entste-
hen, sich entwickeln, sich zu der Vollkom-
menheit ausgestalten, in der sie uns vor
Augen steht, wenn nicht die Gesamtheit de-
rer, die innerhalb dieser Ordnung tätig sind,
vor solchen Störungen und Widerständen
geschützt >wäre>, die ihnen die Arbeit an der
Sache unmöglich machen würden. Das Funk-
tionieren der Arbeitsordnung hat zur notwe-
digen Voraussetzung das Bestehen einer Le-
bensordnung, durch welche dem Bereich der
Arbeit eine ungestörte Arbeitsmöglichkeit
19
garantiert wird. Funktionaler Zusammen-
hang von Arbeitsordnung und Lebensord-
nung.
Was aber ist dasjenige, was sub specie
der Freiheitsfrage die Lebensordnung am tief-
sten von der Arbeitsordnung unterscheidet?
Das, was in der Arbeitsordnung dirigiert, das
ist das Gebot der Sache. Die Sache zu ermitteln
und zur Herrschaft zu bringen ist der Auftrag
der ratio. Die ratio setzt sich vollkommen
gewaltlos durch: nur durch die Einsicht in die
durch sie enthüllten Sachzusammenhänge.
Daher: Logik der Sache.
Die Lebensordnung aber: gehorcht etwa auch
sie der selbstevidenten Logik eines durch die
ratio enthüllten Sachzusammenhangs?
Davon kann einfach keine Rede sein, weil
das Leben der Gemeinschaft zwar u.a. auch
die Betätigung der ratio in sich schliesst,
aber mit ihr zusammen auch das Ganze
der individuell bedingten, also nicht der
ratio weichenden Meinungen, Strebungen, Über-
zeugungen, Bekenntnisse in sich befasst, mit
denen die ratio zusammengeschaut wer-
den muss, damit der ganze Mensch und
nicht ein rationaler sichtbar
werde. Damit aus diesem Miteinder, Für-
20
einander, Gegeneinander eine wirkliche Lebens-
ordnung werde, bedarf es genau desjenigen,
was im Herrschaftsbereich der ratio überflüssig
ist: der Zwangsgewalt, die überall da einge-
setzt werden muss, wo der Widerstreit indi-
vidende bedingter Strebungen die Ordnung
zu zerstören droht. Und zwar bedarf es des
Einsatzes oder wenigstens der Androhung
dieser Zwangsgewalt nicht bloss gegen die
Rechtsbrecher, nicht blos gegen die im Eigen-
interesse Befangenen: es bedarf ihrer auch
gegenüber denen, die vielleicht aus sehr ide-
ellen Motiven der herrschenden Ordnung den
Gehorsam verweigern. Träger dieser Zwangs-
gewalt in legalem Sinne zu sein: das ist
dasjenige, was den Staat, diese „Instanz der
letzten Entscheidung“, als solchen kennzeichnet.
Hier also begegnet uns diejenige Freiheit-
beschränkung, die durch Einsatz physischer
Gewalt bewirkt wird – eine Freiheitsbeschrän-
kung die wesentlich schmerzhafter empfun-
den wird als diejenige durch die rationale Ar-
beitsordnung. Siehe den funktionalen Zusam-
menhang: die rational begründete und
daher gewaltlose Arbeitsordnung ist nur möglich
durch das Bestehen der die Ruhe garantierenden,
21
aber eben deshalb der möglichen Gewalt-
annäherung bedürfenden Lebensordnung i. e.
S.
Wie naheliegend ist da der Gedanke: wie
viel schön wäre doch das menschl. Leben, wenn
nicht nur die Arbeitsordnung, sondern auch
die Lebensordnung durch die Gebote einer ratio
bestimmt würde, die durch ihre Evidenz die
Gewalt ebenso überflüssig machte, wie es die
die Arbeitsordnung bestimmende ratio tat-
sächlich tut! Die alte und niemals
verschwindende Hoffnung der Aufklä-
rung: je mehr sich d. Staat an die Ge-
bote der ratio hält, um so mehr wird durch
die ihr Evidenz der Zwist der
Meinungen ausgelöscht, der Zustand wider
die Ordnung zum Verschwinden gebracht,
mithin auch in d. Lebensordnung, im
Staat, die Anwendung der physischen Ge-
walt überflüssig gemacht werden. An
die Stelle des funktionalen Zusammenhangs
würde die Identität der einen und einzigen
Vernunftordnung treten.
Wir heute Lebenden sind in der ungewöhn-
lich glücklichen Lage, dass wir es nicht nö-
tig haben, uns darüber den Kopf zu zerbre-
chen, ob eine solche totale Rationali-
22
sierung auch der Lebensordnung i. E. S.
möglich wäre und welche Folgen der Ver-
such, den Staat total zu rationalisieren,
haben müsste. Vor unser aller Augen
vollzieht sich ein weltgeschichtliches Ex-
periment, das seinem prinzipiellen Cha-
rakter nach nichts Geringeres bedeutet, als
die den Versuch, auch die Wirklichkeit der
staatl. Lebensordnung total zu rationali-
sieren, und zwar mit der ausdrücklichen Ver-
heissung, dass in der Durchführung dieses Ex-
periments die staatliche Zwangsgewalt sich
selbst mehr und mehr überflüssig ma-
chen werde, weil an ihre Stelle die Evidenz
der allbeherrschenden ratio treten werde.
Ein faszinierendes Experiment! Wieder-
aufnahme des Programms der Aufklä-
rung.
Das Experiment wird durchgeführt durch
den Kommunismus. Der Staat der konstruiert
ratio
ist nach den Anweisungen „der“ Wissenschaft,
der alleingültigen Wissenschaft des dialekti-
schen Materialismus. Der Staat, der durch
diese Wissenschaft als der allein richtige, weil
durch die Dialektik der Geschichte geforderte,
erwiesen wird. Der Staat, der, weil er mit d.
Vernunft in vollkommenem Einklang steht,
23
nicht nur die universale Herrschaft errin-
gen, sondern auch die ihn Angehörigen zu
vollkommen Tugend und Glückseeligkeit
emporheben wird, mit dem Effekt, dass in
dem Paradies der „klassenlosen Gesellschaft“
die Staatsgewalt (Gericht, Polizei, Armee)
vollkommen überflüssig sein wird. Der Paral-
lelismus mit der rational-gewaltlosen
Arbeitsordnung ist evident. Er wird noch
deutlicher, wenn die den Staat dirigierende
wissenschaftliche ratio als bezeichnet
wird, die durch Aufdeckung der „Naturgesetze
der Gesellschaft“ den notwendigen Gang der
Entwicklung evident mache. Wie die
Technik die Naturgesetze der Natur in
rational begründete Praxis umsetzt, so
die politische Ingeneuweisheit des Kommu-
nismus die Naturgesetze der Gesellschaft.
Und was lehrt der Ausfall dieses Experi-
ments? Die Gewalt, die angeblich durch
die rationale Evidenz der Gesellschaftswissenschaft
überflüssig gemacht werden soll, ist in
Wahrheit obenauf. Und das ist nicht
begründet in dem Charakter der Macht-
haber, sondern in der Natur eines politischen
Systems, das behauptet, das ganze Leben
der Gesellschaft rationalisieren zu können.
Eine unausweichliche Konsequenz!
24
Wieso ist das der Fall?
Es genügt zur Antwort, wenn wir erken-
nen, dass die Bedingungen, durch die es
möglich wird, dass in der Herstellung der
Arbeitsordnung die ratio durch ihre Evidenz
jeden Eingriff der Gewalt überflüssig macht,
sich dann in ihr Gegenteil verkehren, wenn
es um die Herstellung und Sicherung der Le-
bensordnung i. e. S. geht.
<...eiches> Muster der Arbeitsordnung
ist das Arbeitsgefüge der industriellen Pro-
duktion. Sein Fundament ist die rationale
Wissenschaft von der Natur, die math. Natur-
wissenschaft. Ihre Erfolge beruhen darauf, dass
in ihr das denkende „Subjekt“ sich die zu den-
kende Natur als das „Objekt“ entgegen-setzt.
Das Lebendigste par excellance, das sich
Mensch nennt, setzt sich das Un-lebendige
als das zu Berechende und zu Verwertende
entgegen. „Person“ u. „Sache“. Der Sache ist diese
Behandlung angemessen, weil sie „un-selb.
stisch“ ist. Die Rückführung auf Naturgesetze
ist die ihr angemessene Form der „Versachli-
chung“.
Wie aber steht es dann, wenn die ratio sich
anschickt, die Menschenwelt zu „rationali-
25
sieren“?
Hier hat es nicht die Person mit der Sache,
das Selbst mit dem Unselbstischen zu tun:
hier begegnet der Mensch seines gleichen.
Es ist seine eigene Welt, die er zu ordnen
unternimmt. Diese Ordnung ist nur dann
eine wahrhaft menschliche Ordnung, wenn
sie die Selbstheit der zu ordnenden Wesen
respektiert. Das heisst aber: wenn sie sich
strengstens verbietet, sie theoretisch und prak-
tisch in Sachen zu verwandeln. Genau dies
ist es aber, was die begründende „Wissenschaft“
schon durch ihre logische Form unternimmt.
Die unter die naturgesetzliche Notwendigkeit
subsumierte Person ist die ihrer Selbstheit be-
raubte, die in eihe Sache verwandelte Per-
son. Die unbedingte Einordnung in das natur-
gesetzlich determinierte „Kollektiv“ ist die
schon auf dem Boden der Theorie anhebende
Vergewaltigung des Menschen als Menschen.
So ist schon in der tragenden Doktrin der
Entwurf einer Lebensordnung mitgegeben,
die im Namen der ratio den Menschen dazu
verurteilt, seine Selbstheit an eine übergrei-
fende Notwendigkeit dahingeben. Alles,
was ihm als Individuum zu eigen ist,
muss sich die Annullierung gefallen lassen.
Die allbekannte Praxis des Kommunis.
26
ist (im Sinne der komm. Verhältnisbestim-
mung von Theorie und Praxis) nichts weiter
als die Exekutierung des in d. Theorie Vor-
gezeichneten. Der komm. Staat kann garnicht
anders als die faktisch vorhandene Viel-
heit von Meinungen, Strebungen, Bekenntnissen
u. Programmen zu gunsten der von ihm als
„rationale“ <....nisierten> Doktrin mit al-
len Mitteln unterdrücken. Die Vergewalti-
gung setzt ein mit der Austilgung der mit
der Doktrin nicht konformen Lehrmeinungen.
Und durch die so monopolisierte Doktrin
wird dann der Kommunismus nicht nur be-
vollmächtigt, sondern geradezu verpflichtet, alles
im Menschen auszulöschen, was sich gegen das
Aufgehen im ommunistisch interpretierten
und organisierten „Kollektiv“ widersetzt. Denn
nur auf diese Weise kann die Person im
Menschen so zur Sache herabgedrückt werden,
dass sie die durch die angebliche ratio ver-
ordnete Behandlung ohne Widerspruch über
sich ergehen lässt. Die unter
die naturgesetzliche Notwendigkeit, die
der unlebendigen Sache angemessen ist,
wird hier in der Weise praktiziert, dass einem
jeden der zu Subsumierenden die Überzeu-
27
gung eingebläut wird, diese Subsumierung
sei genau diejenige Behandlung, die durch die
ratio der Wissenschaft als angemessen, ja
als strengstens geboten erwiesen werde. Er
wird nicht nur subsumiert, er weiss auch
dass und weshalb er subsumiert werden
soll.
Dies die Konsequenzen, in die der Versuch
einer totalen Tationalisierung der Lebensord-
nung notwendig einmündet. Durch den
Kommunismus werden sie uns vorexerziert.
Der versuch, durch Inthonisierung der
ratio das menschl. Leben von aller Ge-
waltausübung zu befreien, schlägt um in
vertausendfachte Anwendung der Gewalt, weil
nur durch sie das gemeinsame Leben in
die gewünschte Form gezwängt werden kann.
Ergebnis: die funktionale Verbindung
verschiedener Lebensphären darf nie durch
den Versuch der Gleichschaltung zerstört
werden!
Wenn wir aber der staatl. Lebensordnung
respektieren, dann stellt sich in ihm selbst
ein beachtlicher Widerspruch. Die Tendenz
zur Rationalisierung ist innerhalb seiner
selbst als Organisation der Verwaltung in
28
unaufhaltsamen Vordrängen (s. o.: aus
Vorbild der industriellen Produktion). das
heisst: derselbe Staat, der als ganzes der
Versuchung der totalen Rationalisierung Wider-
stand leisten muss, kann nicht anders als
ihr in seinen Innengliedern <..> kräftigen
Vorschub leisten. Wie muss die Gesamt-
verfassung des Staates aussehen, damit er
nicht den ihm innewohnenden Rationa-
lisiergstendezen zum Opfer falle?
Antwirt wieder im Blick auf das Gegen-
bild des kommunistischen Staates: Demo-
kratie als Verneinung der totalen Rationa-
lisierung. Gegen die monolithische Geschlos-
senheit der kanonisierten Staatsdoktrin das
Miteinander, Füreinander, Gegeneinan-
der der Überzeugungen u. Gruppen, nicht als
leider hinzunehmende Tatsache, sondern als
Prinzip. Jede dogmatische Verhärtung
verneint. Alle Schattenseiten der Demo-
kratie, von ihren Verächtern gründlich ge-
schmäht, gehören zu dieser gewollten
Polyphonie hinzu. Eine perfekte Demo-
kratie wäre der Widerspruch gegen sich
selbst, sie wäre des (schein-)
perfekten totalitären Staates. Ewige Selbst-
korrektur ist ihr Wesen. |