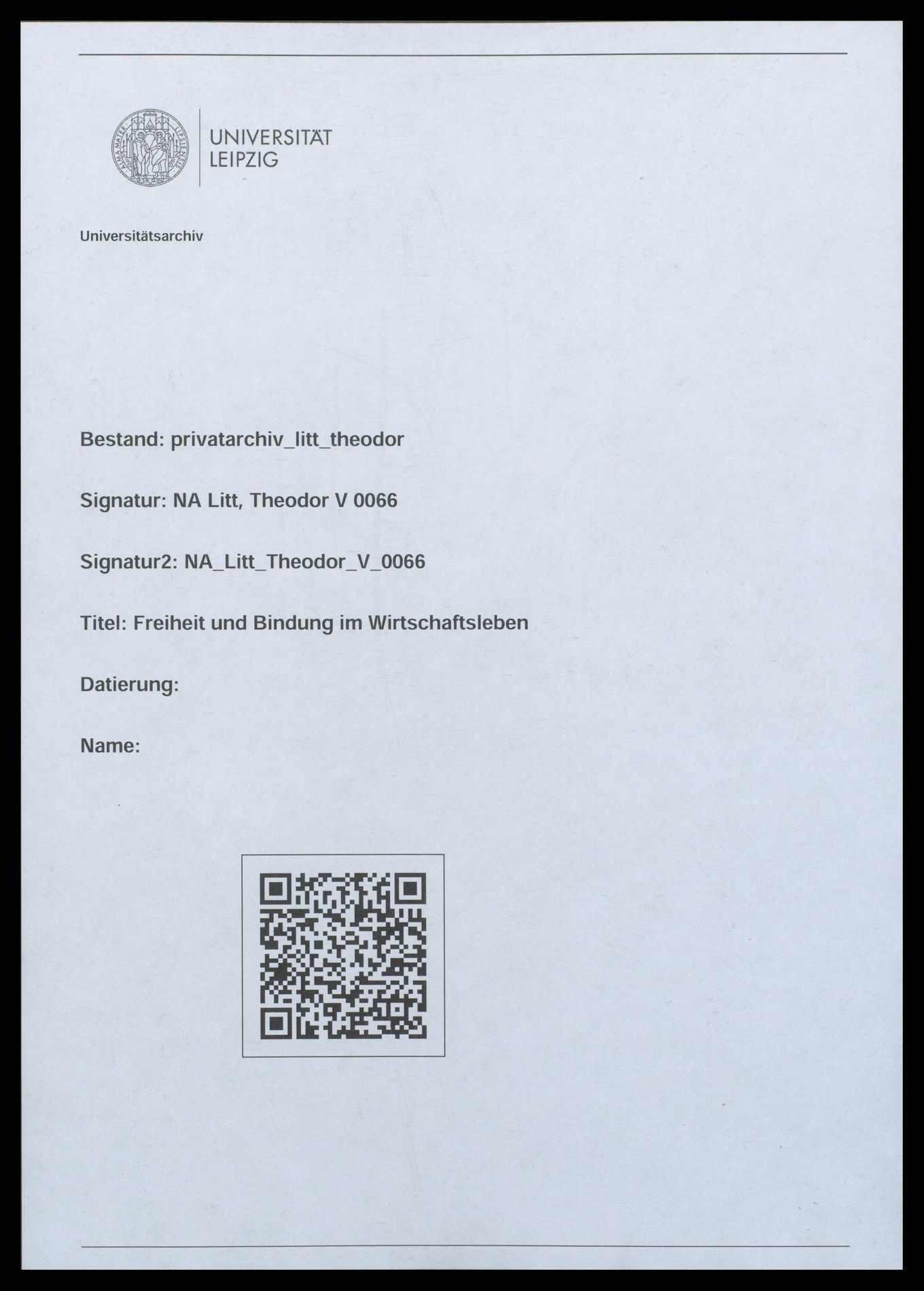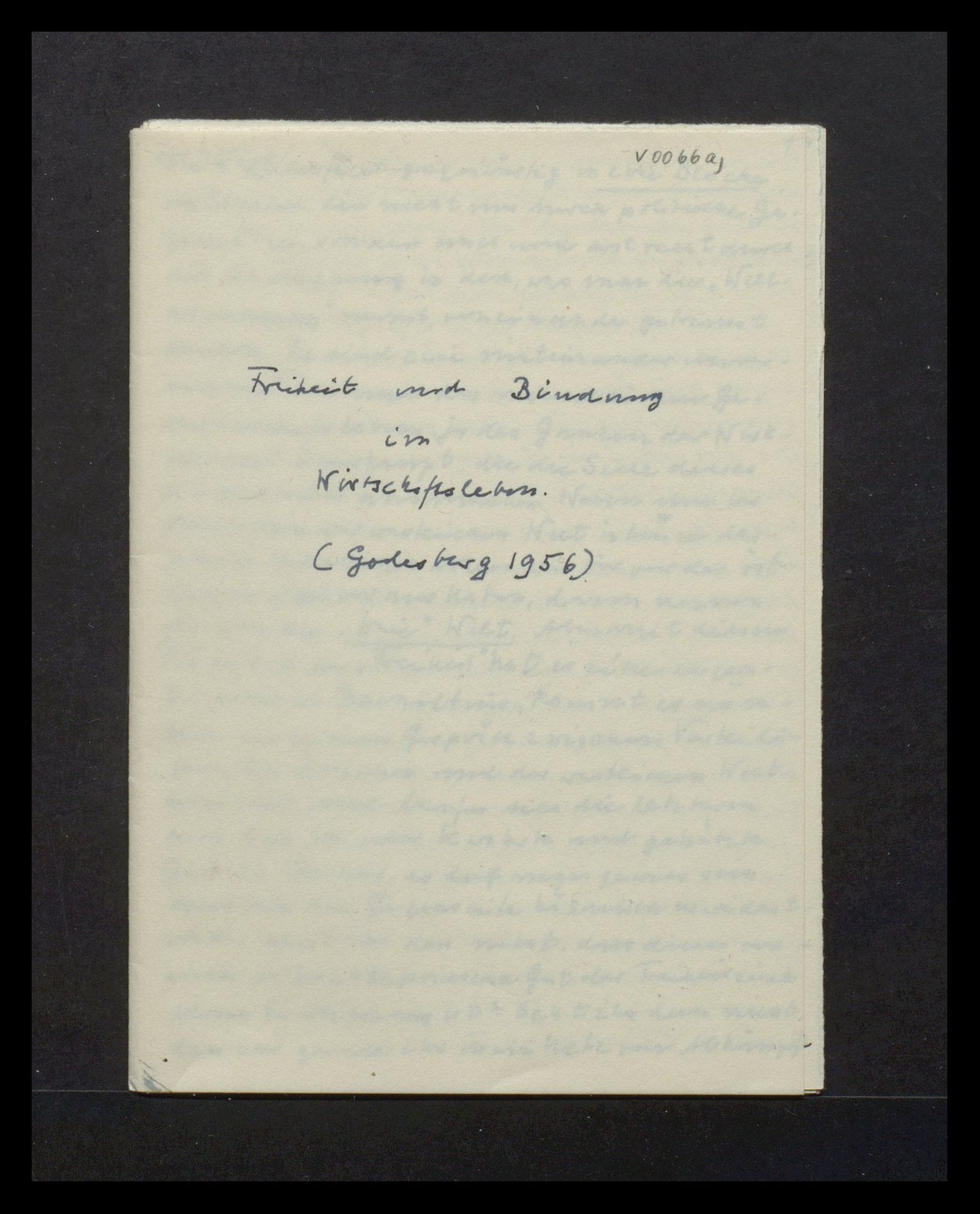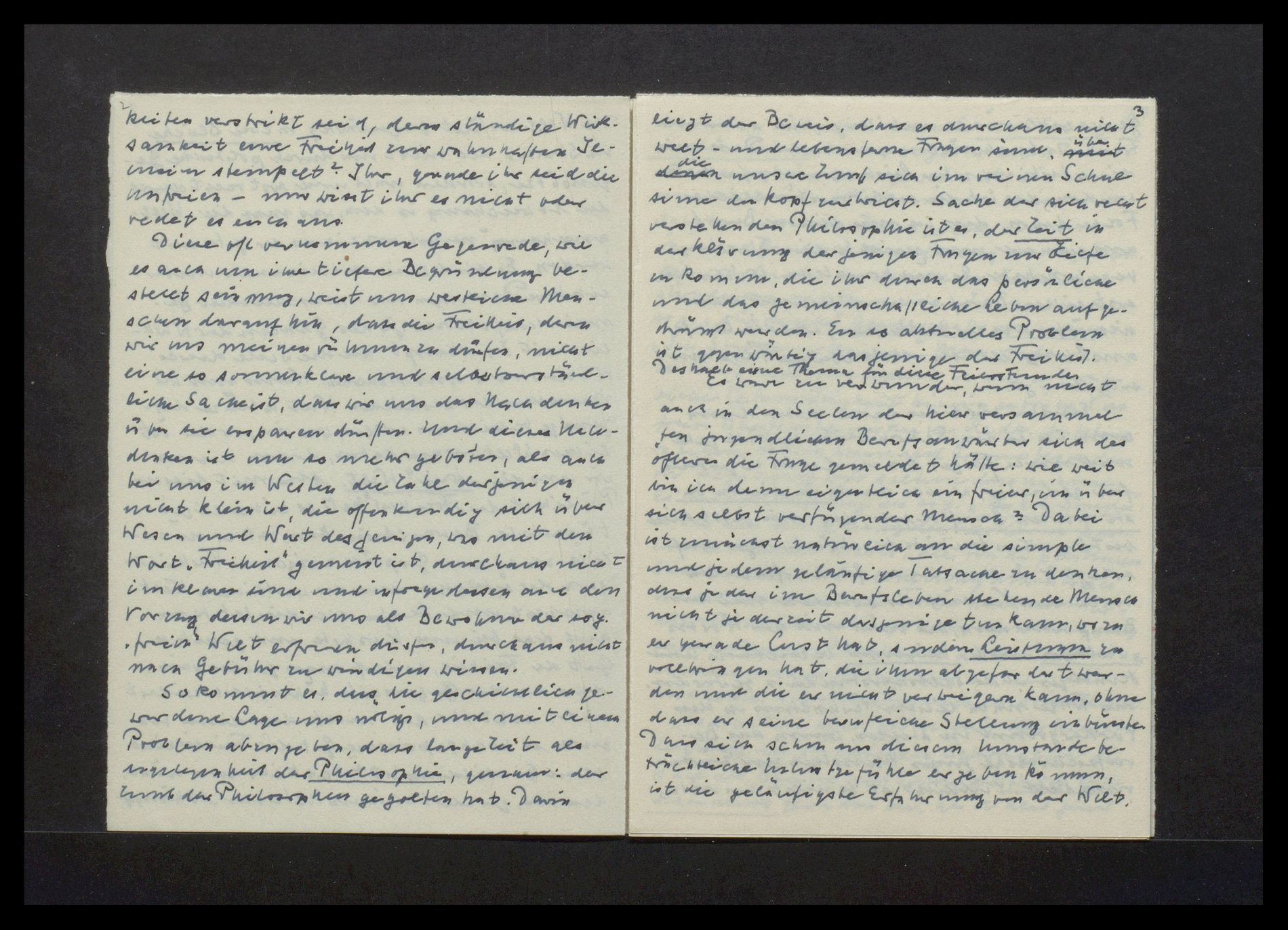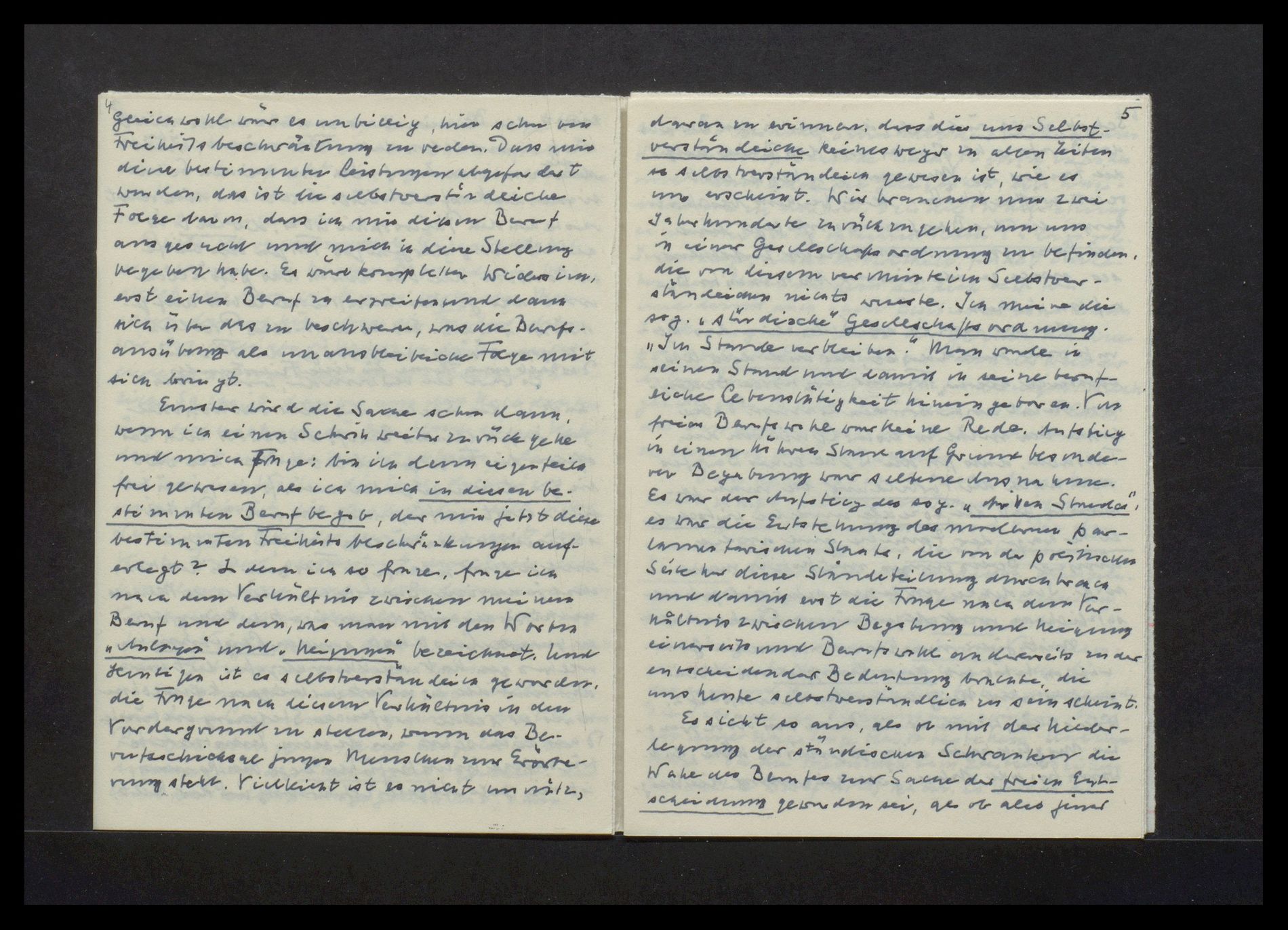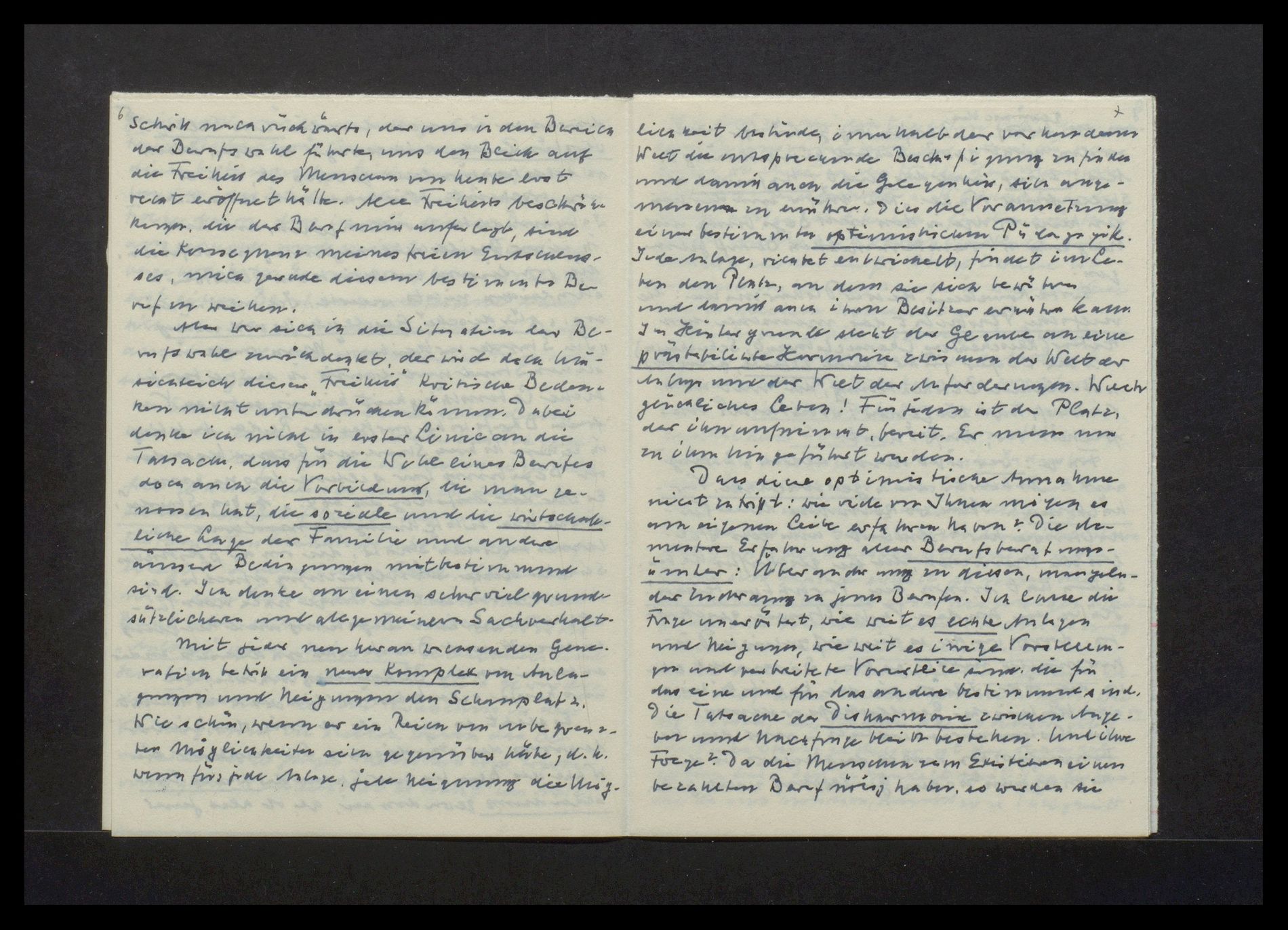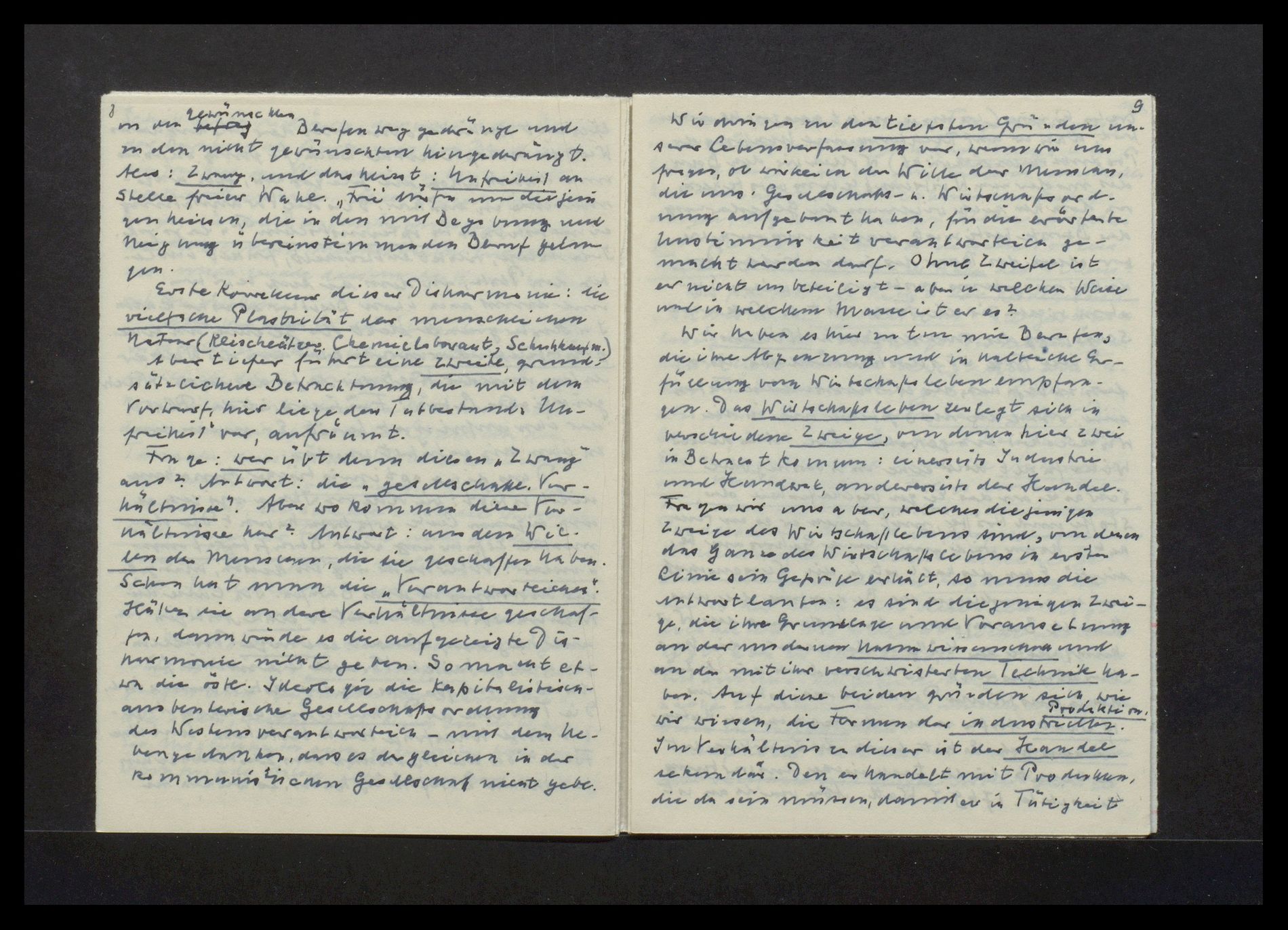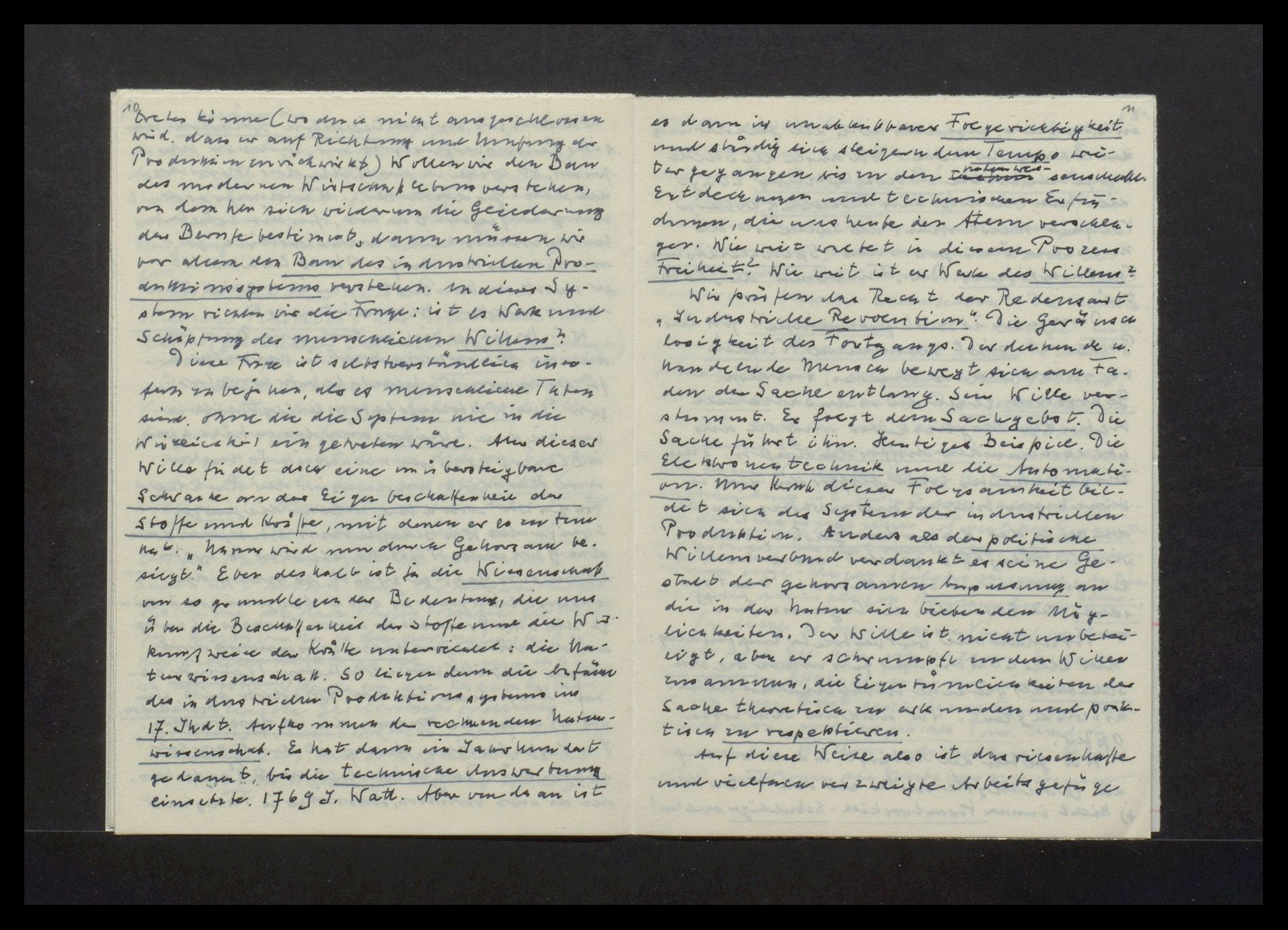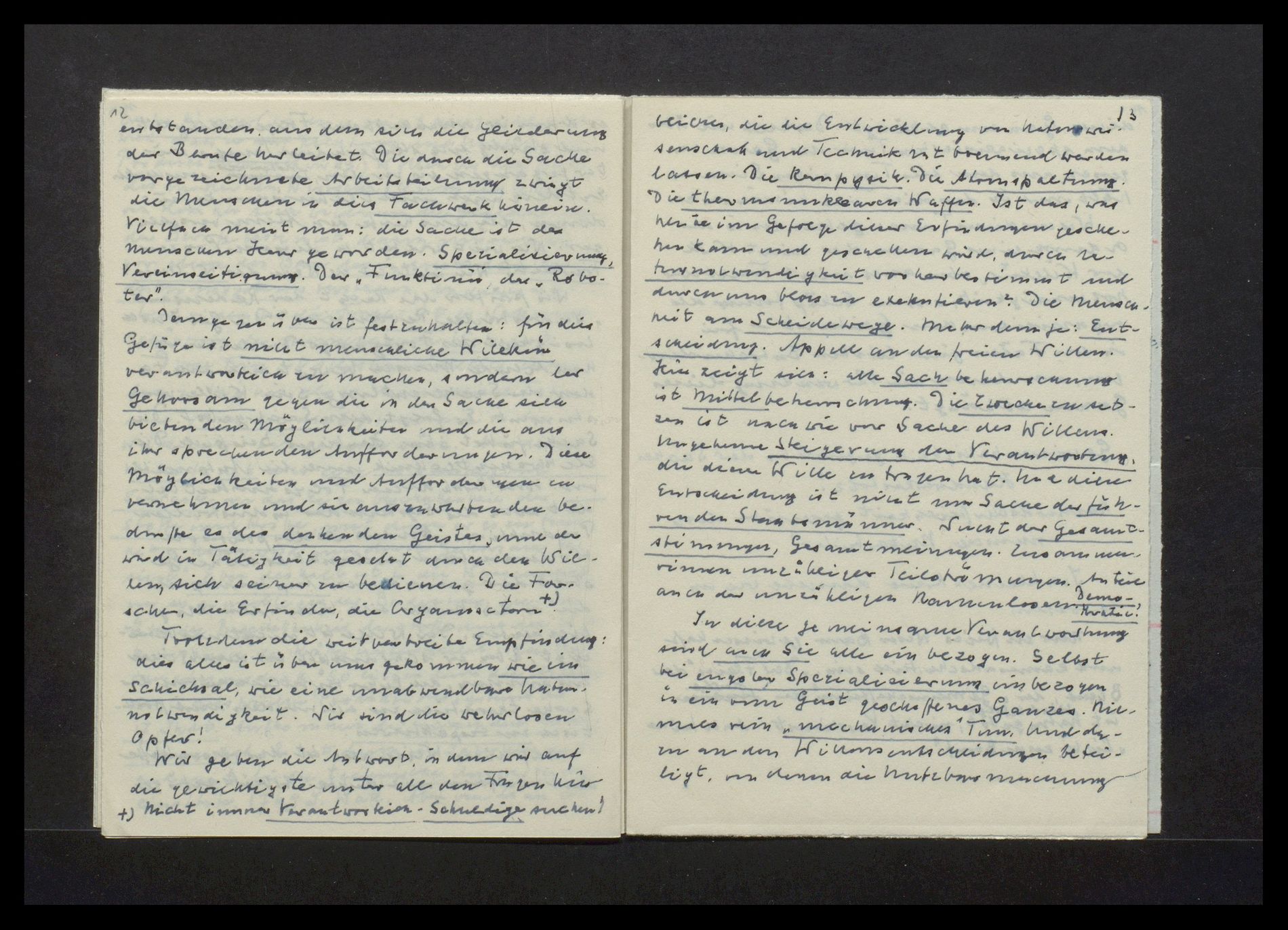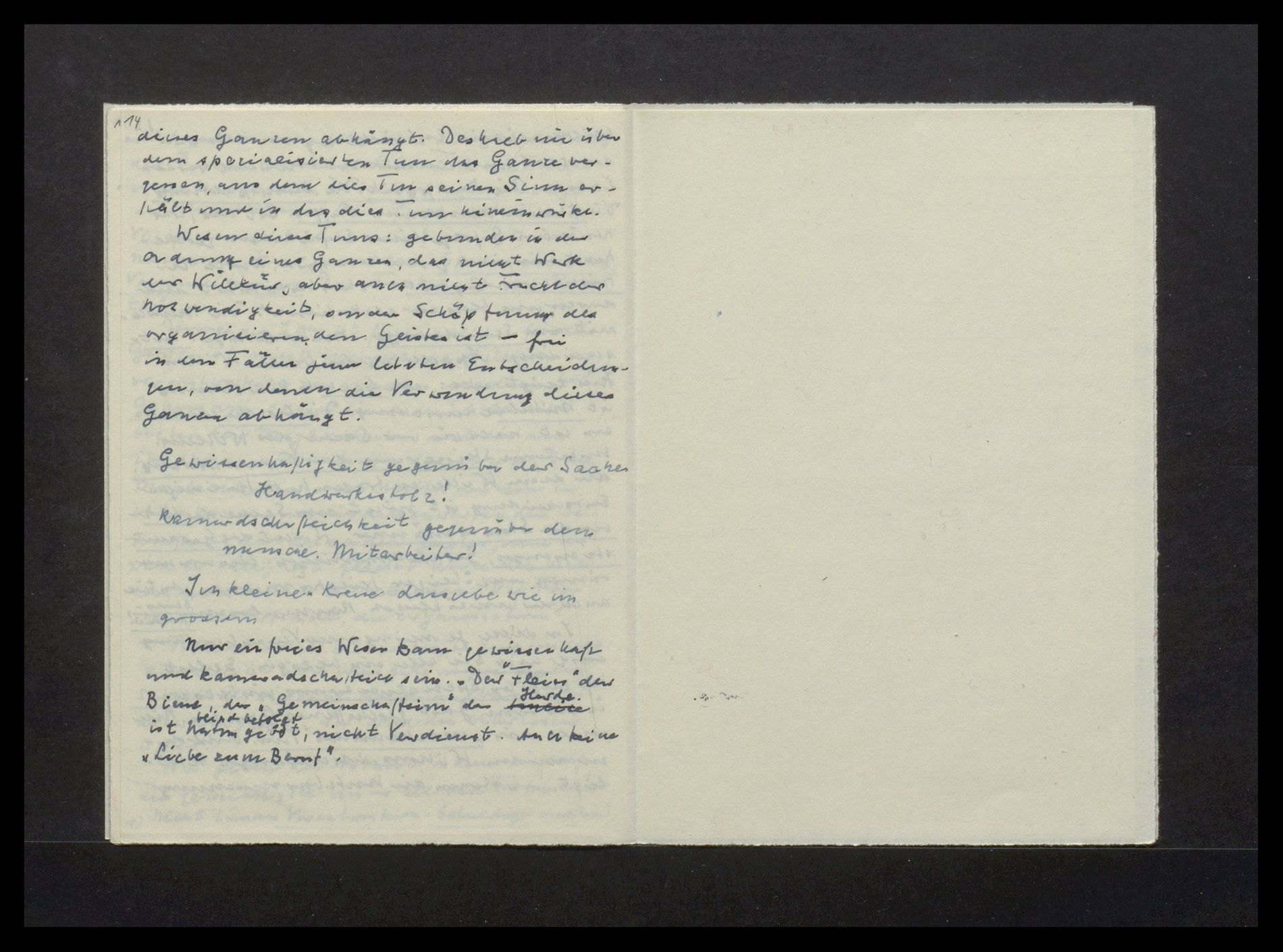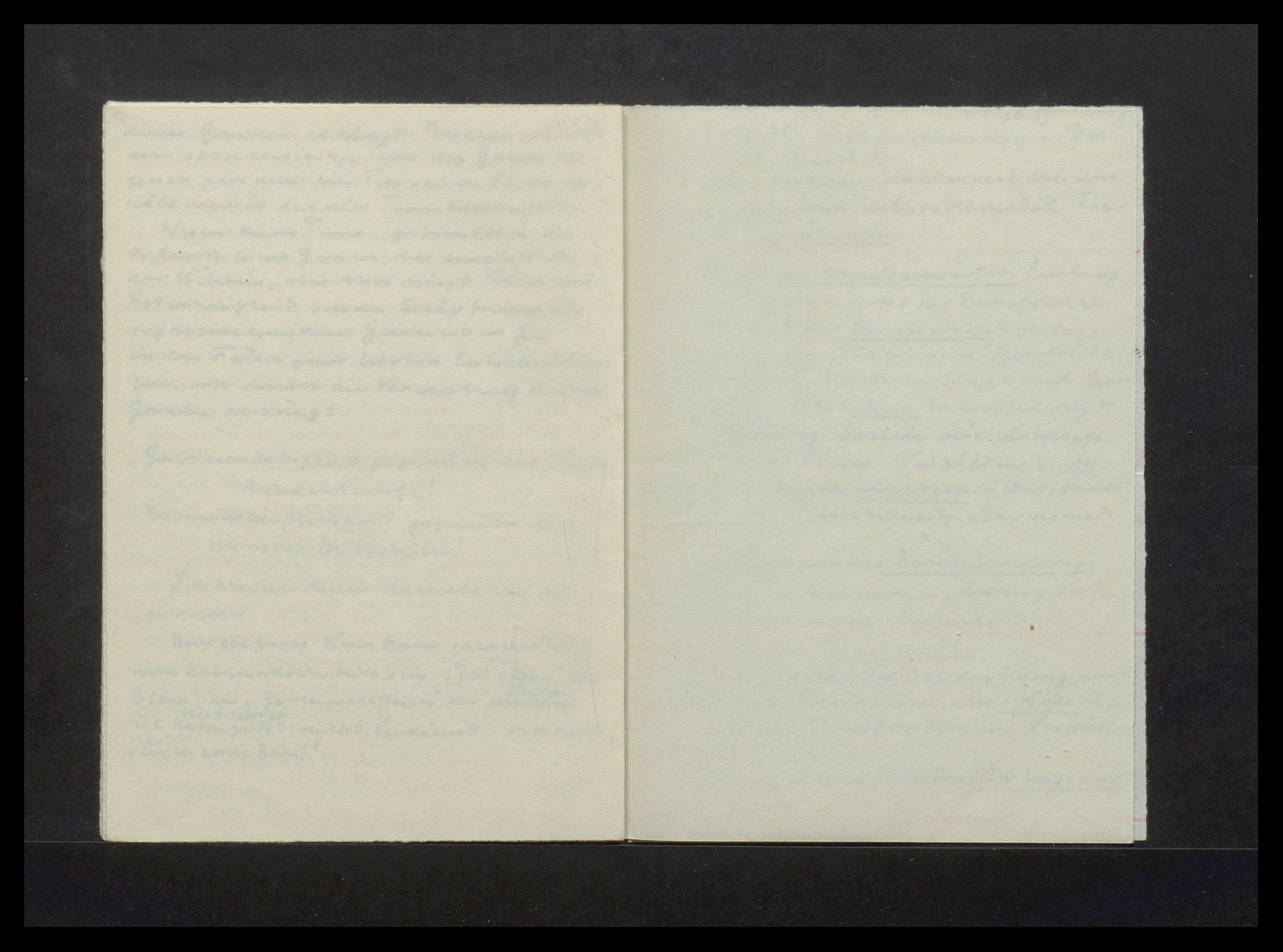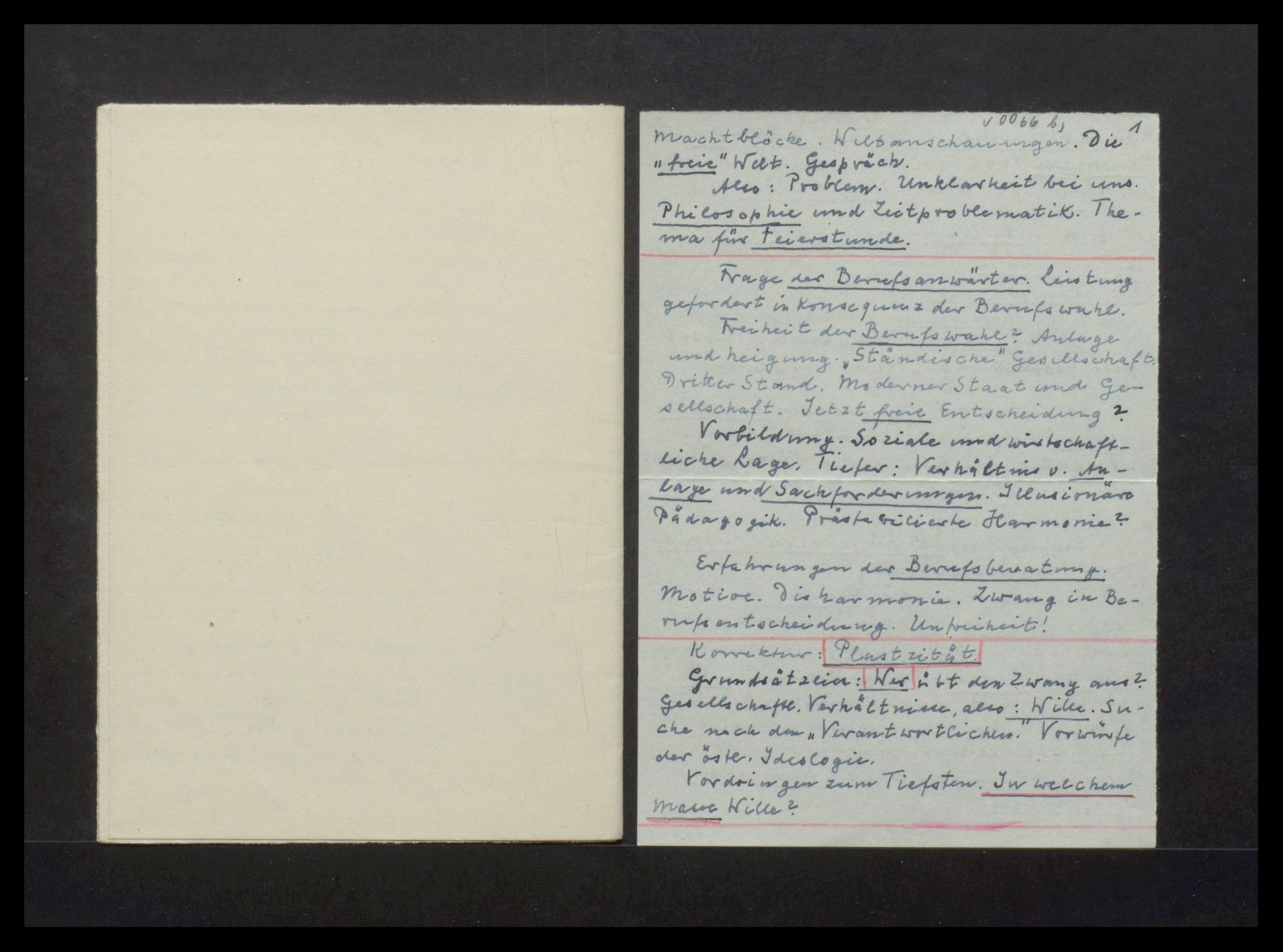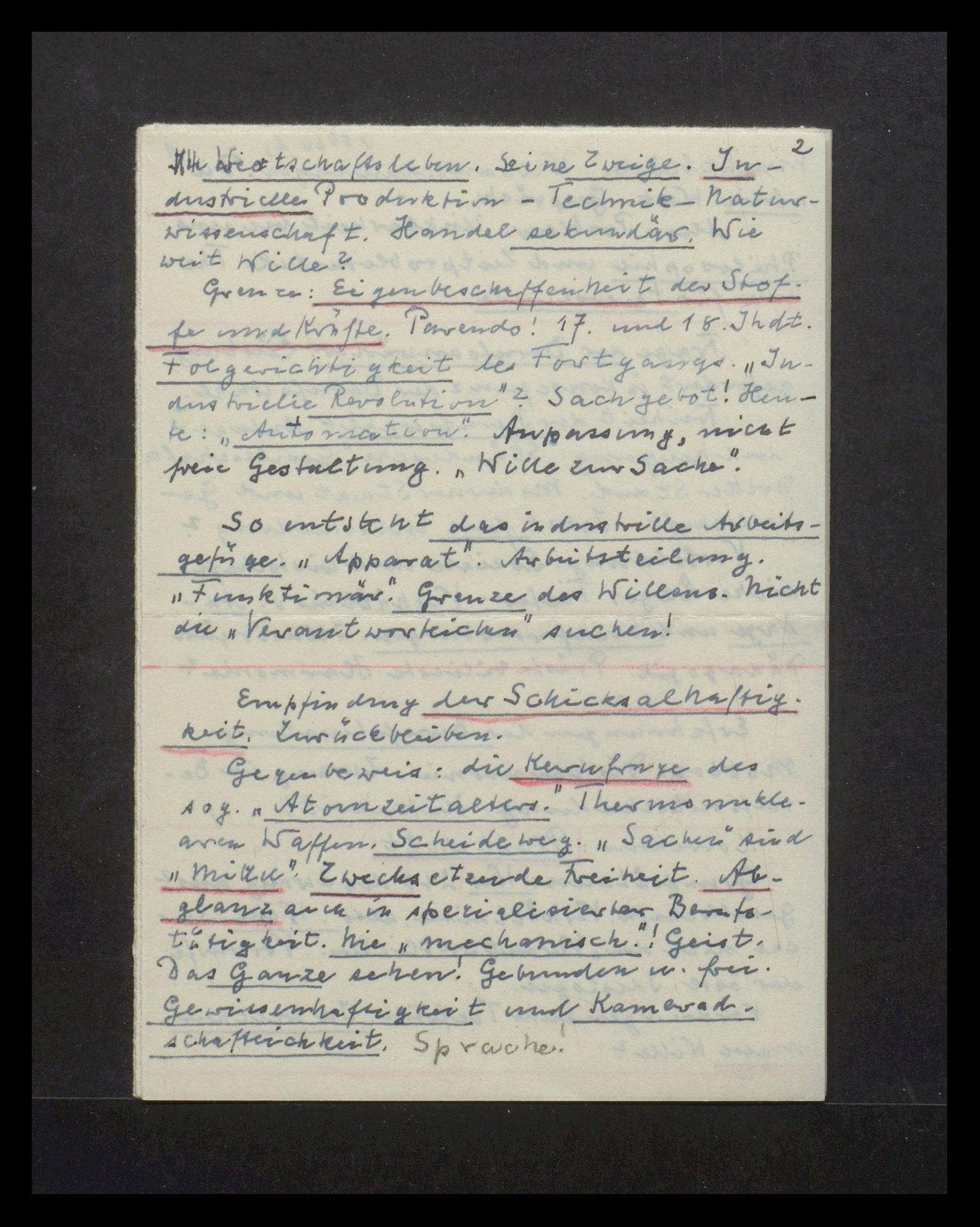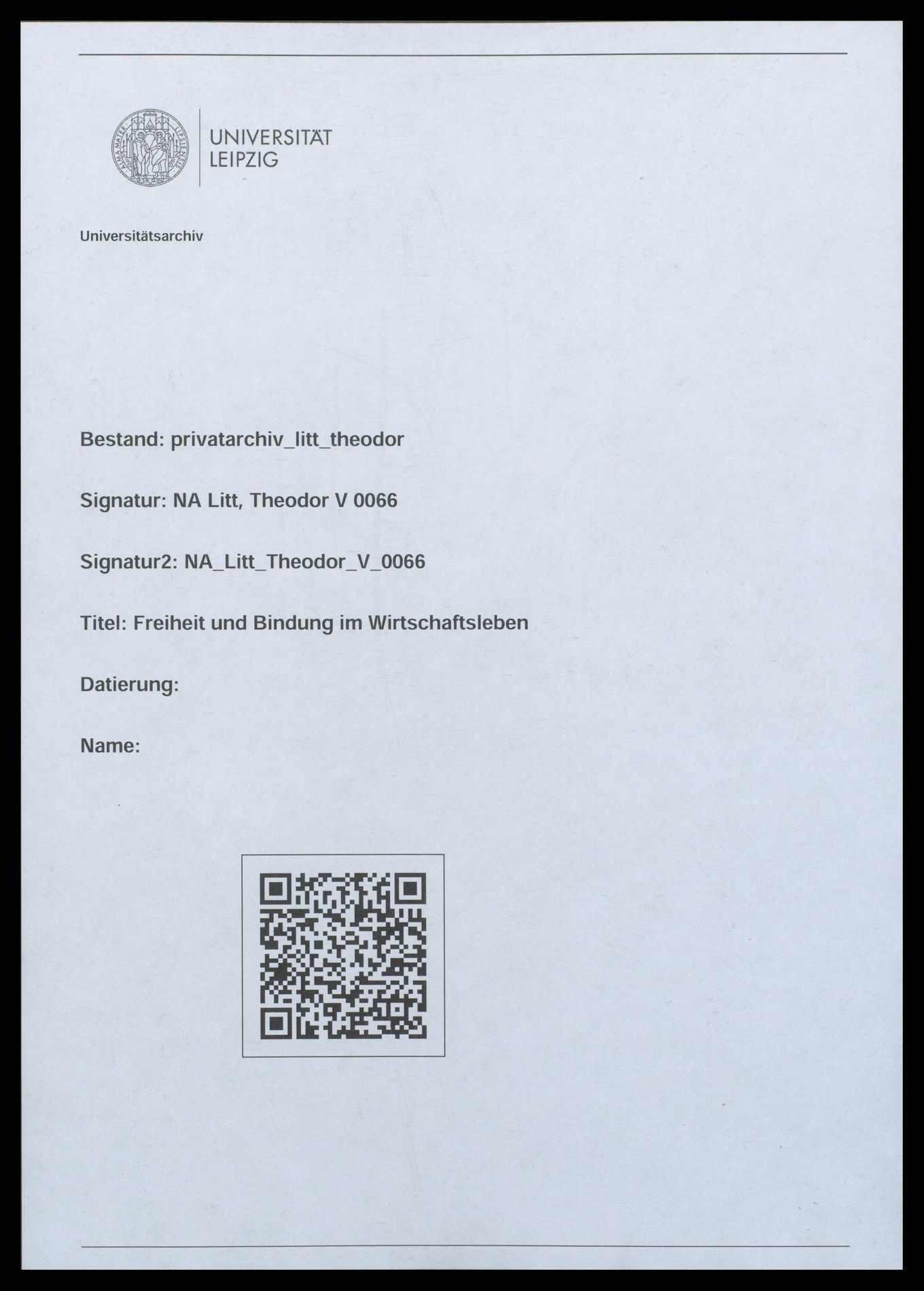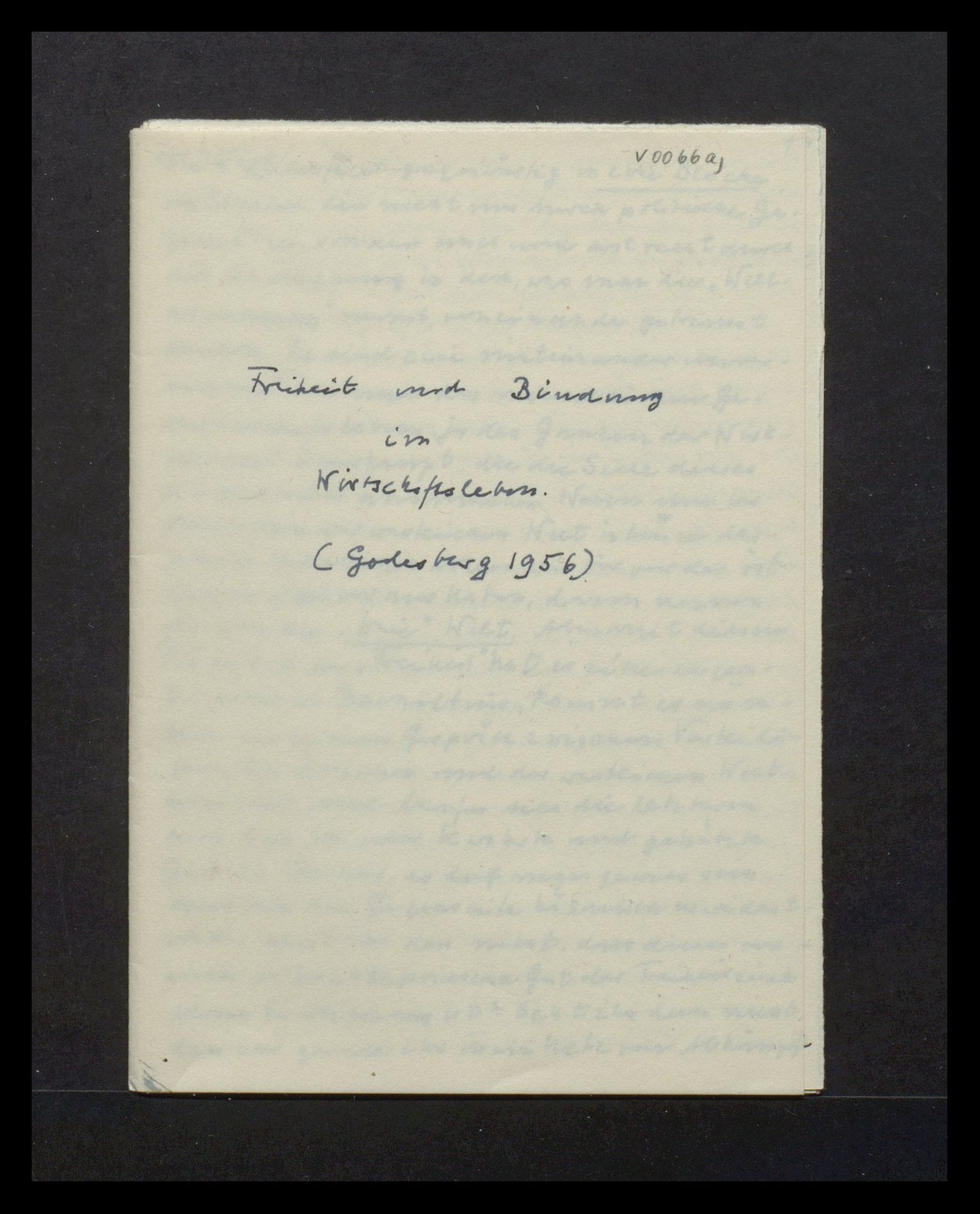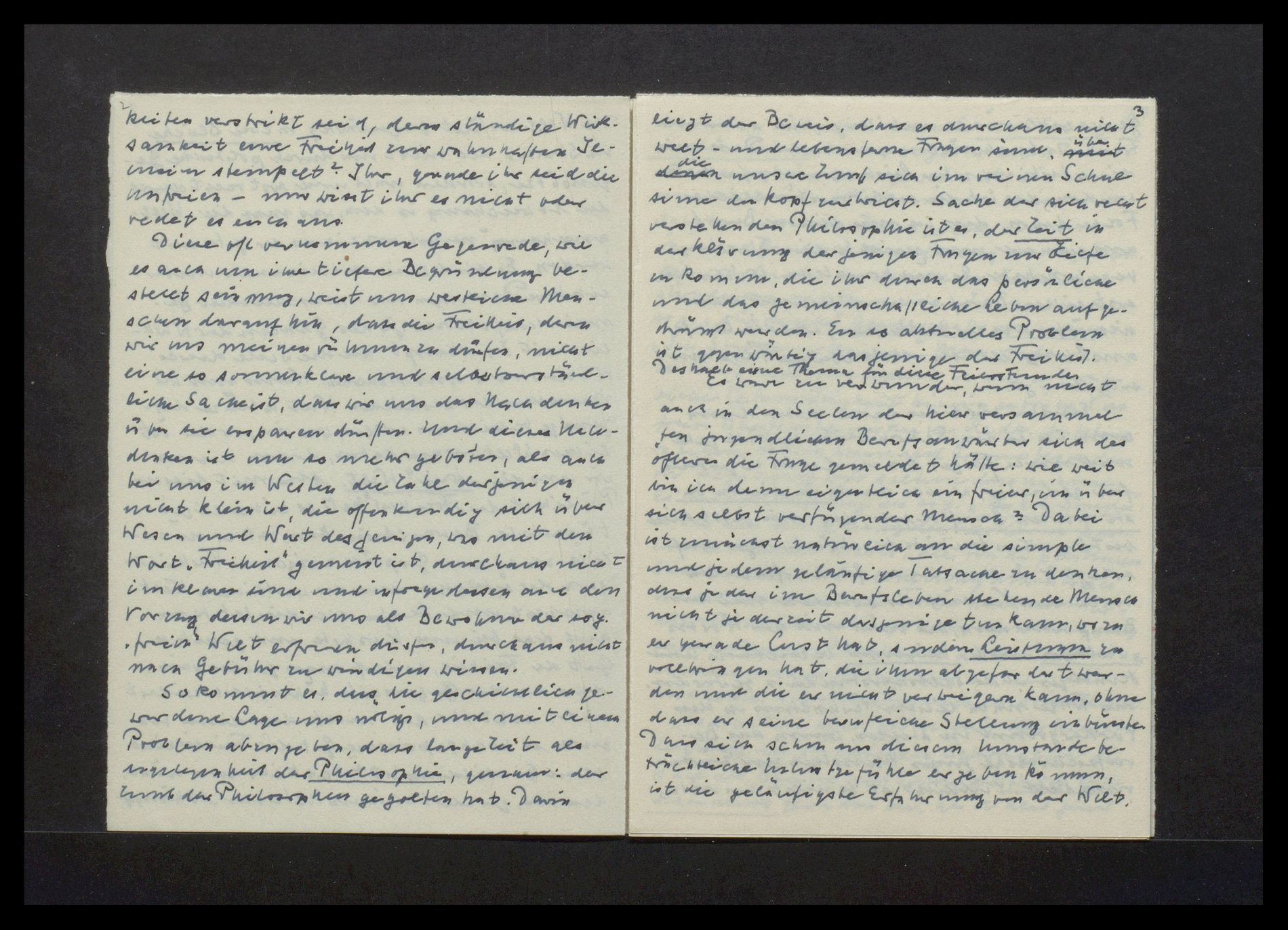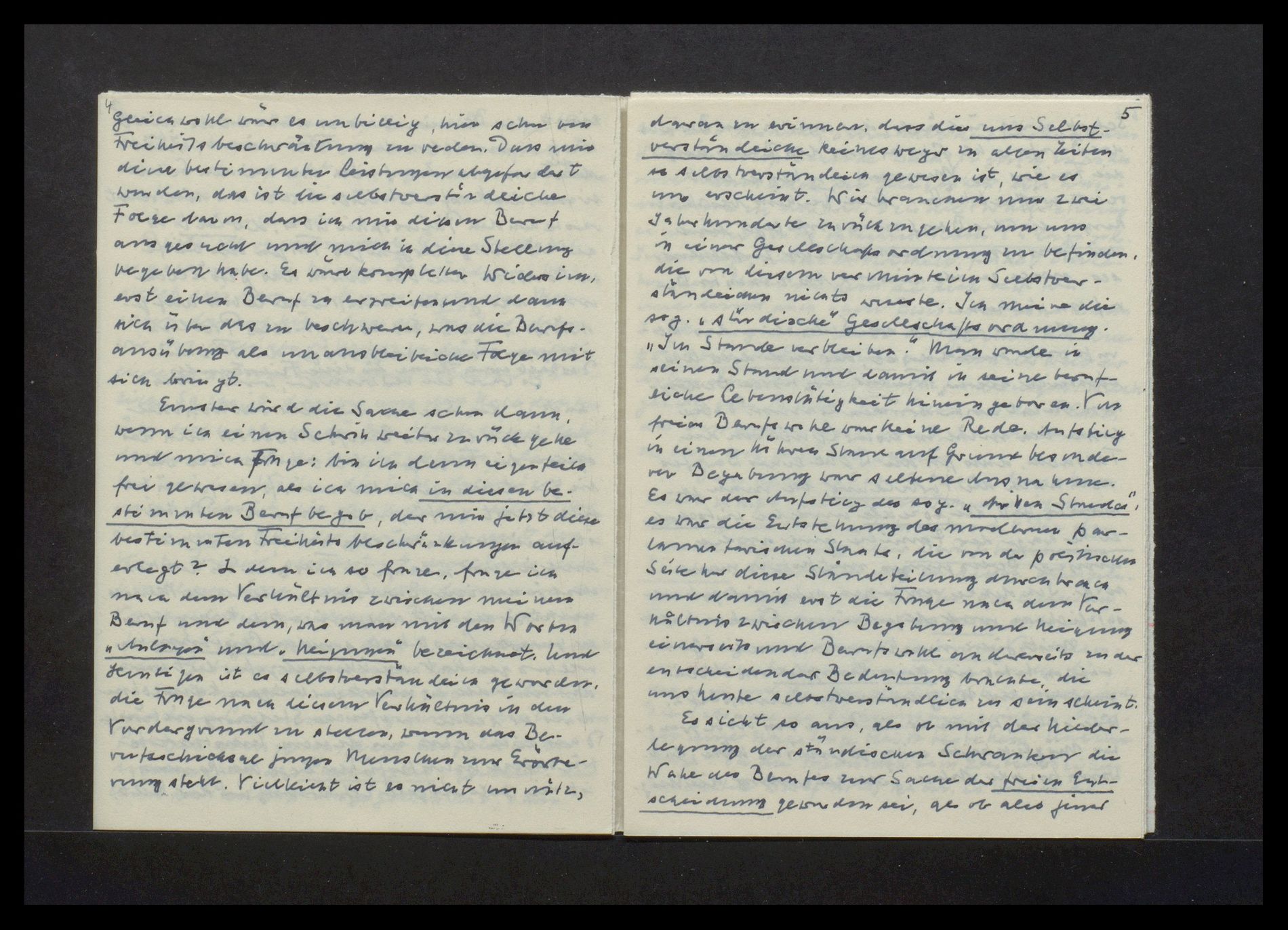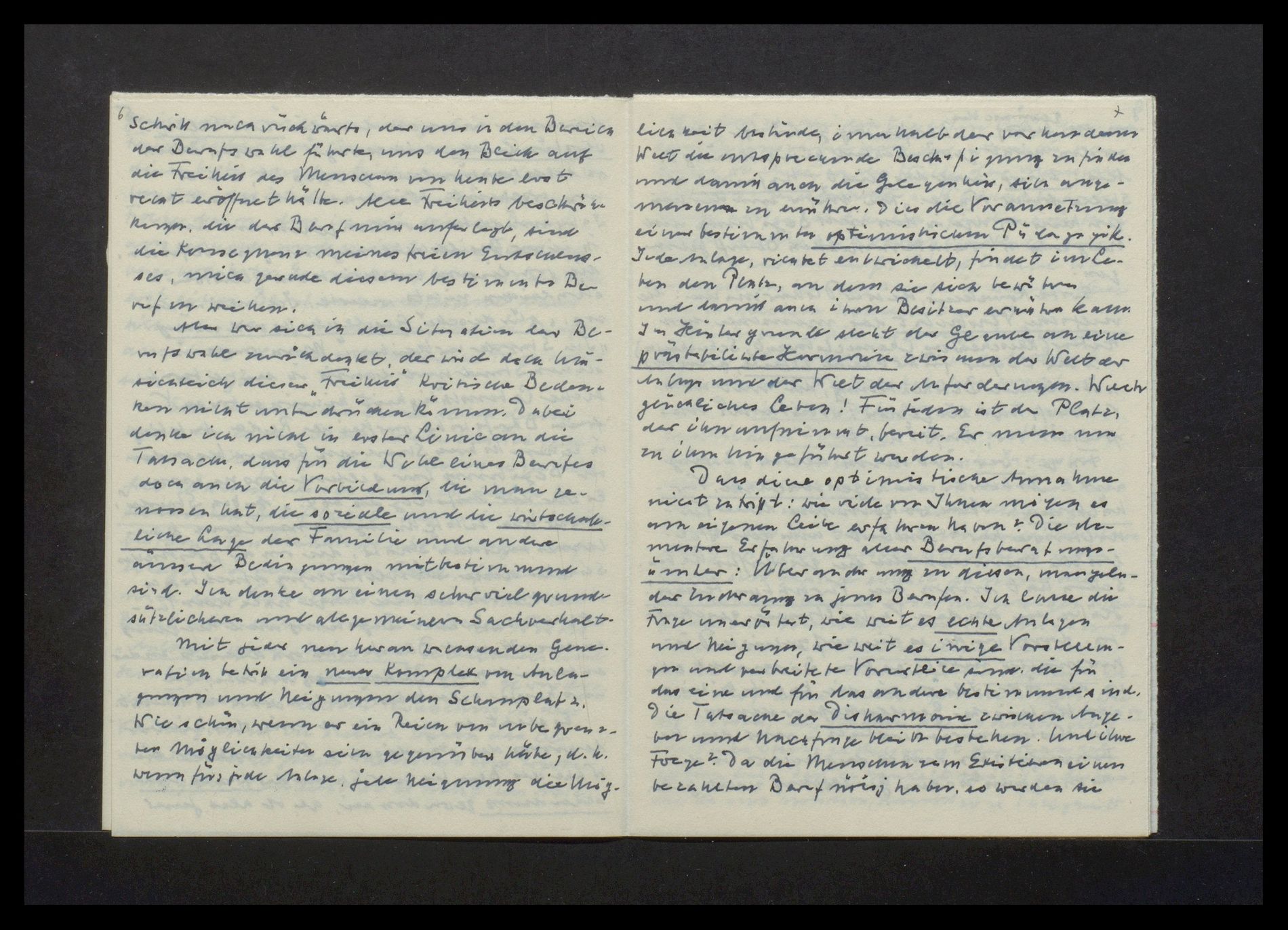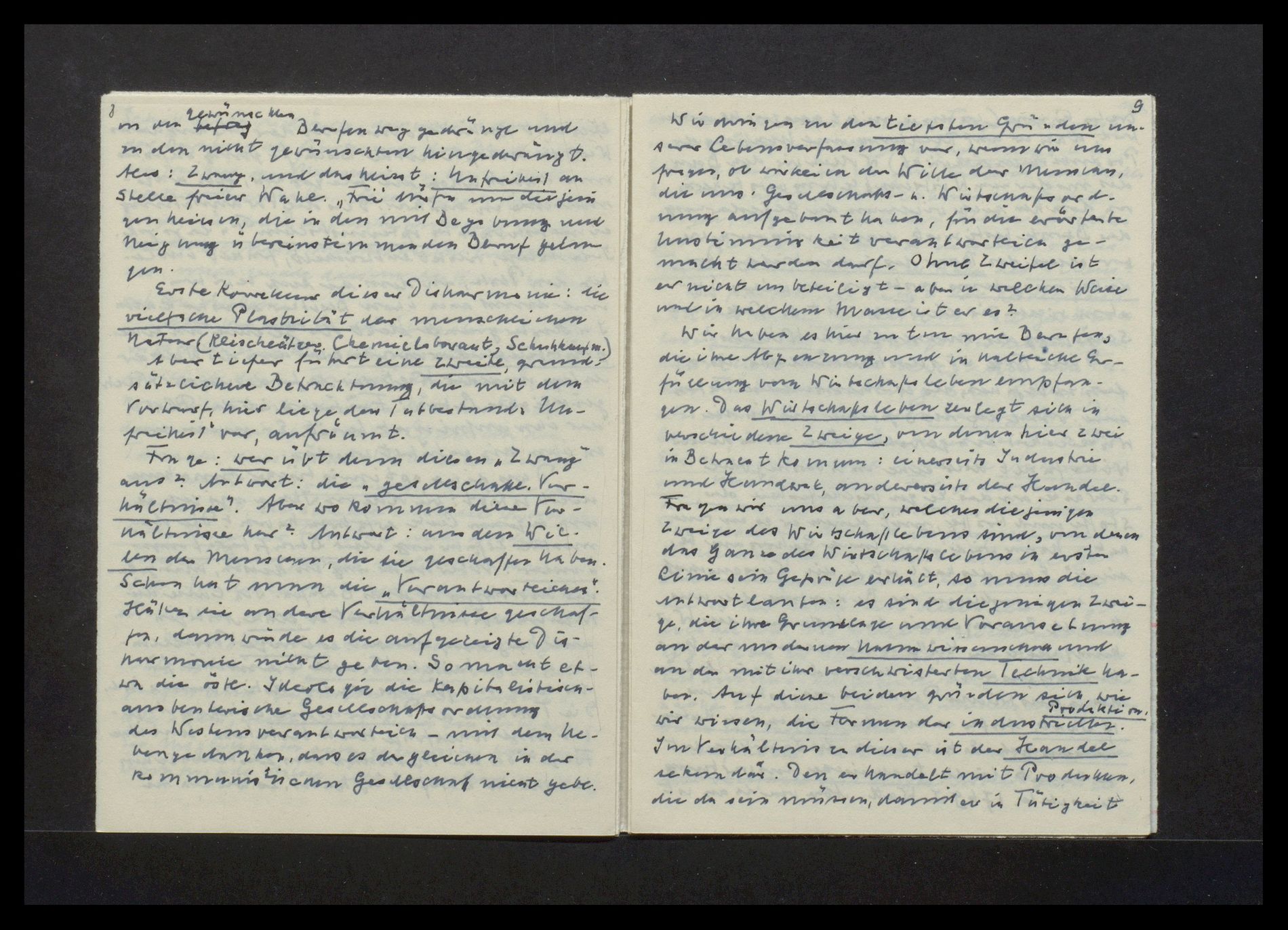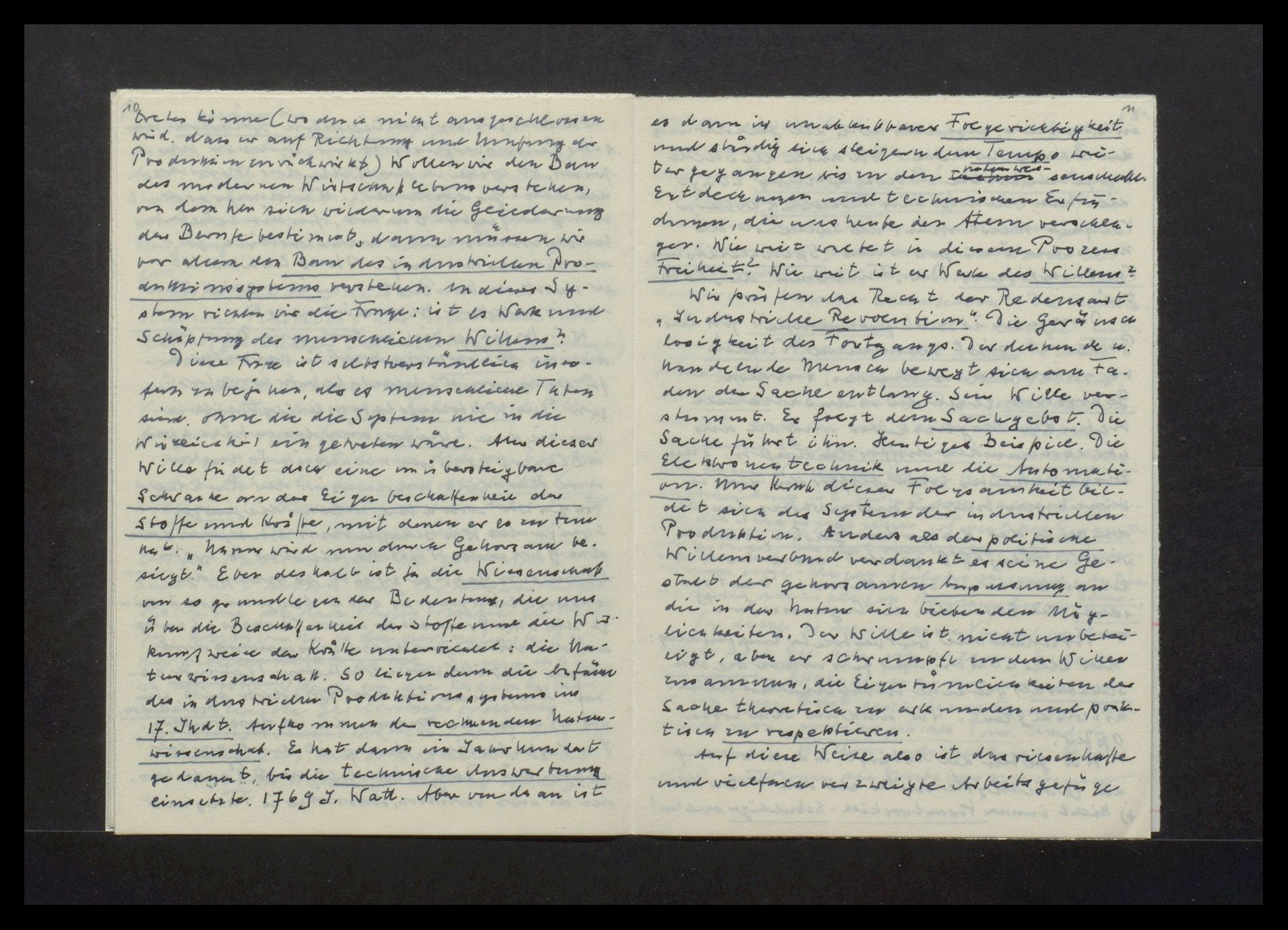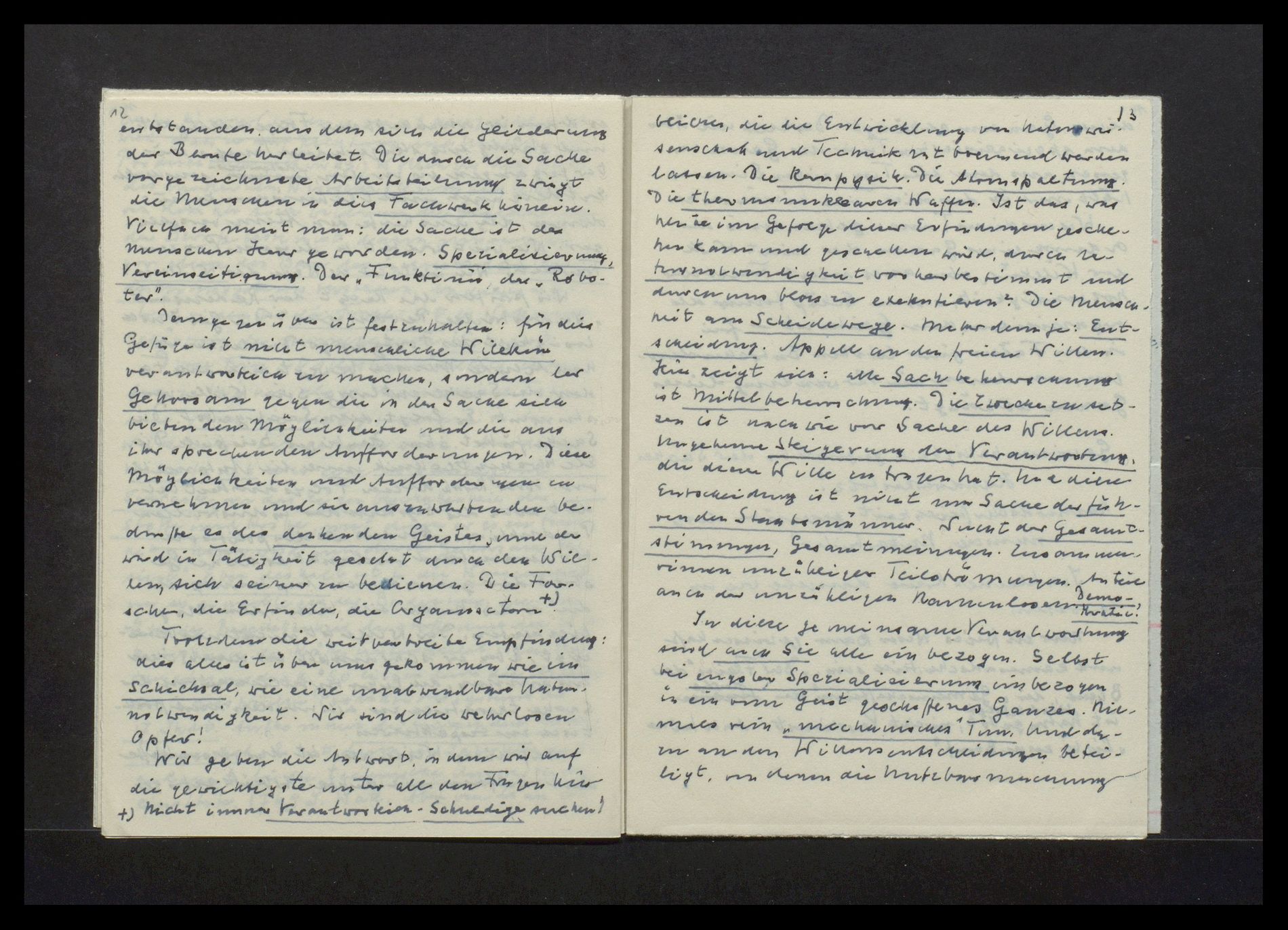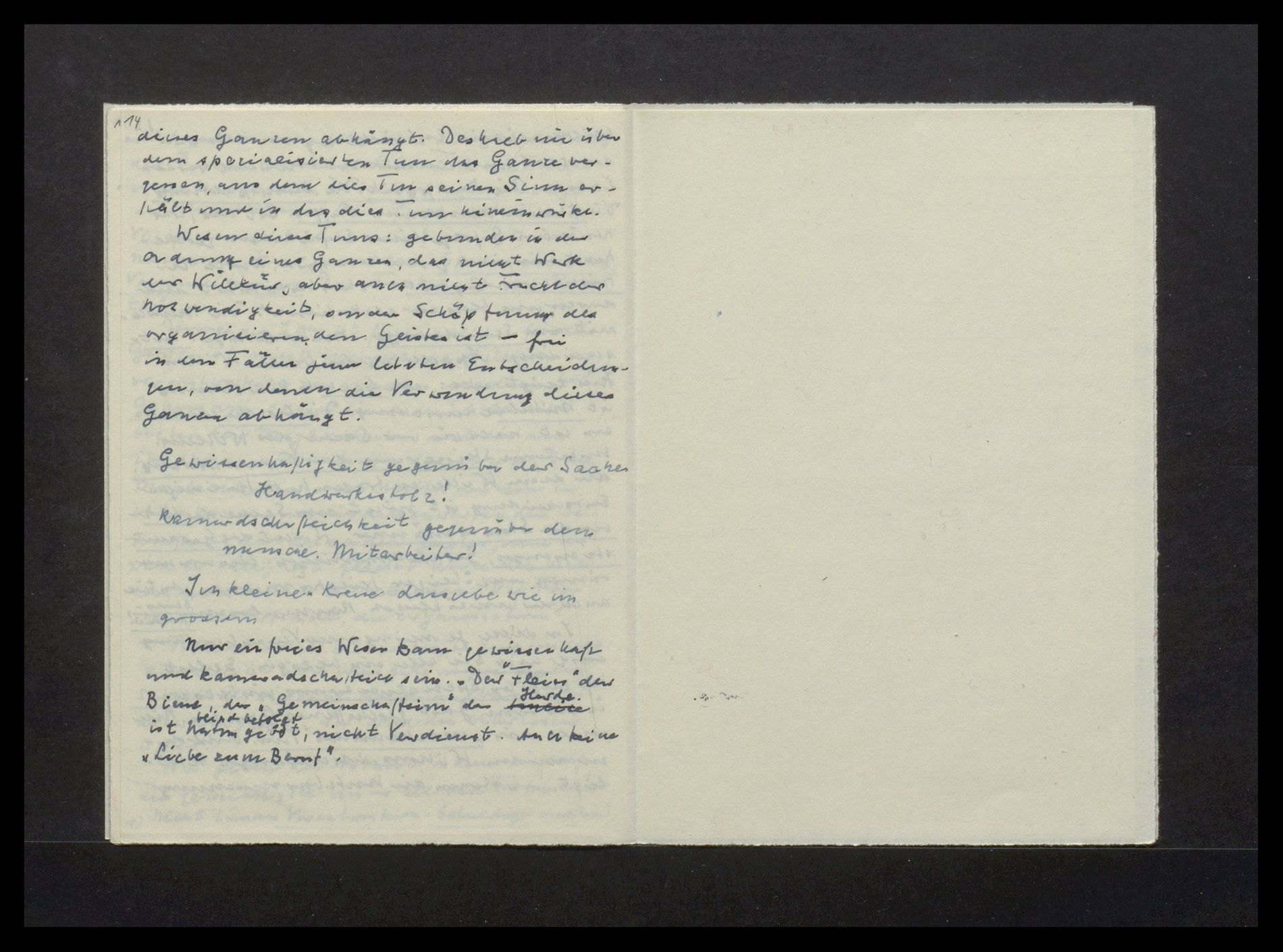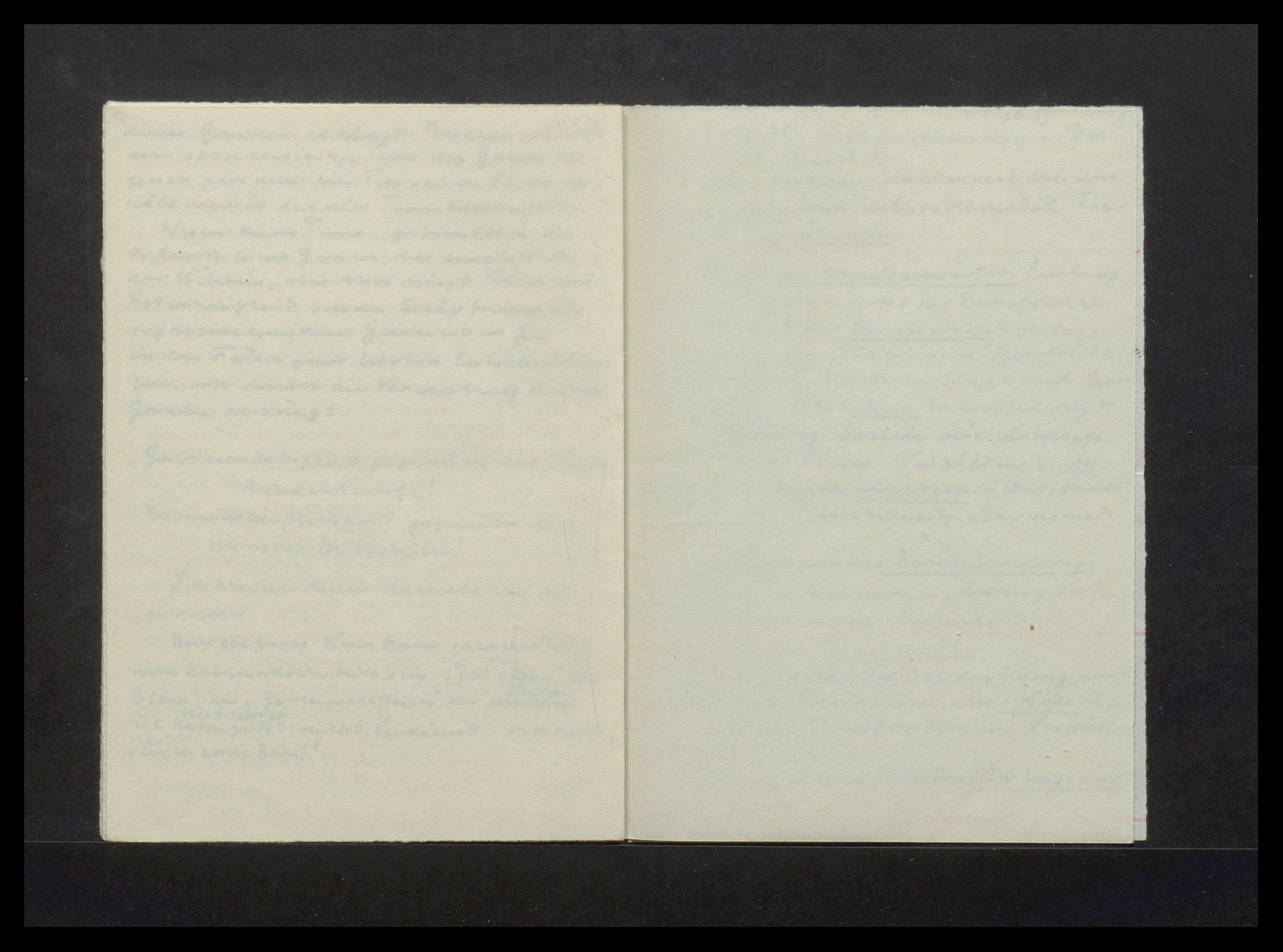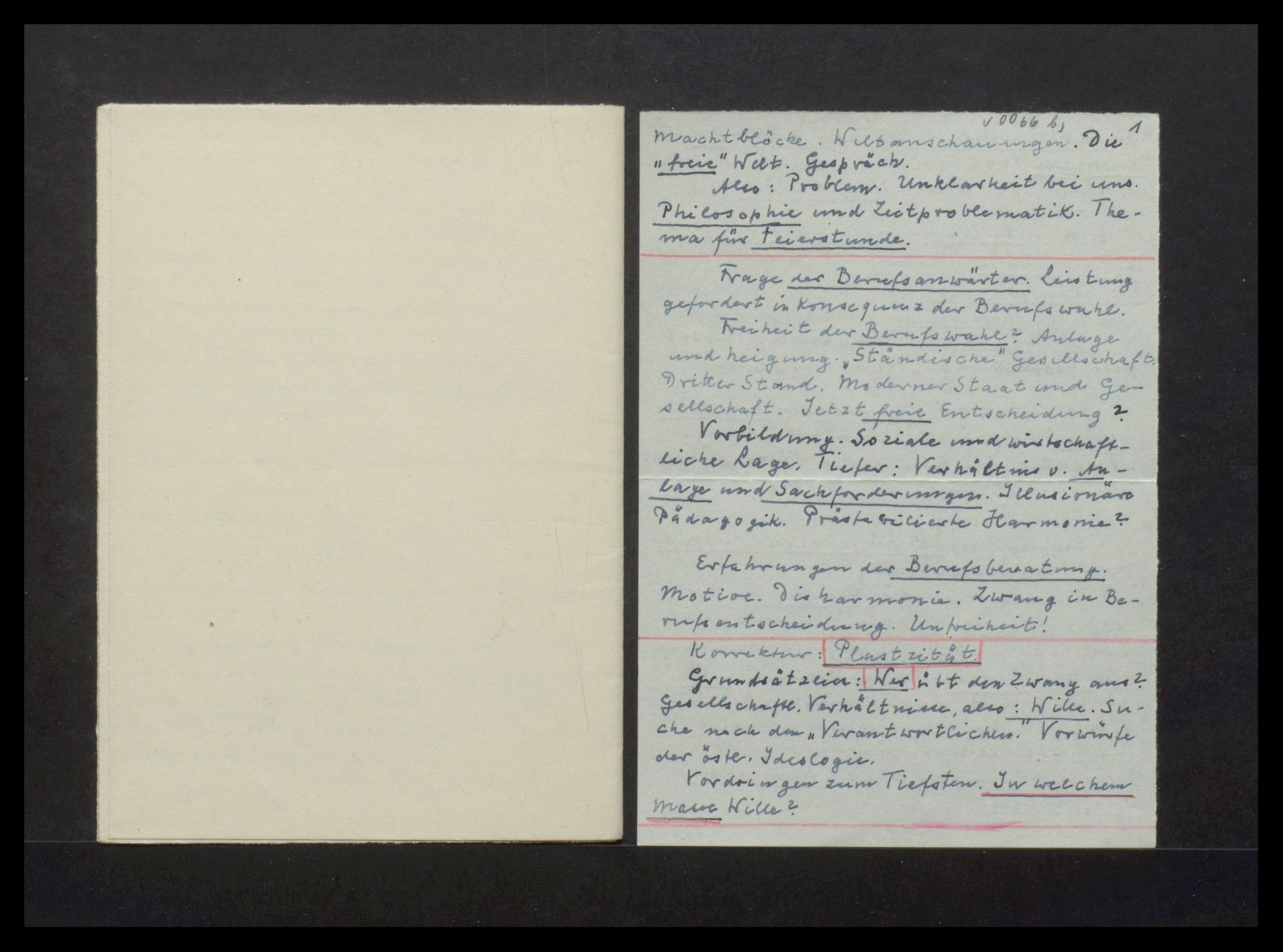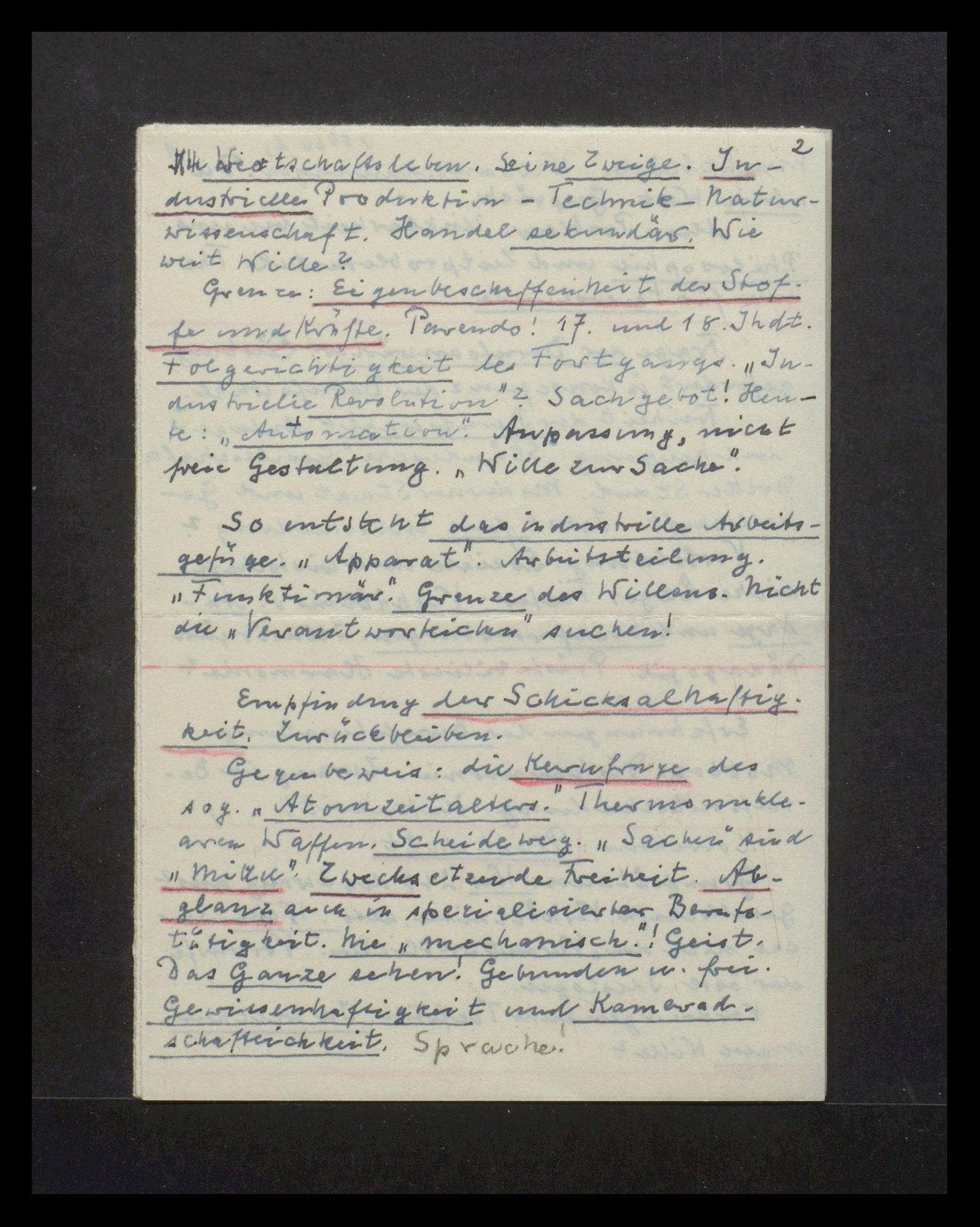| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0066a
(1956)
Titelblatt
Freiheit und Bindung im Wirtschaftsleben
(Godesberg 1956)
1
Die Welt zerfällt gegenwärtig in zwei Blöcke
von Staaten, die nicht nur durch politische Ge-
gensätze, sondern auch und erst recht durch
die Abweichung in dem, was man die „Welt-
anschauung“ nennt, voneinander getrennt
werden. Es sind zwei miteinander unver-
einbare Deutungen des menschlichen Ge-
meinschaftslebens, ja des Ganzen der Wirk-
lichkeit überhaupt, die die Seele dieses
Widerstreits ausmachen. Wenn nun wir
Menschen der westlichen Welt in Kürze das-
jenige bezeichnen wollen, was wir vor der öst-
lichen Welt voraus haben, dann nennen
wir uns die „freie“ Welt. Aber mit diesem
Prädikat der „Freiheit“ hat es eine eigen-
tümliche Bewandtnis. Kommt es näm-
lich zu einem Gespräch zwischen Verteidi-
gern der östlichen und der westlichen Welt-
ansicht und berufen sich die letzteren
auf das bei uns bewahrte und gehütete
Gut der Freiheit, so darf man gewiss sein,
dass von der Gegenseite höhnisch erwidert
wird: seht ihr den nicht, dass dieses von
euch so hochgepriesene Gut der Freiheit eine
blosse Einbildung ist? Seht ihr denn nicht,
dass ihr, gerade ihr in ein Netz von Abhängig-
2
keiten verstrikt seid, deren ständige Wirk-
samkeit eure Freiheit zur wahnhaften Il-
lusion stempelt? Ihr, gerade ihr seid die
unfreien – nur wisst ihr es nicht oder
redet es euch aus.
Diese oft vernommene Gegenrede, wie
es auch um ihre tiefere Begründung be-
stellt sein mag, weist uns westliche Men-
schen darauf hin, dass die Freiheit, deren
wir uns meinen rühmen zu dürfen, nicht
eine so sonnenklare und selbstverständ-
liche Sache ist, dass wir uns das Nachdenken
über sie ersparen dürfen. Und dieses Nach-
denken ist um so mehr geboten, als auch
bei uns im Westen die Zahl derjeigen
nicht klein ist, die offenkundig sich über
Wesen und Wert desjenigen, was mit dem
Wort „Freiheit“ gemeint ist, durchaus nicht
im klaren sind und infolge dessen auch den
Vorzug dessen wir uns als Bewohner der sog.
„freien“ Welt erfreuen dürfen, durchaus nicht
nach Gebühr zu würdigen wissen.
So kommt es, dass die geschichtlich ge-
wordene Lage uns nötigt, uns mit einem
Problem abzugeben, dass lange Zeit als
Angelegenheit der Philosophie, genau: der
Zunft der Philosophen gegolten hat. Darin
liegt der Beweis, dass es durchaus nicht
über
welt- und lebensferne Fragen sind, mit
die
denen unsere Zunft sich im reinen Schul-
sinne den Kopf zerbricht. Sache der sich recht
verstehenden Philosophie ist es, der Zeit in
der Klärung derjenigen Fragen zur Hilfe
zu kommen, die ihr durch das persönliche
und das gemeinschaftliche Leben aufge-
drängt wurden. Ein so aktuelles Problem
ist gegenwärtig dasjenige der Freiheit.
Deshalb <....> Thema für diese Feierstunde
Es wäre zu verwundern, wenn nicht
auch in den Seelen der hier versamel-
ten jugendlichen Berufsanwärter sich des
öfteren die Frage gemeldet hätte: wie weit
bin ich denn eigentlich ein freier, ein über
sich selbst verfügender Mensch? Dabei
ist zunächst natürlich an die simple
und jedem geläufige Tatsache zu denken,
dass jeder im Berufsleben stehende Mensch
nicht jederzeit dasjenige tun kann, wozu
er gerade Lust hat, sondern Leistungen zu
vollbringen hat, die ihm abgefordert wer-
den und die er nicht verweigern kann, ohne
dass er seine berufliche Stellung einbüsste.
Dass sich schon aus diesem Umstande be-
trächtliche Unlustgefühle ergeben können,
ist die geläufigste Erfahrung von der Welt.
4
Gleichwohl wäre es unbillig, hier schon von
Freiheitsbeschränkung zu reden. Dass mir
diese bestimmten Leistungen abgefordert
wurden, das ist die selbstverständliche
Folge davon, dass ich mir diesen Beruf
ausgesucht und mich in diese Stellung
begeben habe. Es wäre kompletter Widersinn,
erst einen Beruf zu ergreifen und dann
sich über das zu beschweren, was die Berufs-
ausübung als unausbleibliche Folge mit
sich bringt.
Ernster wird die Sache schon dann,
wenn ich einen Schritt weiter zurückgehe
und mich frage: bin ich denn eigentlich
frei gewesen, als ich mich in diesen be-
stimmten Beruf begab, der mir jetzt diese
bestimmten Freiheitsbeschränkungen auf-
erlegt? In dem ich so frage, frage ich
nach dem Verhältnis zwischen meinem
Beruf und dem, was man mit den Worten
„Anlagen“ und „Neigungen“ bezeichnet. Und
Heutigen ist es selbstverständlich geworden,
die Frage nach diesem Verhältnis in den
Vordergrund zu stellen, wenn das Be-
rufsschicksal junger Menschen zur Erörte-
rung steht. Vielleicht ist es nicht unnütz,
5
daran zu erinnern, dass dies uns Selbst-
verständliche keineswegs zu allen Zeiten
so selbstverständlich gewesen ist, wie es
uns erscheint. Wir brauchen nur zwei
Jahrhunderte zurückzugehen, um uns
in einer Gesellschaftsordnung zu befinden,
die von diesem vermeintlich Selbstver-
ständlichen nichts wusste. Ich meine die
sog. „ständische“ Gesellschaftsordnung.
„Im Stande verbleiben“. Man wurde in
seinen Stand und damit in seine beruf-
liche Lebenstätigkeit hineingeboren. Von
freier Berufswahl war keine Rede. Aufstieg
in einen höheren Stand auf Grund besonde-
rer Begabung war seltene Ausnahme.
Es war der Aufstieg des sog. „dritten Standes“,
es war die Entstehung des modernen par-
lamentarischen Staates, die von der politischen
Seite her diese Ständeteilung durchbrochen
und damit erst die Frage nach dem Ver-
hältnis zwischen Begabung und Neigung
einerseits und Berufswahl andererseits zu der
entscheidenden Bedeutung brachten, die
uns heute selbstverständlich zu sein scheint.
Es sieht so aus, als ob mit der Nieder-
legung der ständischen Schranken die
Wahl des Berufs zur Sache der freien Ent-
scheidung geworden sei, als ob also jener
6
Schritt nach rückwärts, der uns in den Bereich
der Berufswahl führte, uns den Blick auf
die Freiheit des Menschen von heute erst
recht eröffnet hätte. Alle Freiheitsbeschrän-
kungen, die der Beruf mir auferlegt, sind
die Konsequenz meines freien Entschlus-
ses, mich gerade diesem bestimmten Be-
ruf zu weihen.
Aber wer sich in die Situation der Be-
rufswahl zurückdenkt, der wird sich doch hin-
sichtlich dieser „Freiheit“ kritische Beden-
ken nicht unterdrücken können. Dabei
denke ich nicht in erster Linie an die
Tatsache, dass für die Wahl eines Berufes
doch auch die Vorbildung, die man ge-
nossen hat, die soziale und die wirtschaft-
liche Lage der Familie und andere
äussere Bedingungen mitbestimmend
sind. Ich denke an einen sehr viel grund-
sätzlicheren und allgemeineren Sachverhalt.
Mit jeder neu heranwachsenden Gene-
ration betritt ein neuer Komplex von Anla-
gungen und Neigungen den Schauplatz.
Wie schön, wenn er ein Reien von unbegrenz-
ten Möglichkeiten sich gegenüber hätte, d.h.
wenn für jede Anlage, jede Neigung die Mög-
7
lichkeit bestände, innerhalb der vorhandenen
Welt die entsprechende Beschäftigung zu finden
und dann auch die Gelegenheit, sich ange-
messen zu ernähren. Dies die Voraussetzung
einer bestimmten optimistischen Pädagogik.
Jede Anlage, richtet entwickelt, findet im Le-
benden Platz, an dem sie sich bewähren
und damit auch ihren Besitzer ernähren kann.
Im Hintergrund steht der Glaube an eine
prästabilierte Harmonie zwischen der Welt der
Anlage und der Welt der Anforderungen. Welch
glückliches Leben! Für jeden ist der Platz,
der ihn aufnimmt, bereit. Er muss nur
zu ihm hingeführt werden.
Dass diese optimistische Annahme
nicht zutrifft: wie viele von Ihnen mögen es
am eigenen Leibe erfahren haben? Die ele-
mentare Erfahrung aller Berufsberatungs-
ämter: Überandrang zu diesen, mangeln-
der Zudrang zu jenen Berufen. Ich lasse die
Frage unerörtert, wie weit es echte Anlagen
und Neigungen, wie weit es irrige Vorstellun-
gen und verbreitete Vorurteile sind, die für
das eine und für das andere bestimmend sind.
Die tatsache das Disharmonie zwischen Ange-
bot und Nachfrage bleibt bestehen. Und ihre
Folge? Da die Menschen zum Existieren einen
bezahlten Beruf nötig haben, so werden sie
8
gewünschten
den befrag Berufsweg gedrängt und
zu den nicht gewünschten hingedrängt.
Also: Zwang, und da heisst: Unfreiheit an
Stelle freier Wahl. „Frei“ dürfen nur diejeni-
gen heissen, die in den mit Begabung und
Neigung übereinstimmenden Beruf gelan-
gen.
Erste Korrektur dieser Disharmonie: die
vielfache Plästizität der menschlichen
Natur (Klischeätzer, Chemielaborant, Schuhkaufm.)
Aber tiefer führt eine zweite, grund-
sätzliche Betrachtung, die mit dem
Vorwurf, hier liege der Tatbestan, Un-
freiheit vor, aufräumt.
Frage: wer übt denn diesen „Zwang“
aus? Antwort: die „gesellschaftl. Ver-
hältnisse“. Aber wo kommen diese Ver-
hältnisse her? Antwort: aus dem Wil-
len der Menschen, die sie geschaffen haben.
Schon hat man die „Verantwortlichen“.
Hätten sie andere Verhältnisse geschaf-
fen, dann würde es die aufgezeigte Dis-
harmonie nicht geben. So macht et-
wa die östl. Ideologie die kapitalistisch-
ausbeuterische Gesellschaftsordnung
des Westens verantwortlich – mit dem Ne-
bengedanken, dass es dergleichen in der
kommunistischen Gesellschaft nicht gebe.
9
Wir dringen zu den tiefsten Gründen un-
serer Lebensverfassung vor, wenn wir uns
fragen, ob wirklich der Wille der Menschen,
die uns. Gesellschafts- u. Wirtschaftsord-
nung aufgebaut haben, für die erörterte
Unstimmigkeit verantwortlich ge-
macht werden darf. Ohne Zweifel ist
er nicht unbeteiligt – aber in welcher Weise
und in welchem Masse ist er es?
Wir haben es hier zu tun mit Berufen,
die ihre Abgrenzung und inhaltliche Er-
füllung vom Wirtschaftsleben e,pfan-
gen. Das Wirtschaftsleben zerlegt sich in
verschiedene Zweige, von denen hier zwei
in Betracht kommen: einerseits Industrie
und Handwerk, andererseits der Handel.
Fragen wir uns aber, welches diejenigen
Zweige des Wirtschaftslebens sind, von denen
das Ganze des Wirtschaftslebens in erster
Linie sein Gepräge erhält, so muss die
Antwort lauten: es sind diejenigen Zwei-
ge, die ihre Grundlage und Voraussetzung
an der modernen Naturwissenschaft und
an der mit ihr verschwisterten Technik ha-
ben. Auf diese beiden gründen sich wie
wir wissen, die Formen der industriellen.
Im Verhältnis zu dieser ist der Handel
sekundär. Den er handelt mit Produkten,
die da sein müssen, damit er in Tätigkeit
10
treten könne (wo durch nicht ausgeschlossen
wird, dass er auf Richtung und Umfang der
Produktion zurückwirkt) Wollen wir den Bau
des modernen Wirtschaftslebens verstehen,
von dem her sich wiederum die Gliederung
der Berufe bestimmt, dann müssen wir
vor allem den Bau des industriellen Pro-
duktionssystems verstehen. An dieses Sy-
stem richten wir die Frage: ist es Werk und
Schöpfung des menschlichen Willens?
Diese Frage ist selbstverständlich inso-
fern zu bejahen, als es menschliche Taten
sind, ohne die die Systeme nie in die
Wirklichkeit eingetreten wäre. Aber dieser
Wille findet doch eine unübersteigbare
Schranke an der Eigenbeschaffenheit der
Stoffe und Kräfte, mit denen er es zu tun
hat. „ wird nur durch Gehorsam be-
siegt.“ Eben deshalb ist ja die Wissenschaft
von so grundlegender Bedeutung, die uns
über die Beschaffenheit der Stoffe und die Wir-
kungsweise der Kräfte unterrichtet: die Na-
turwissenschaft. So liegen denn die Anfänge
des industriellen Produktionssystems im
17. Jhdt. Aufkommen der rechnenden Natur-
wissenschaft. Es hat dann ein Jahrhundert
gedauert, bis die technische Auswertung
einsetzte. 1769 J. Watt. Aber von da an ist
11
es dann in unabsehbarer Folgerichtigkeit
und ständig sich steigerndem Tempo wei-
naturwis-
tergegangen bis zu den xxxxxx senschaftl.
Entdeckungen und technischen Erfin-
dungen, die uns heute den Atem verschla-
gen. Wie weit waltet in diesem Prozess
Freiheit? Wie weit ist er Werk des Willens?
Wir prüfen das Recht der Redensart
„Industrielle Revolution“. Die Geräusch-
losigkeit des Fortgangs. Der denkende u.
handelnde Mensch bewegt sich am Fa-
den der Sache entlang. Sein Wille ver-
stummt. Er folgt dem Sachgebot. Die
Sache führt ihn. Heutiges Beispiel. Die
Elektronentechnik und die Automati-
on. Nur Kraft dieser Folgsamkeit bil-
det sich das System der industriellen
Produktuion. Anders als der politische
Willensverband verdankt es seine Ge-
stalt der gehorsamen Anpassung an
die in der Natur sich bietenden Mög-
lichkeiten. Der Wille ist nicht unbetei-
ligt, aber er schrumpft zu dem Willen
zusammen, die Eigentümlichkeiten der
Sache theoretisch zu erkunden und prak-
tisch zu respektieren.
Auf diese Weise also ist das riesenhafte
und vielfach verzweigte Arbeitsgefüge
12
entstanden, aus dem sich die Gliederung
der Beute herleitet. Die durch die Sache
vorgezeichnete Arbeitsteilung zwingt
die Menschenin dies Fachwerk hinein.
Vielfach meint m an: die Sache ist des
Menschen Herr geworden. Spezialisierung,
Vereinseitigung. Der „Funktionär“, der „Robo-
ter“.
Demgegenüber ist festzuhalten: für dies
Gefüge ist nicht menschliche Willkür
verantwortlich zu machen, sondern der
Gehorsam gegen die in der Sache sich
bietenden Möglichkeiten und die aus
ihr sprechenden Aufforderungen. Diese
Möglichkeiten und Aufforderungen zu
vernehmen und sie auszuwerten be-
durfte es des denkenden Geistes, und der
wird in Tätigkeit gesetzt durch den Wil-
len, sich seiner zu bedienen. Die For-
scher, die Erfinder, die Organisatoren. +)
Trotzdem die weitverbreitete Empfindung:
dies alles ist über uns gekommen wie ein
Schicksal, wie eine unabwendbare Natur-
notwendigkeit. Wir sind die wehrlosen
Opfer!
Wir geben die Antwort, in dem wir auf
die gewichtigste unter all den Fragen hier
+) Nicht immer Verantwortliche - Schuldige suchen!
13
blicken, die die Entwicklung von Naturwis-
senschaft und Technik hat brennend werden
lassen. Die Kernphysik. Die Atomspaltung.
Die thermonuklearen Waffen. Ist das, was
heute im Gefolge dieser Erfindungen gesche-
hen kann und geschehen wird, durch Na-
turnotwendigkeit vorherbestimmt und
durch uns bloss zu exekutieren? Die Mensch-
heit am Scheidewege. Mehr denn je: Ent-
scheidung. Appell an den freien Willen.
Hier zeigt sich: alle Sachbeherrschung
ist Mittelbeherrschung. Die Zwecke zu set-
zen ist nach wie vor Sache des Willens.
Ungeheure Steigerung der Verantwortung,
die dieser Wille zu tragen hat. Und diese
Entscheidung ist nicht nur Sache der füh-
renden Staatsmänner. Wucht der Gesamt-
stimmungen, Gesamtmeinungen. Zusammen-
ringen unzähliger Teilströmungen. Anteil
auch der unzähligen Namenlosen. Demo-
kratie!
In diese gemeinsame Verantwortung
sind auch Sie alle einbezogen. Selbst
bei engster Spezialisierung einbezogen
in ein vom Geist geschaffenes Ganzes. Nie-
mals rein „mechanisches“ Tun. Und da-
zu an den Willensentscheidungen betei-
ligt, von denen die Nutzbarmachung
14
dieses Ganzen abhängt. Deshalb über
dem spezialisierten Tun das Ganze ver-
gessen, aus dem dies Tun seinen Sinn er-
hält und in das dies Tun hineinwirkt.
Wesen dieses Tuns: gebunden in der
Ordnung eines Ganzen, das nicht Werk
der Willkür, aber auch nicht Frucht der
Notwendigkeit, sondern Schöpfung des
organisierenden Geistes ist – frei
in den Fällen jener letzten Entscheidun-
gen, von denen die Verwendung dieses
Ganzen abhängt.
Gewissenhaftigkeit gegenüber der Sache
Handwerkerstolz!
Kameradschaftlichkeit gegenüber dem
menschl. Mitarbeiter!
Im kleinen Kreise dasselbe wie im
grossen.
Nur ein freies Wesen kann gewissenhaft
und kameradschaftlich sein. Der „Fleiss“ der
Herde
Biene, der „Gemeinschaftssinn“ der baulich
blind befolgt
ist Naturgebot, nicht Verdienst. Auch keine
„Liebe zum Beruf“.
V 0066b
1
Machtblöcke. Weltanschauungen. Die
„freie“ Welt. Gespräch.
Also: Problem. Unklarheit bei uns.
Philosophie und Zeitproblematik. The-
ma für Feierstunde.
----------------------------------------------------
Frage der Berufanwärter. Leistung
gefordert in Konsequenz der Berufswahl.
Freiheit der Berufswahl? Anlage
und Neigung. „Ständische“ Gesellschaft.
Dritter Stand. Moderner Staat und Ge-
sellschaft. Jetzt freie Entscheidung?
Vorbildung. Soziale und wirtschaft-
liche Lage. Tiefer: Verhältnis v. An-
lage und Sachforderungen. Illusionäre
Pädagogik. Prästabilierte Harmonie?
erfahrungen der Berufsberatung.
Motive. Disharmonie. Zwang in Be-
rufsentscheidung. Unfreiheit!
-------------------------------------------------
Korrektur: Plastizität.
Grundsätzlich: Wer übet den Zwang aus?
Gesellschaftl. Verhältnisse, also: Wille. Su-
che nach den „Verantwortlichen“. Vorwürfe
der östl. Ideologie.
Vordringen zum Tiefsten. In welchem
Masse Wille?
-------------------------------------------------------
2
In Wirtschaftsleben. Seine Zweige. In-
dustrielle Produktion – Technik – Natur-
wissenschaft. Handel sekundär. Wie
weit Wille?
Grenze: Eigenbeschaffenheit der Stof-
fe und Kräfte. Parendo! 17. und 18. Jhdt.
Folgerichtigkeit des Fortgangs. „In-
dustrielle Revolution“? Sachgebot ! Heu-
te: „Automation“. Anpassung, nicht
freie Gestaltung. „Wille zur Sache“.
So entsteht das industrielle Arbeits-
gefüge. „Apparat“. Arbeitsteilung.
„Funktionär“. Grenze des Willens, Nicht
die „Verantwortlichen“ suchen!
---------------------------------------------------
Empfindung der Schicksalhaftig-
keit. Zurückbleiben.
Gegenbeweis: die Kernfrage des
sog. „Atomzeitalters.“ Thermonukle-
aren Waffen. Scheideweg. „Sachen“ sind
„Mittel“. Zwecksetzende Freiheit. Ab-
glanz auch in spezialisierter Berufs-
tätigkeit. Nie „mechanisch.“! Geist.
Das Ganze sehen! Gebunden u. frei.
Gewissenhaftigkeit und Kamerad-
schaftlichkeit. Sprache! |