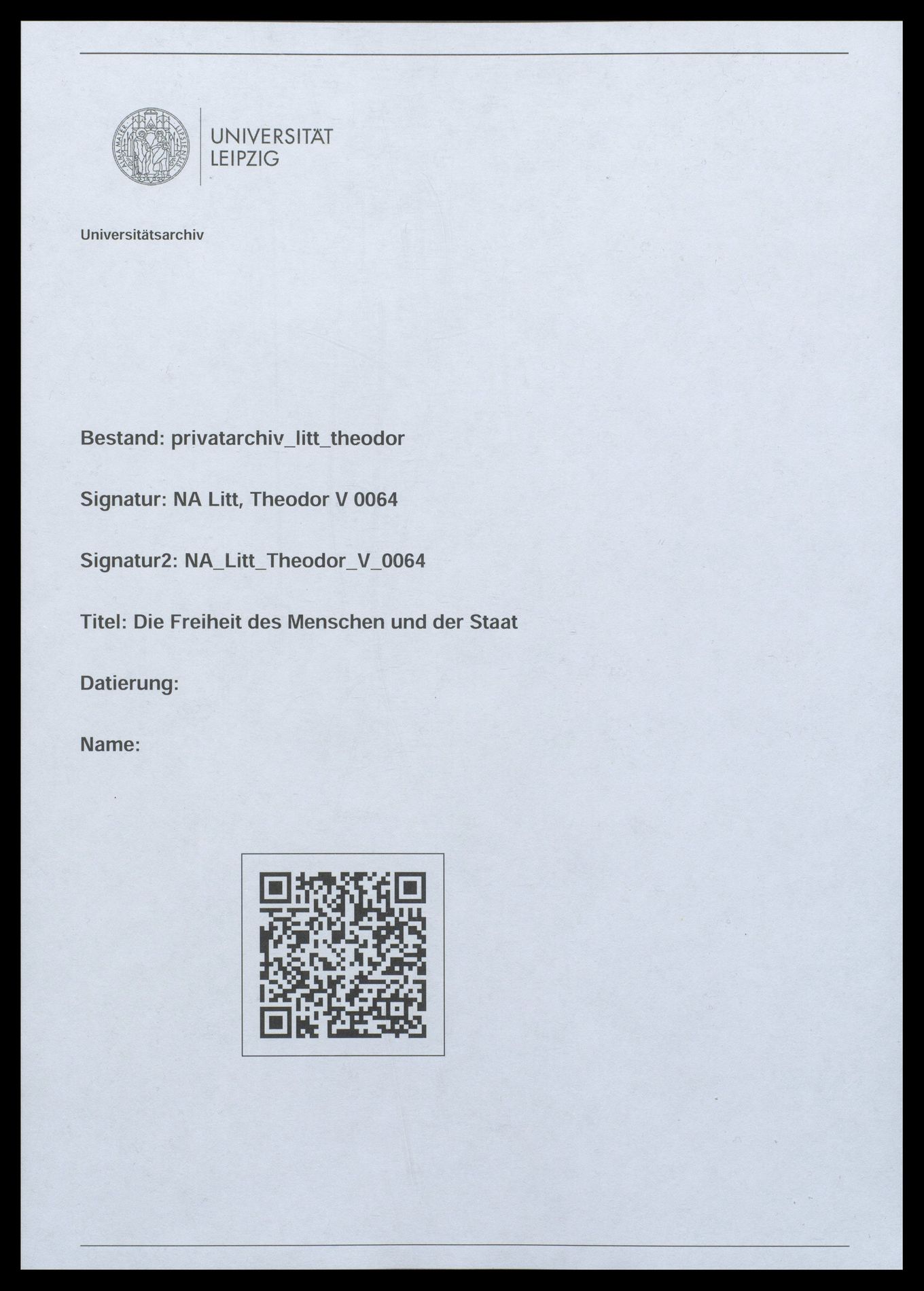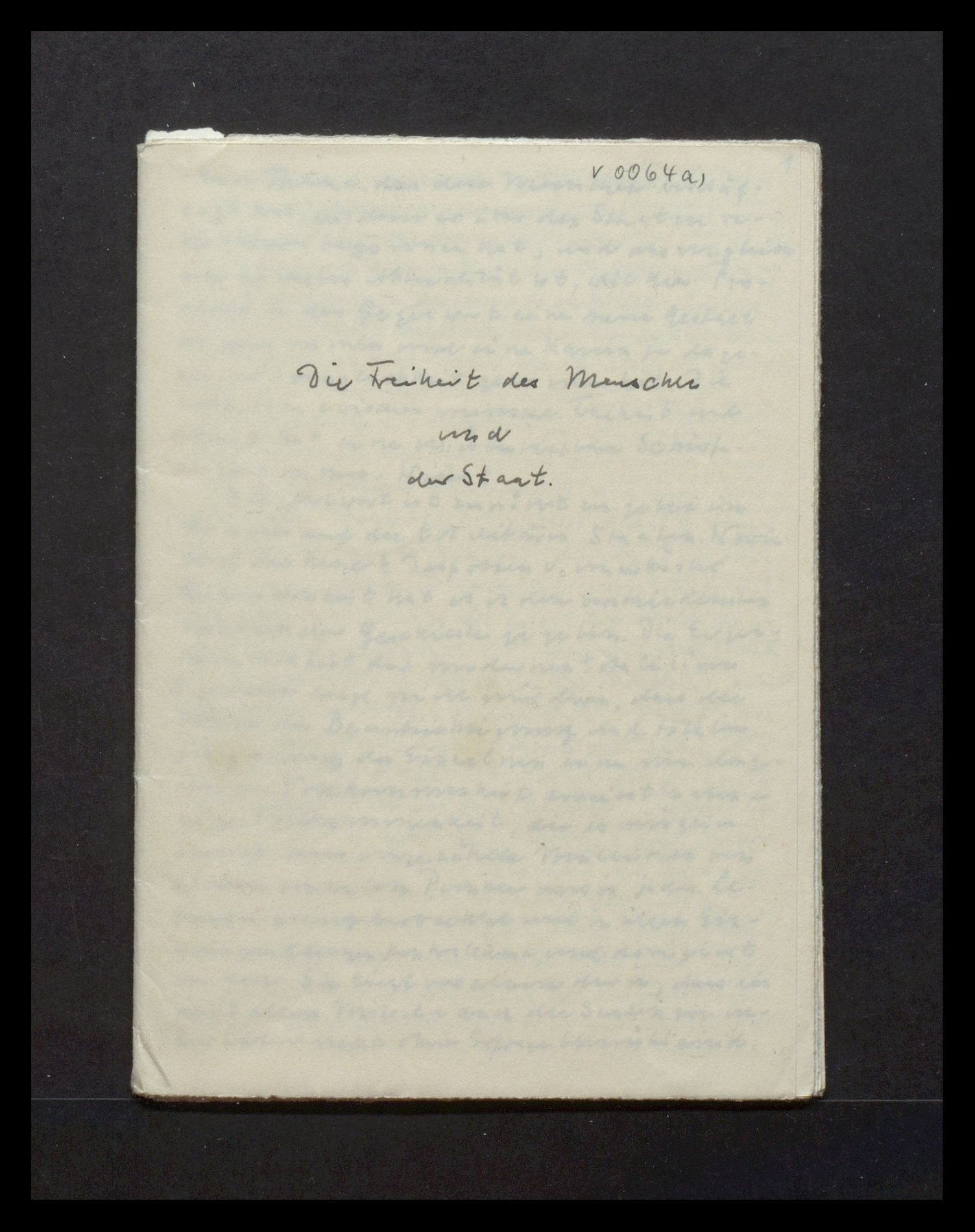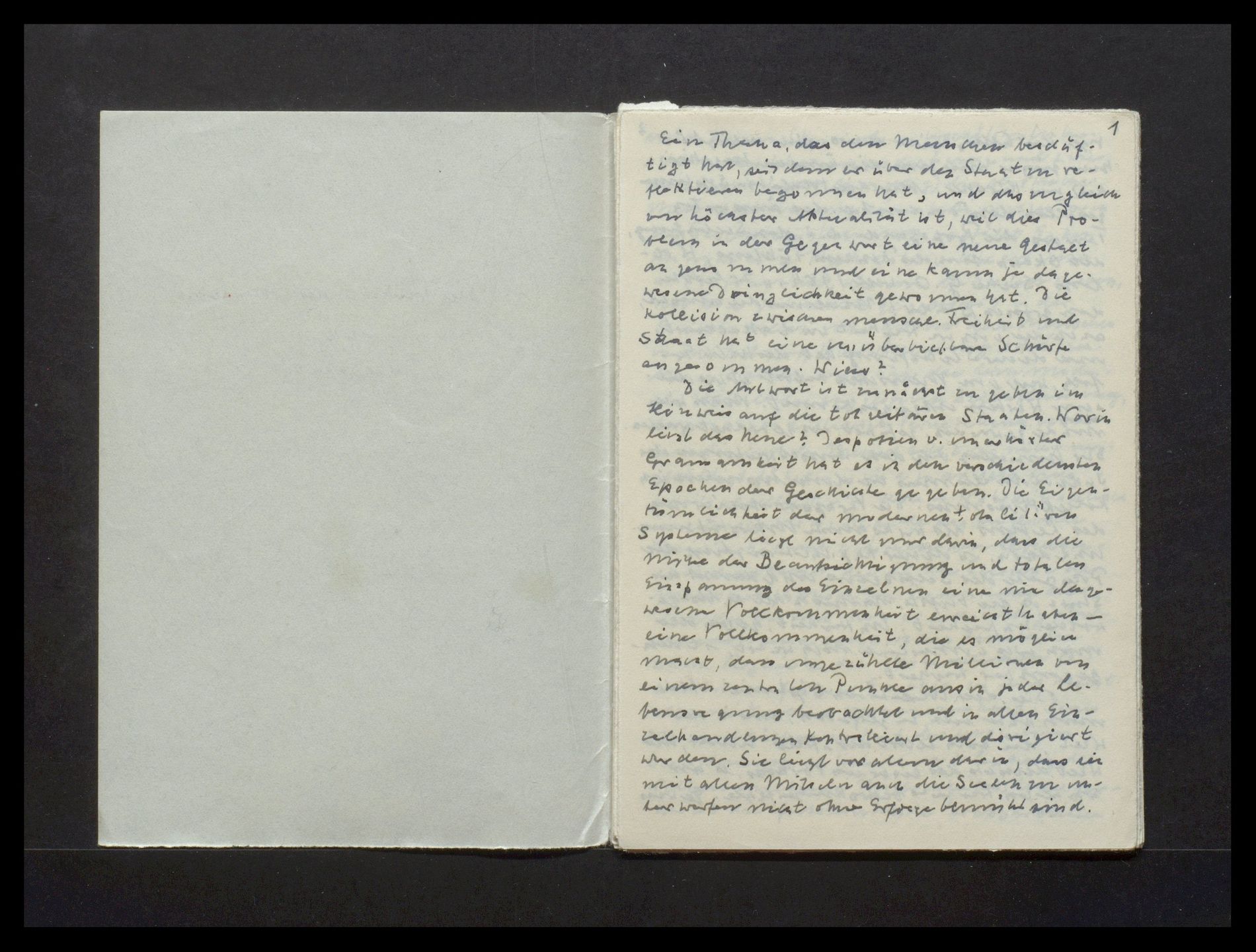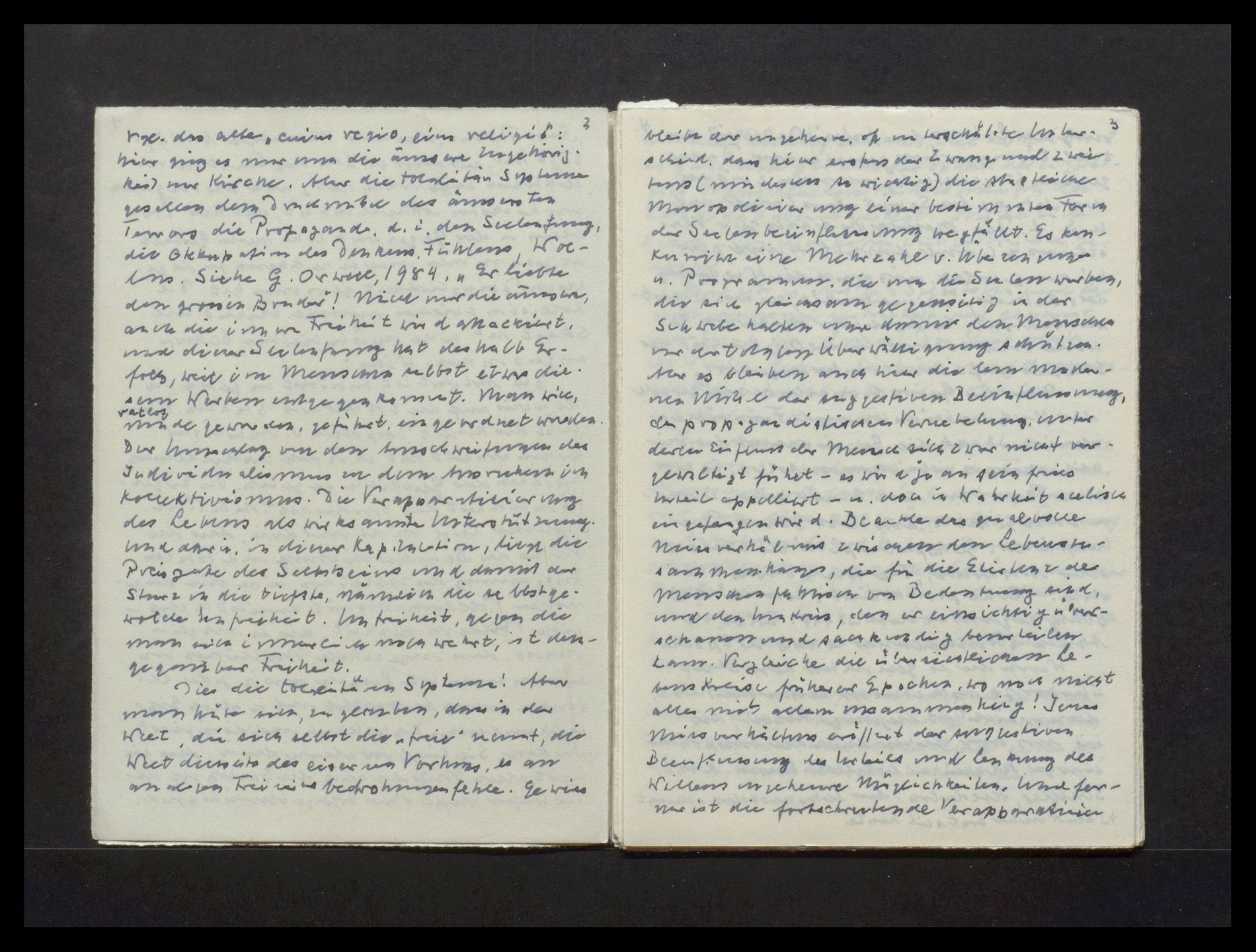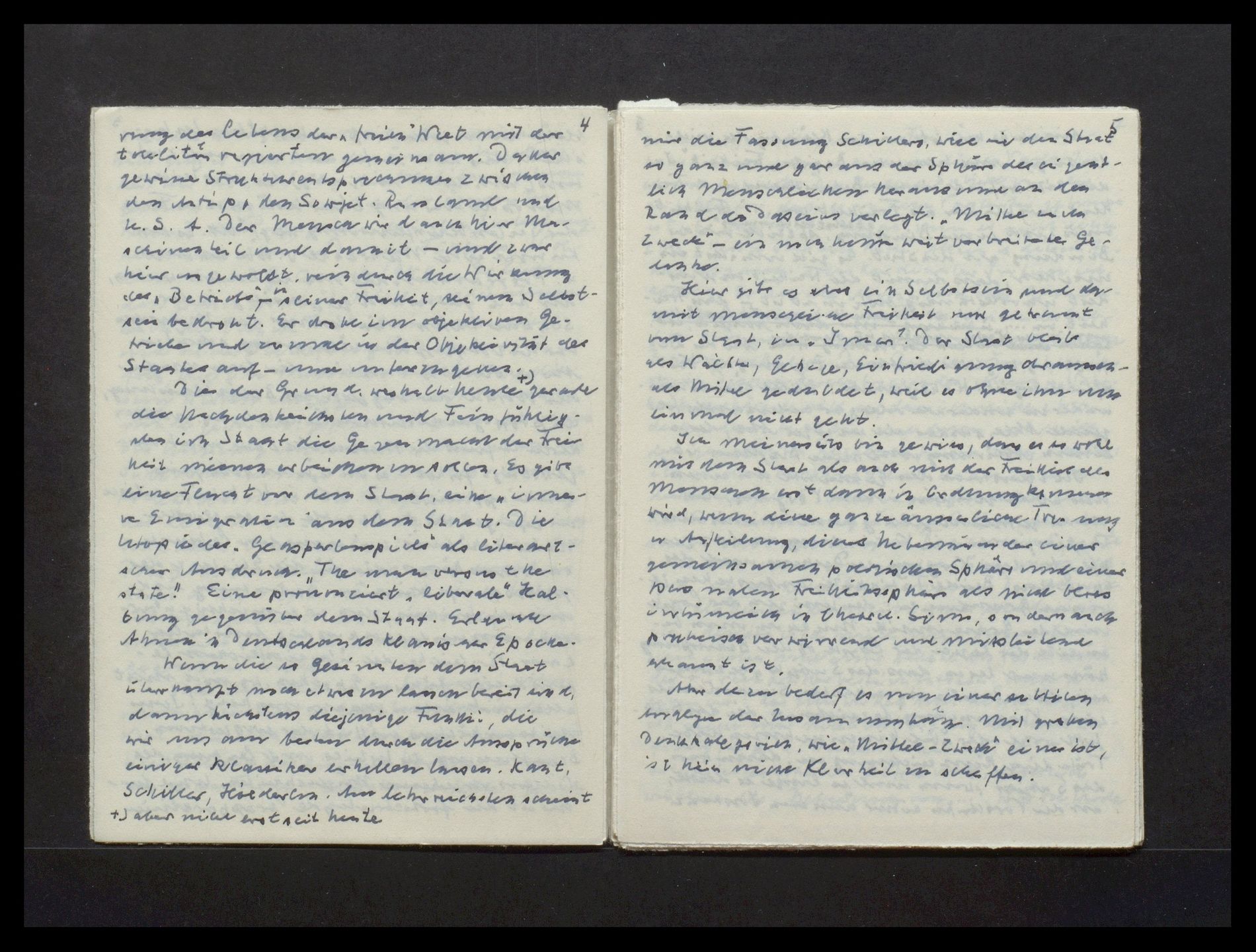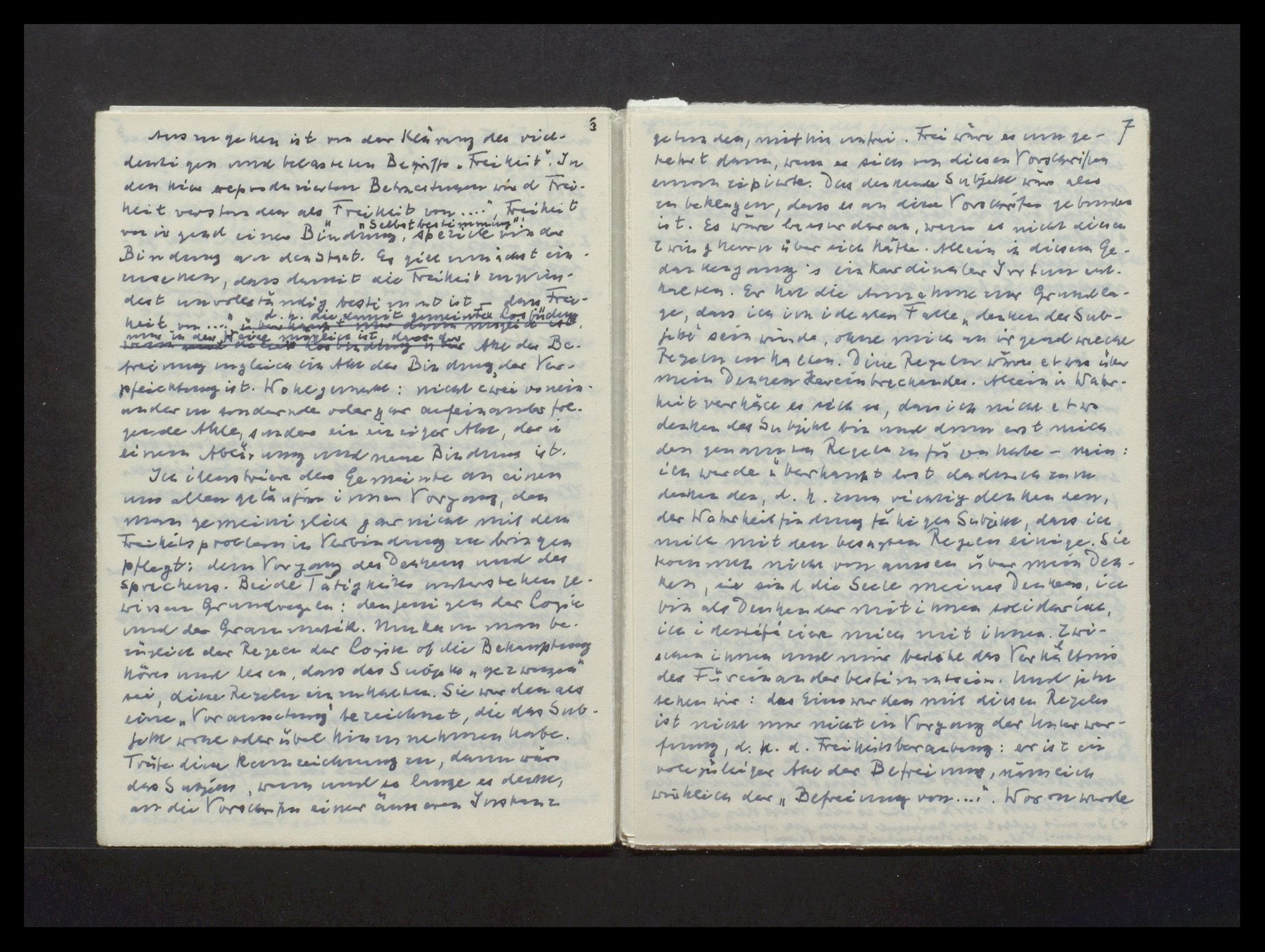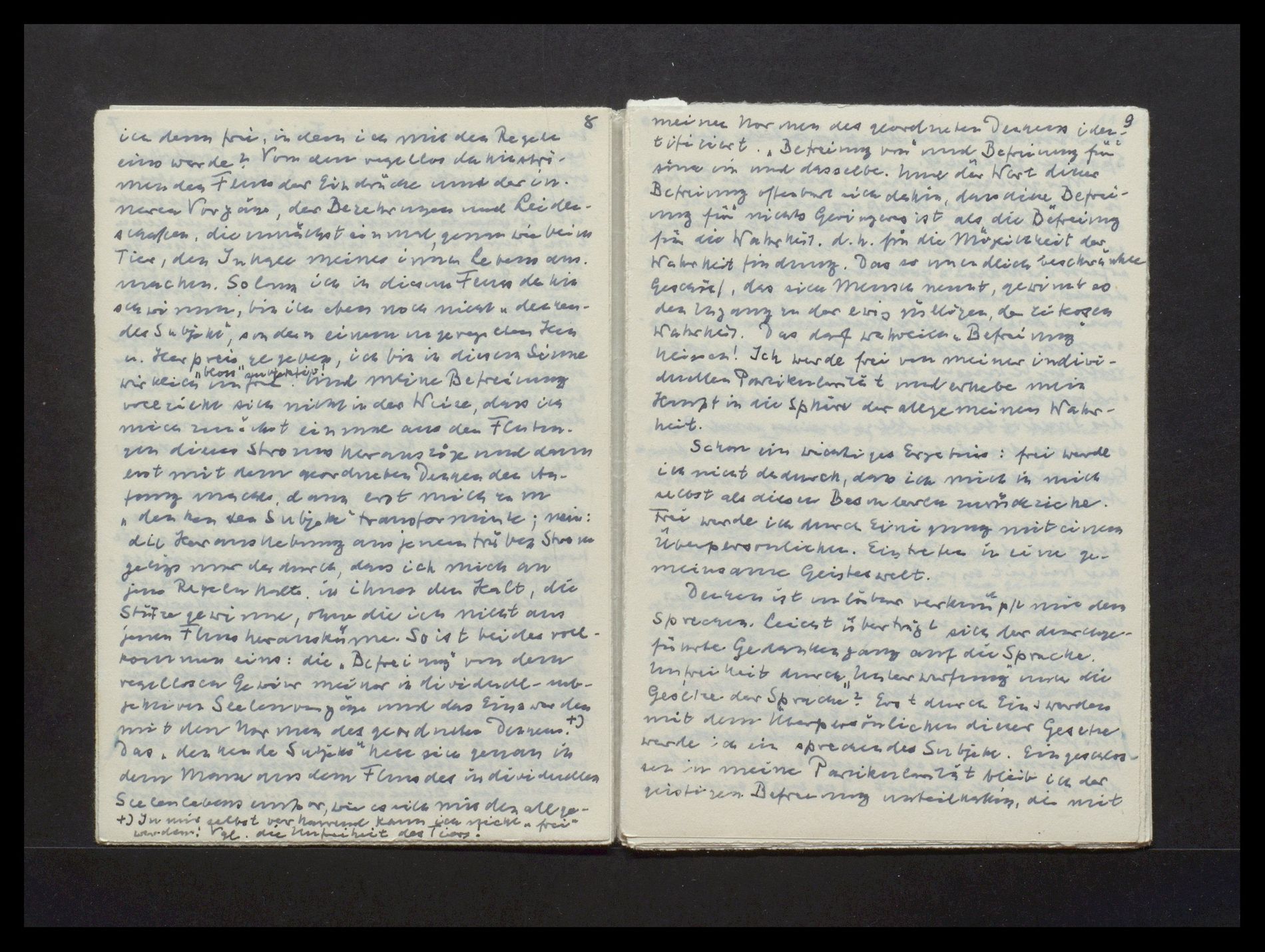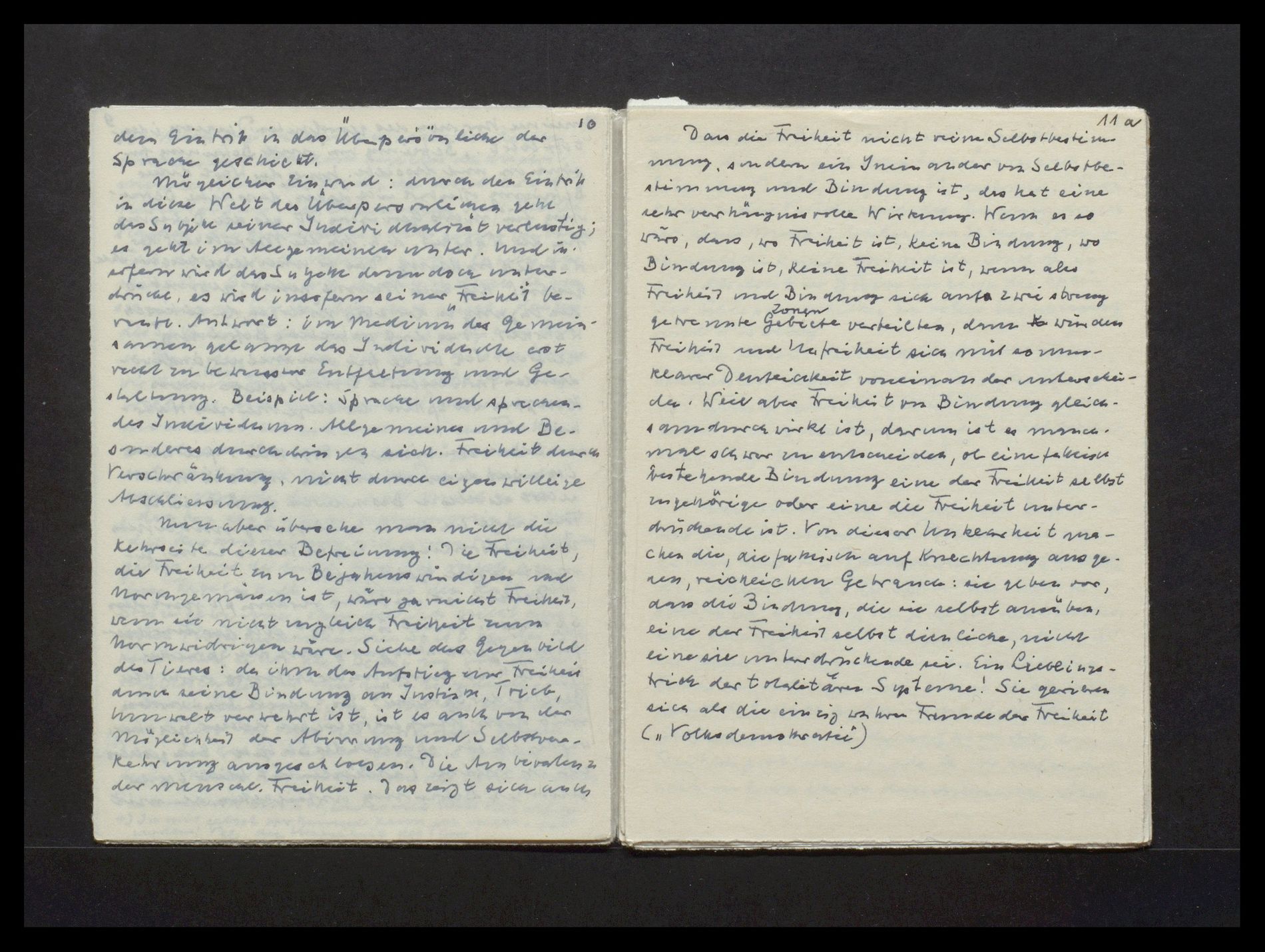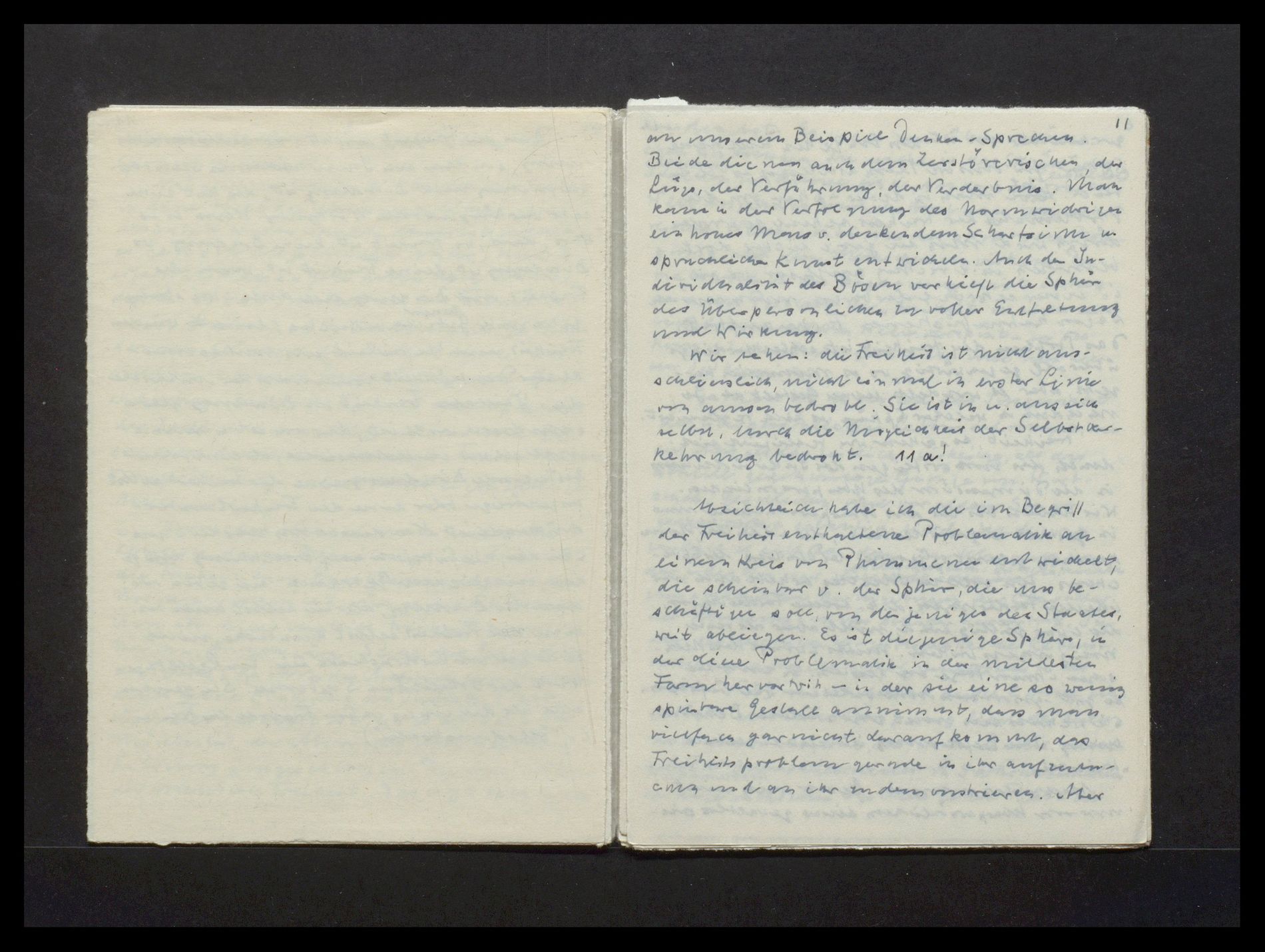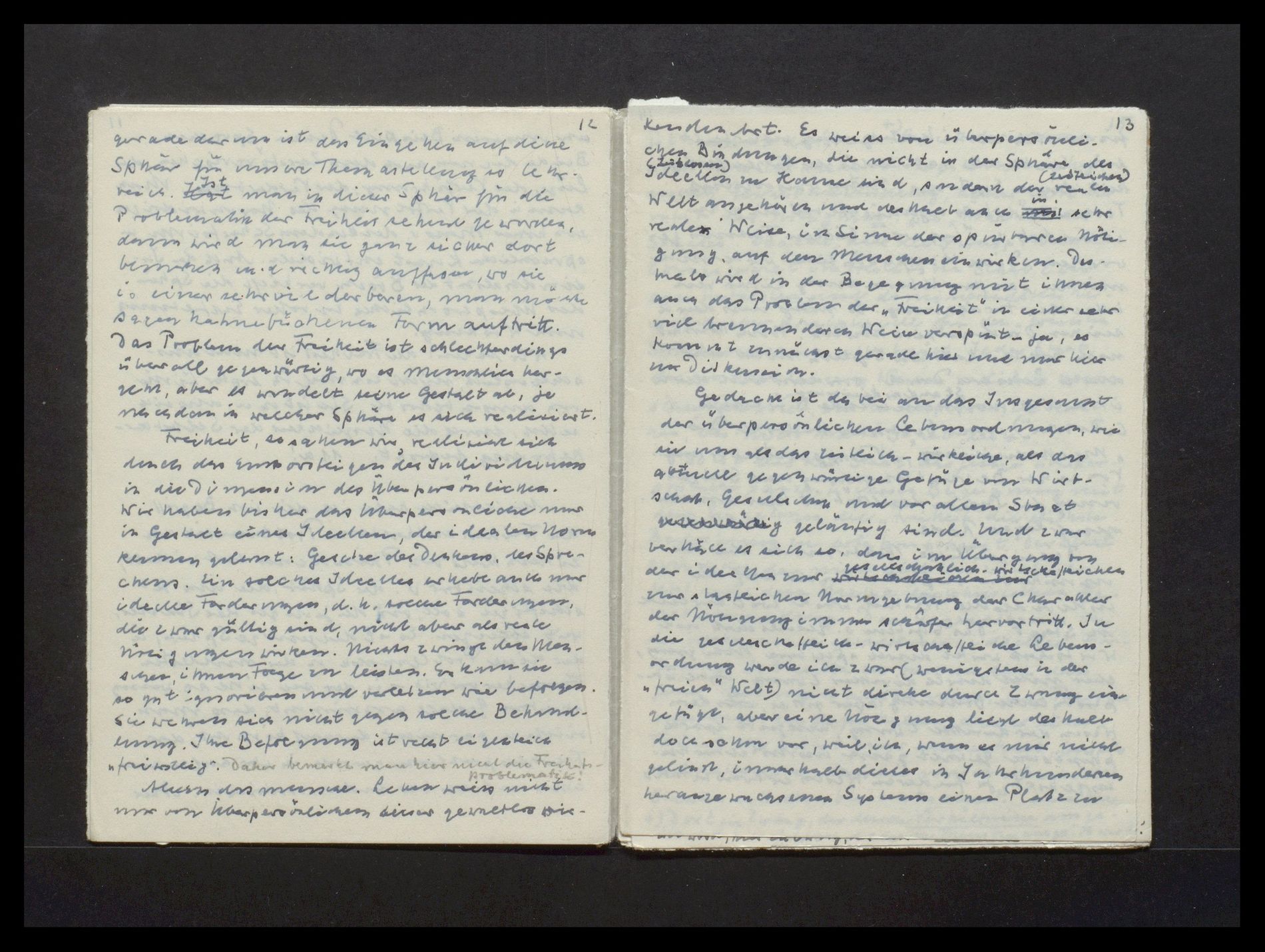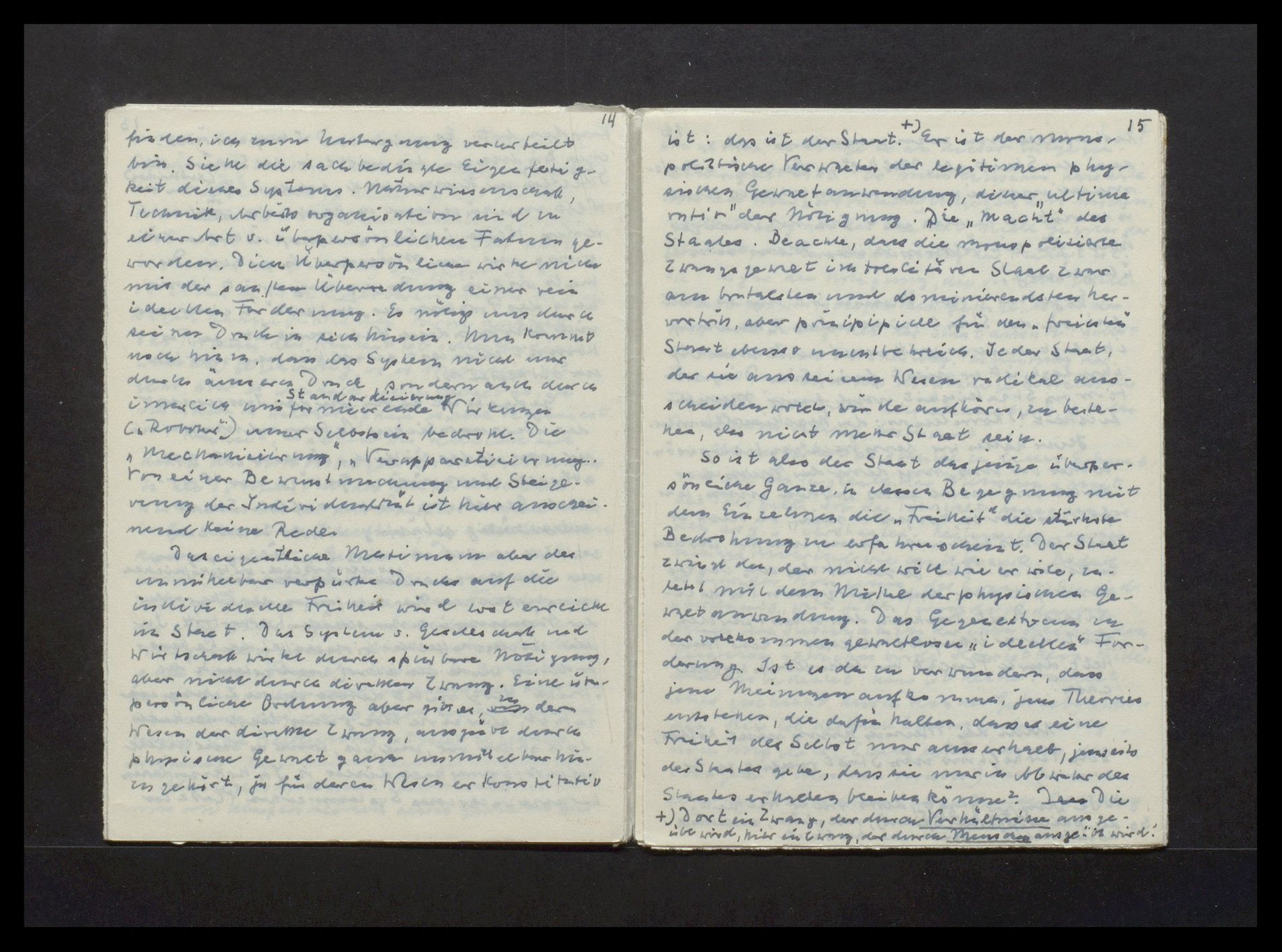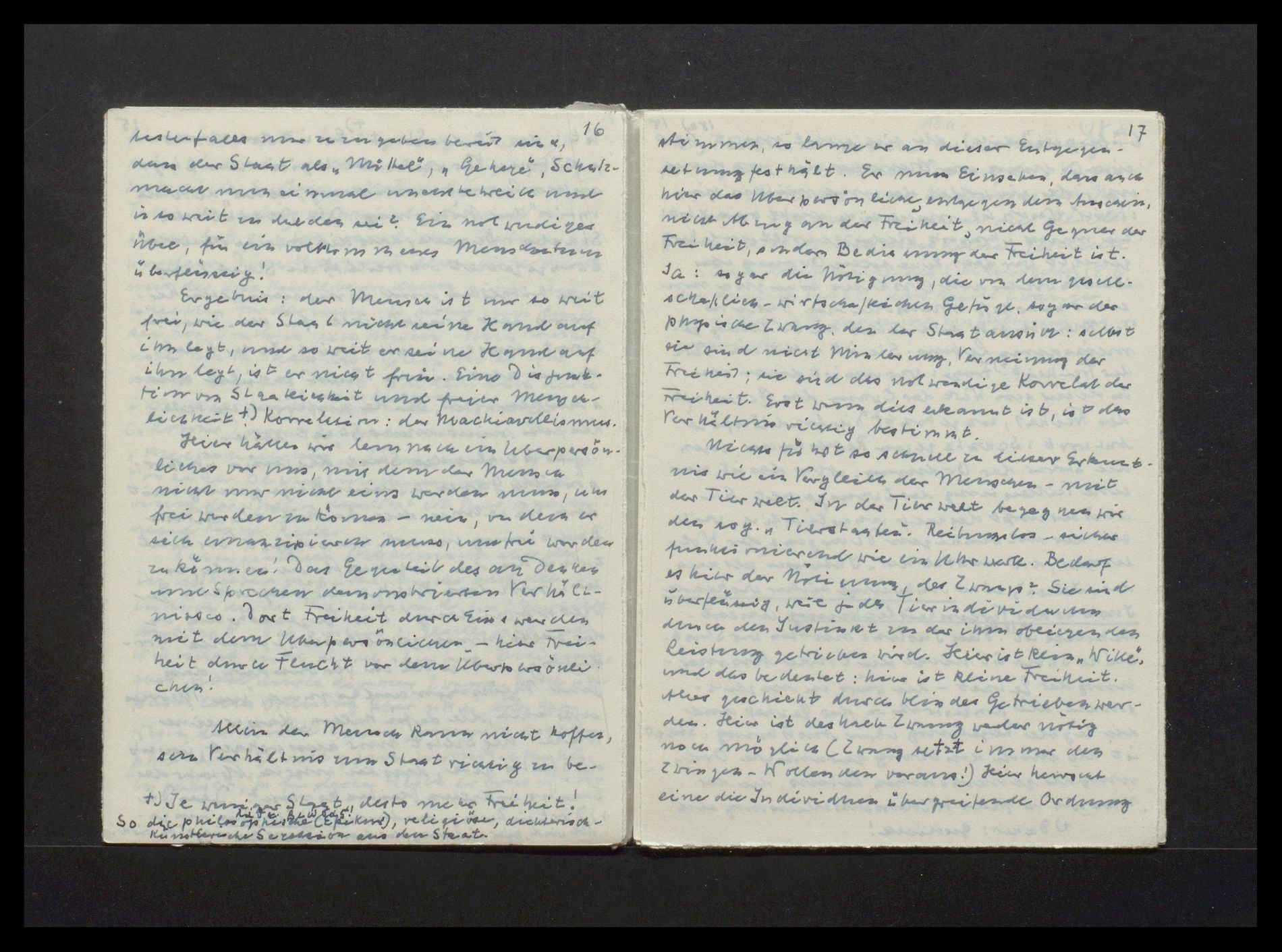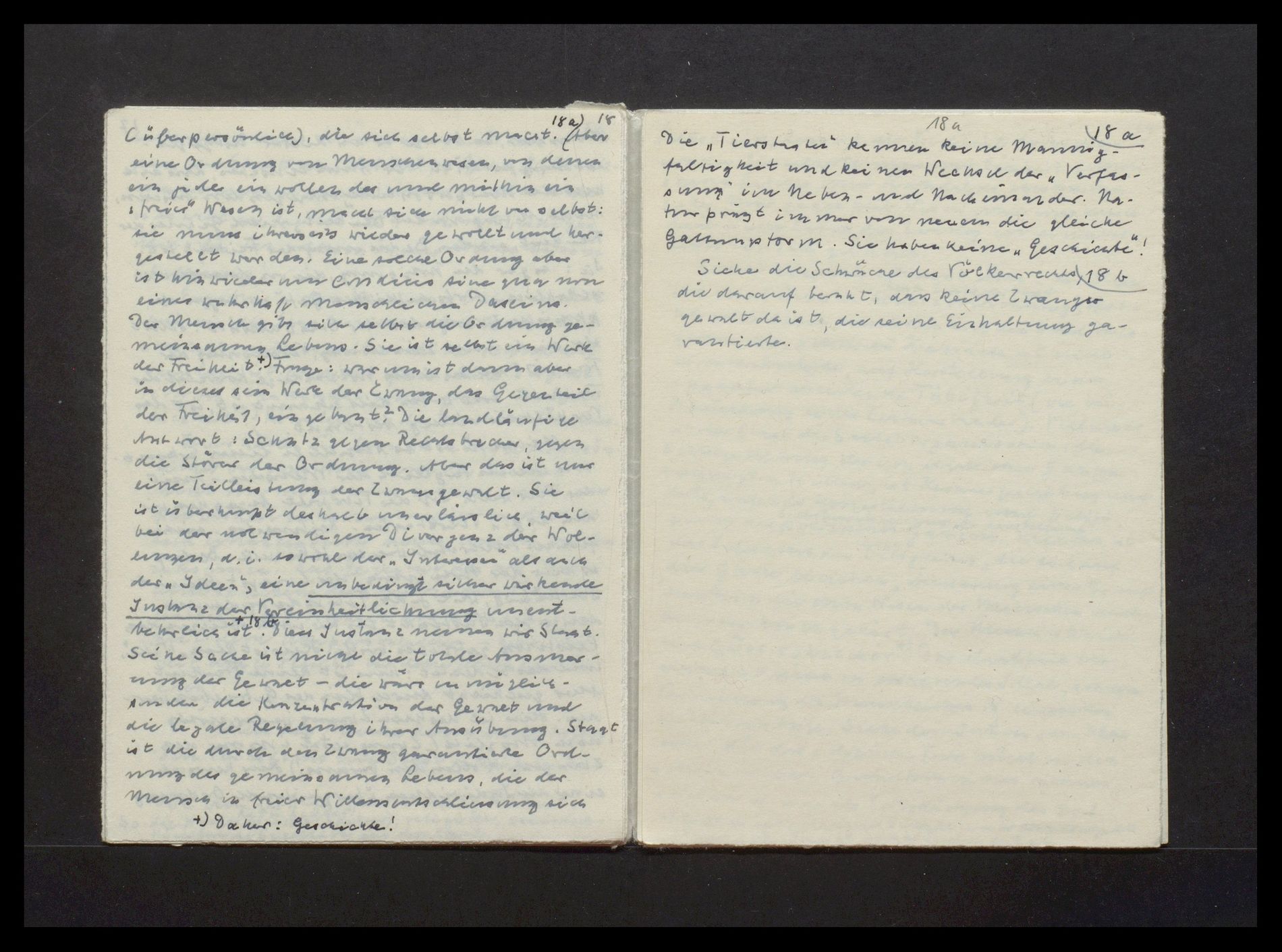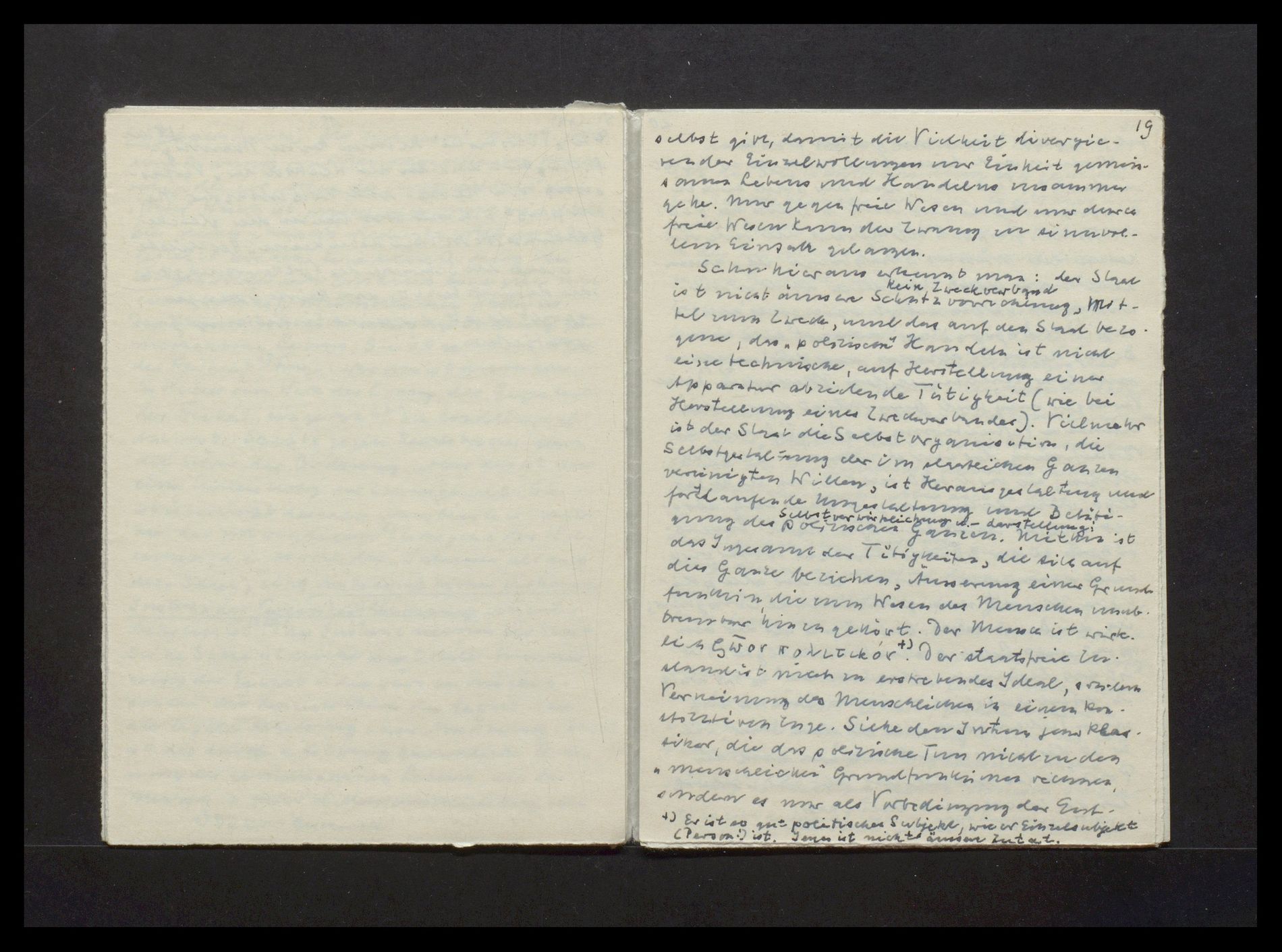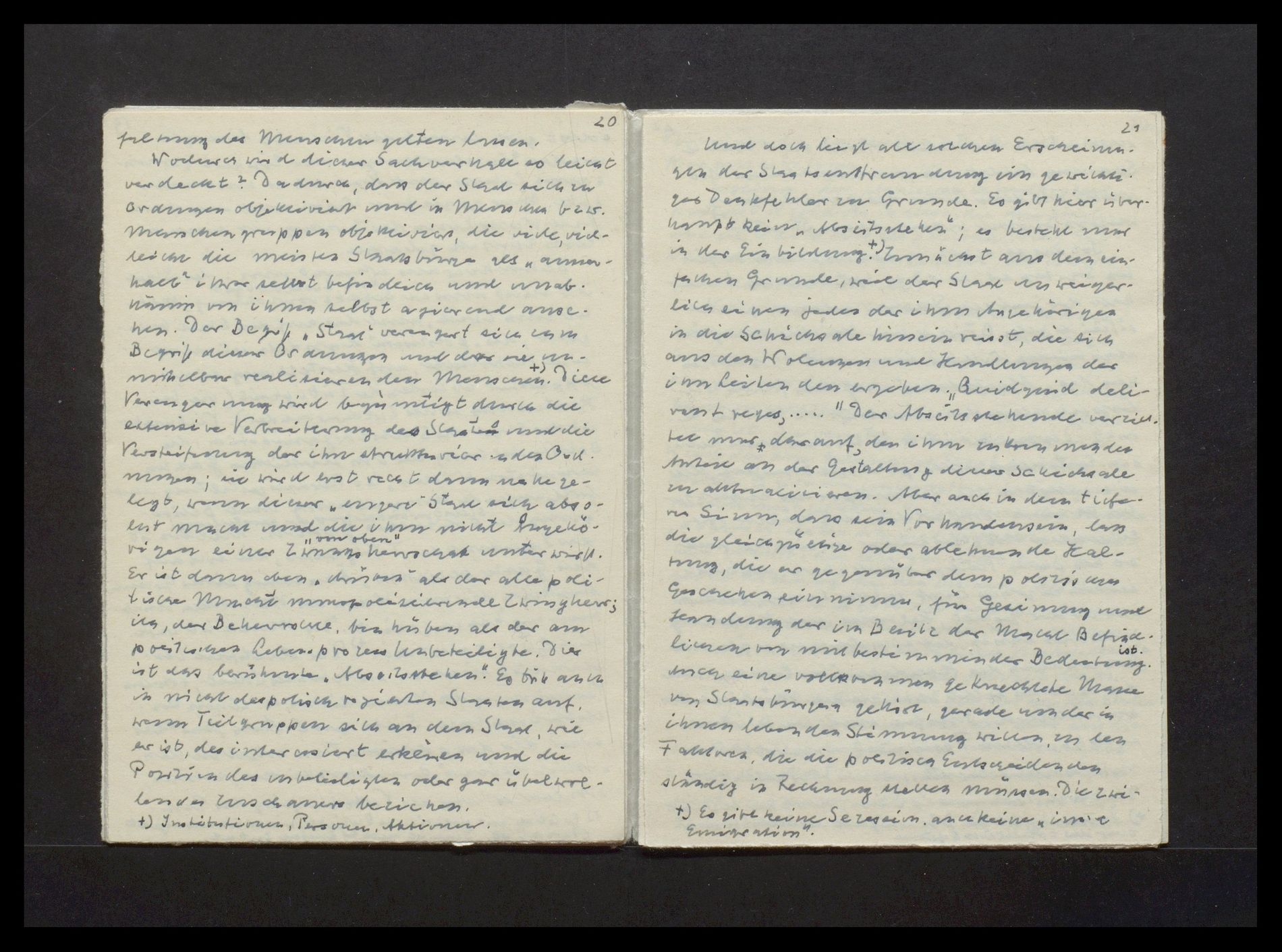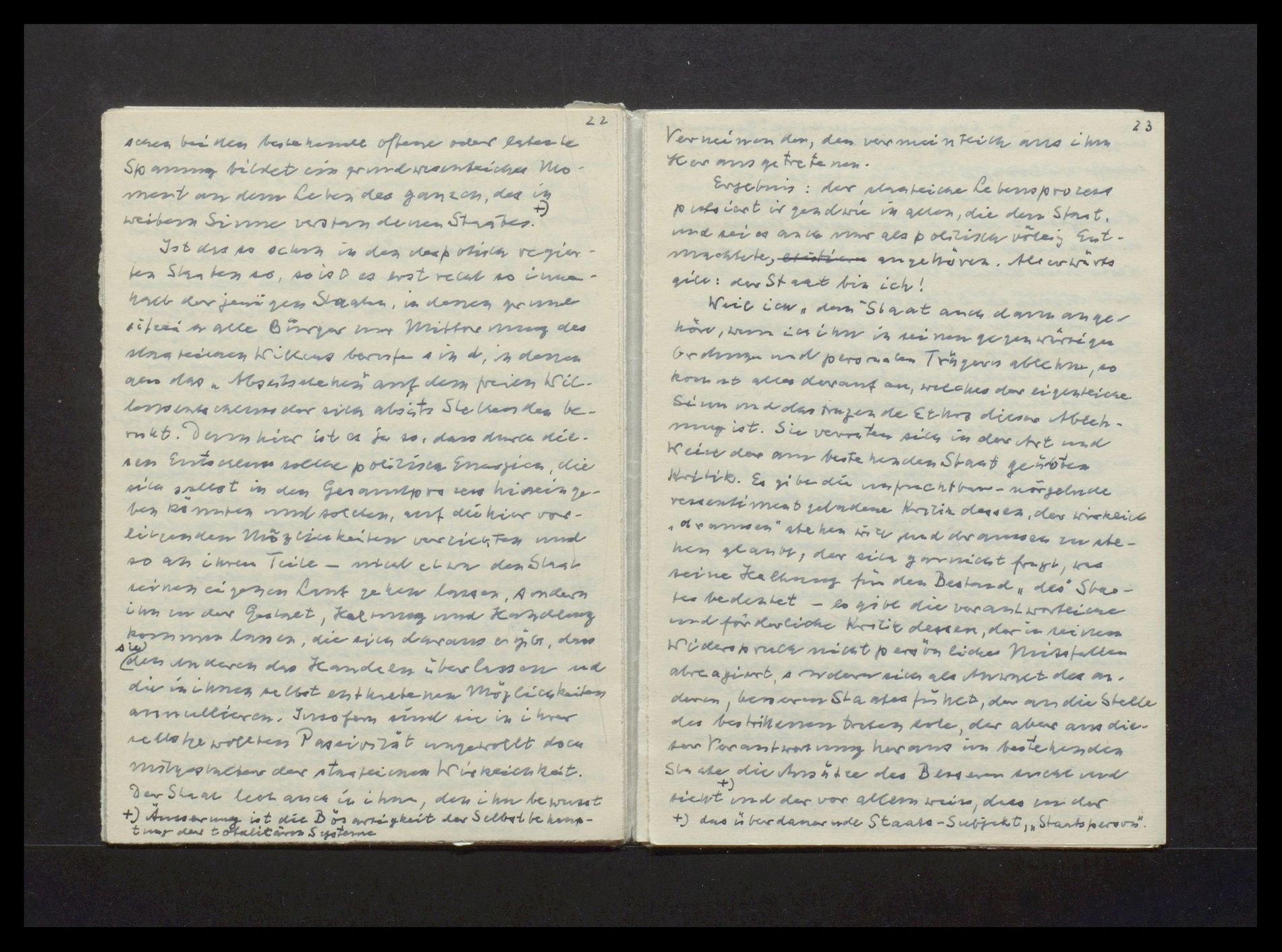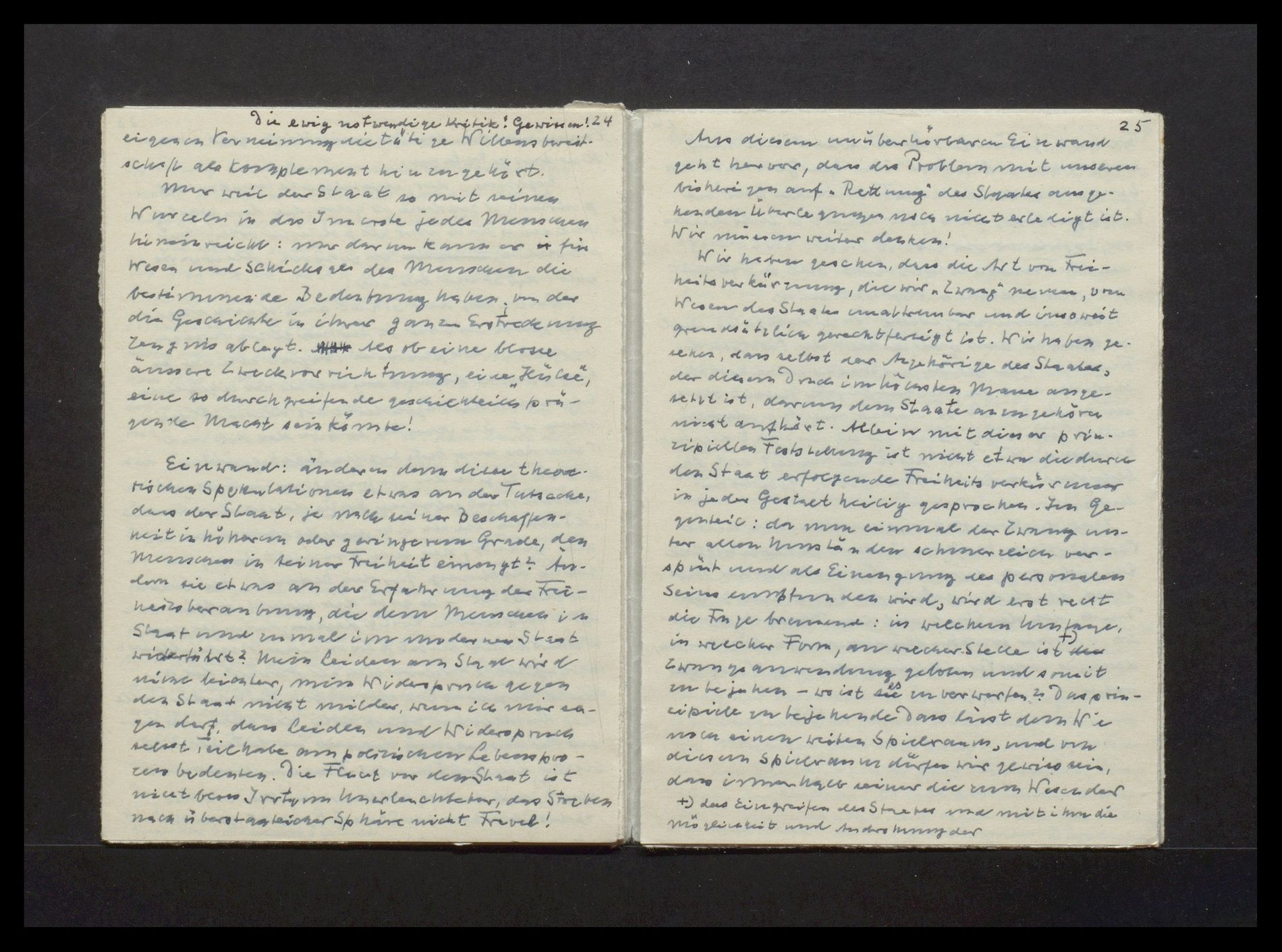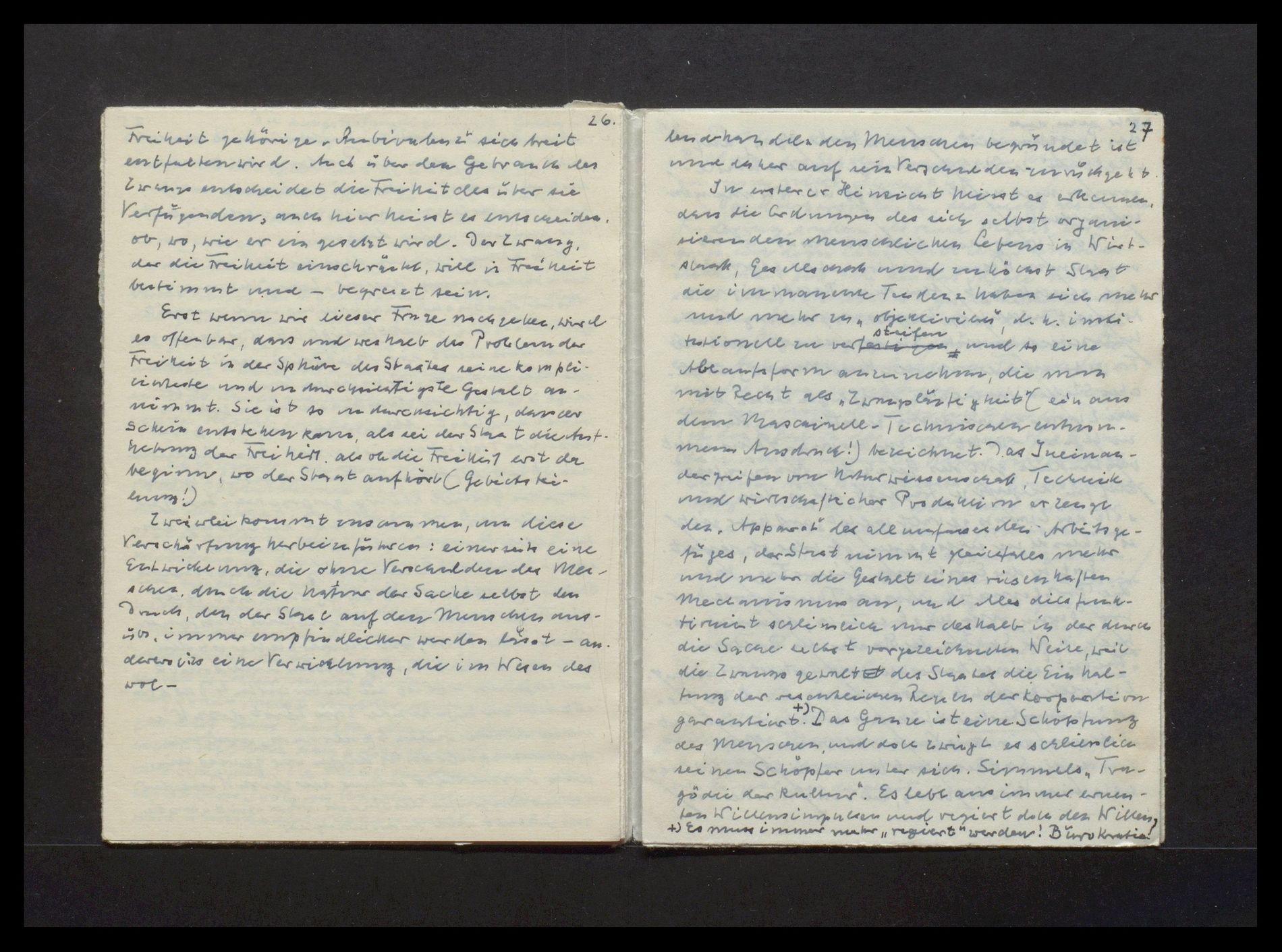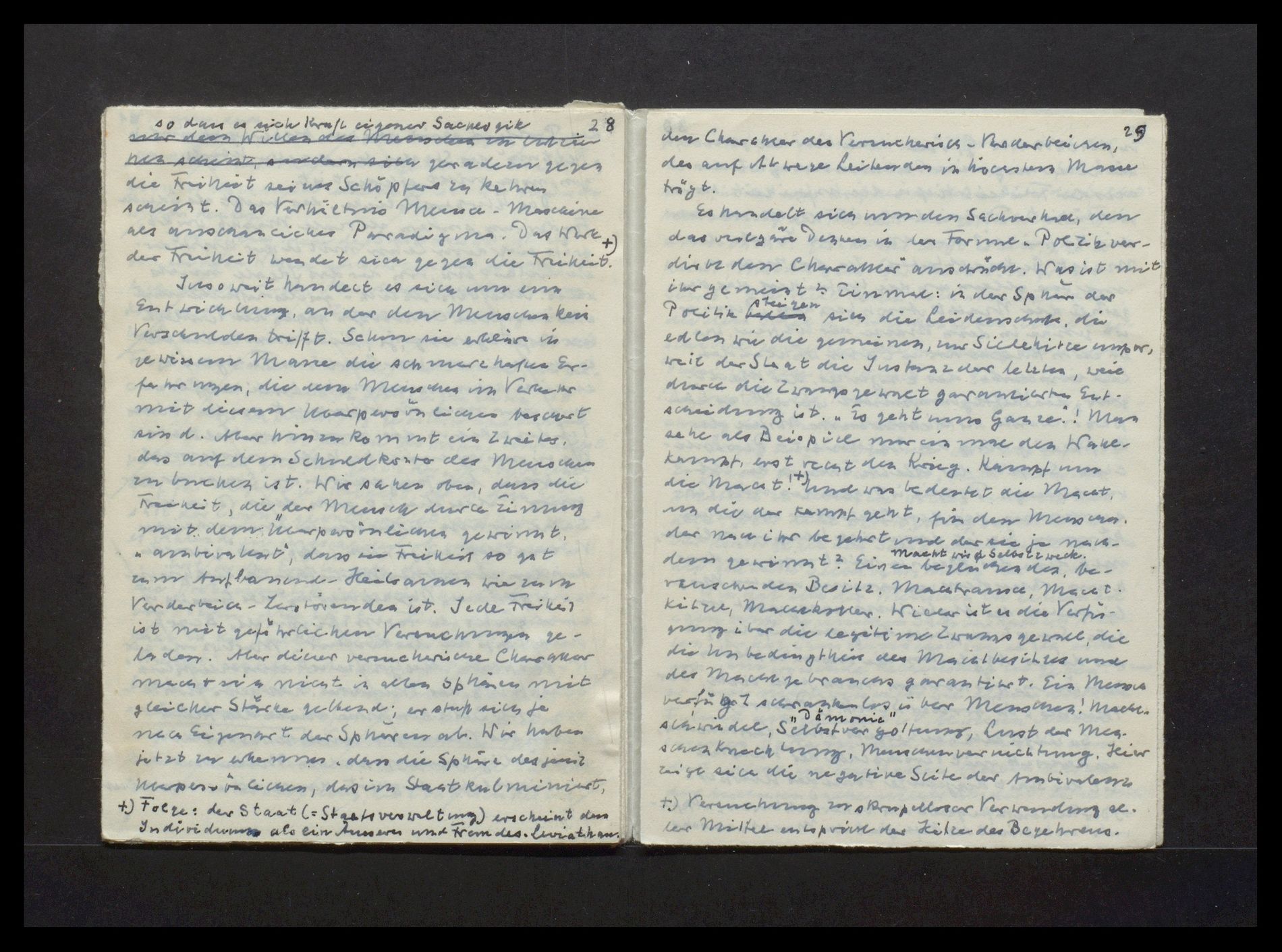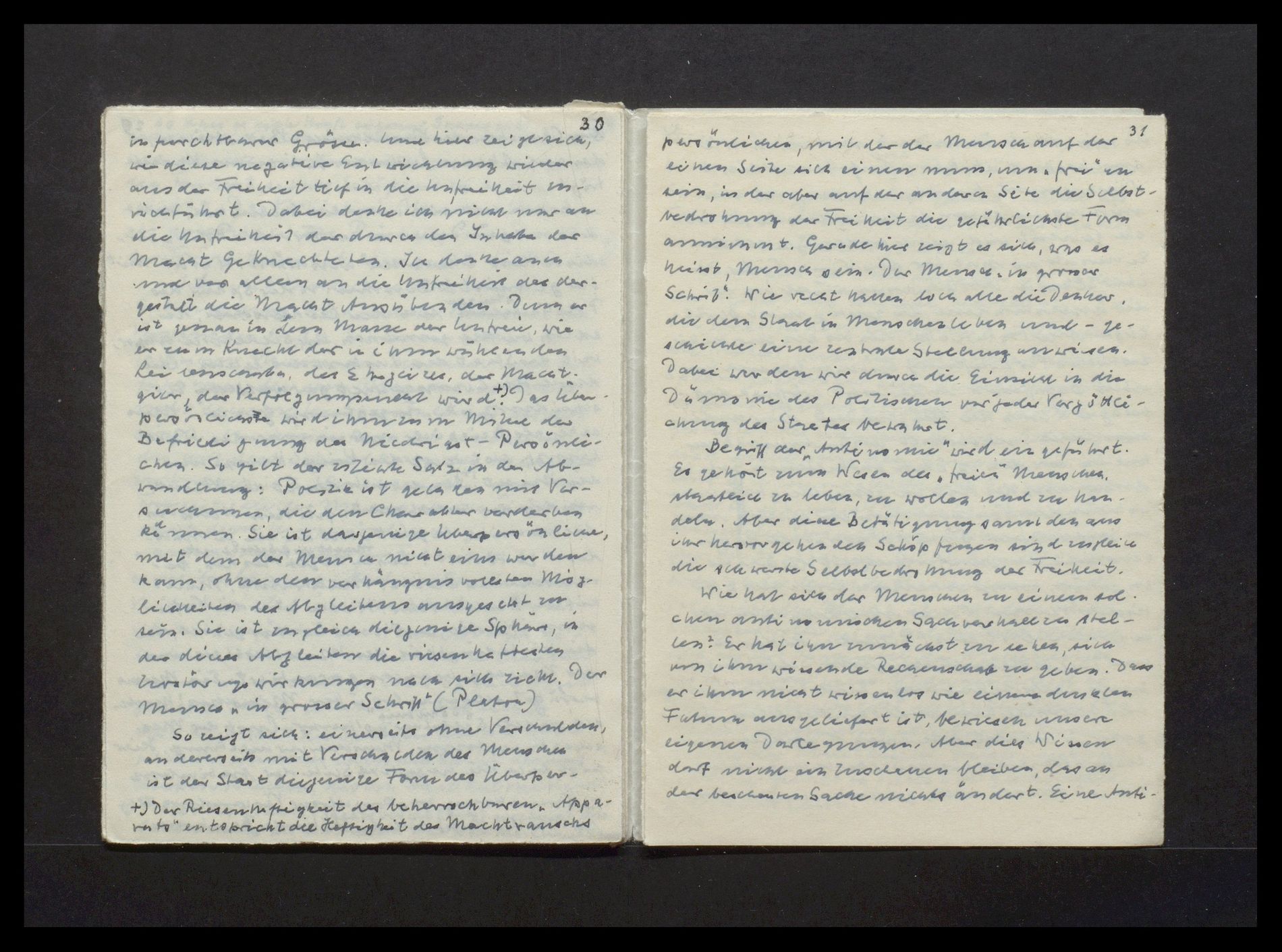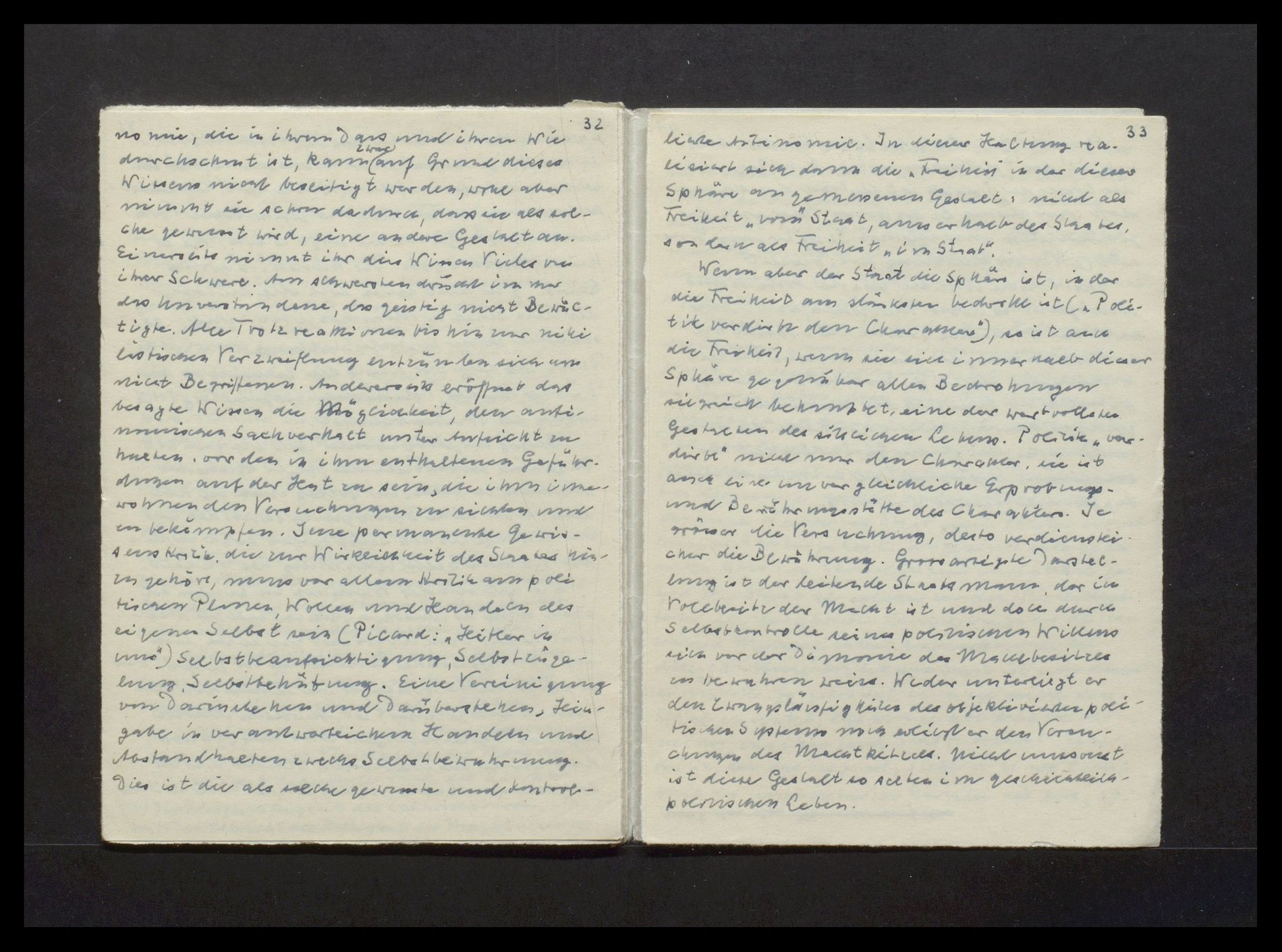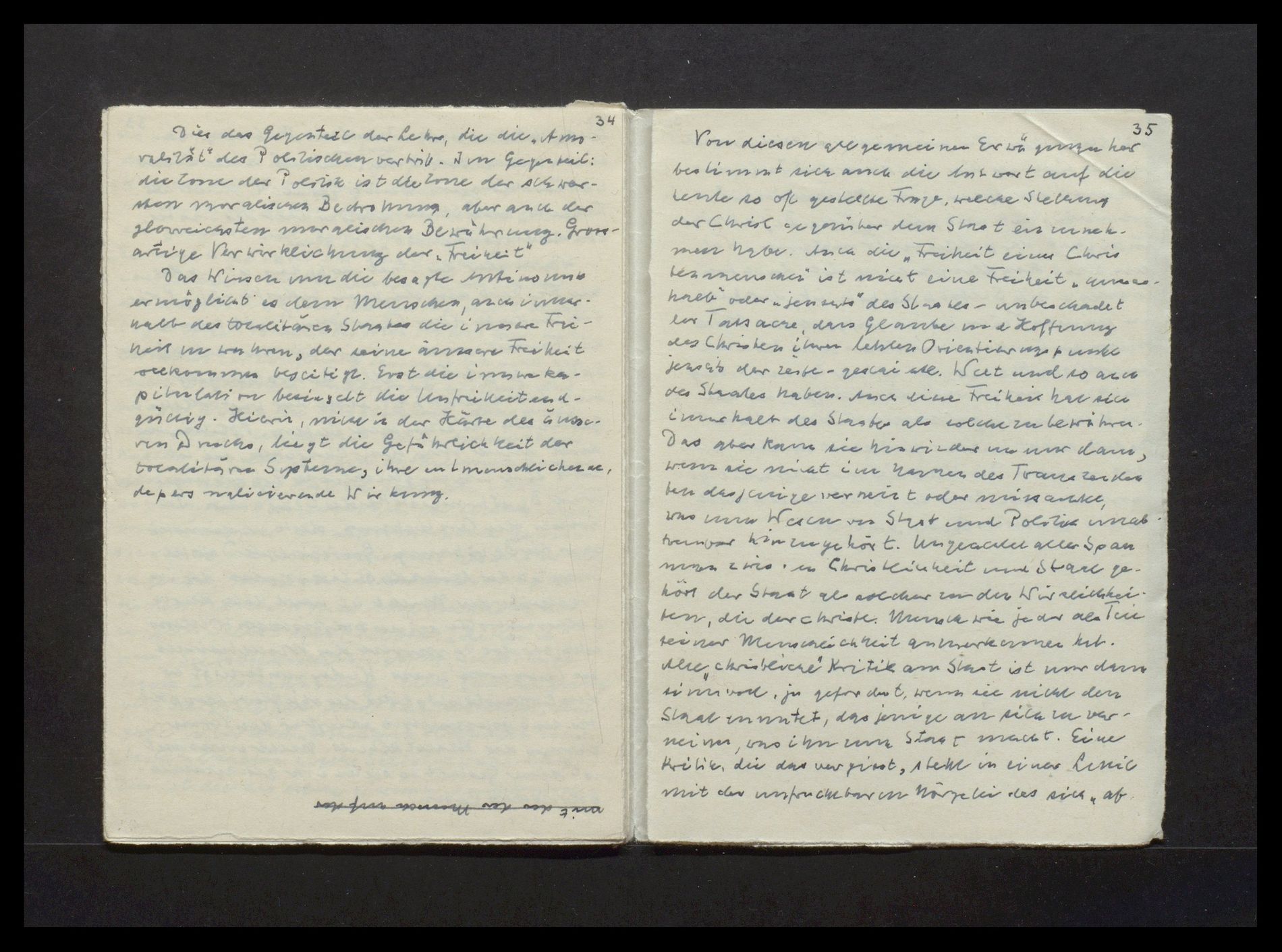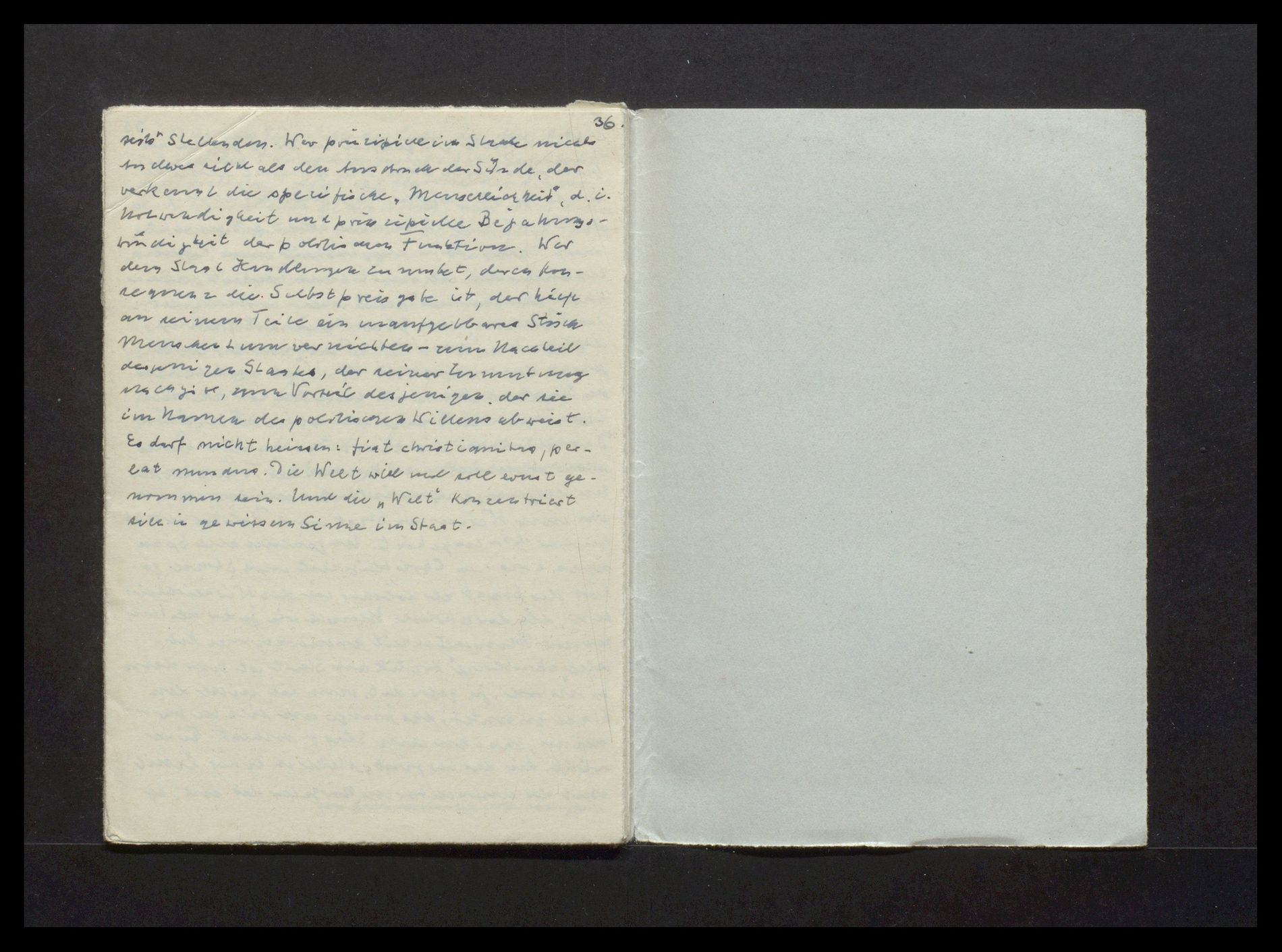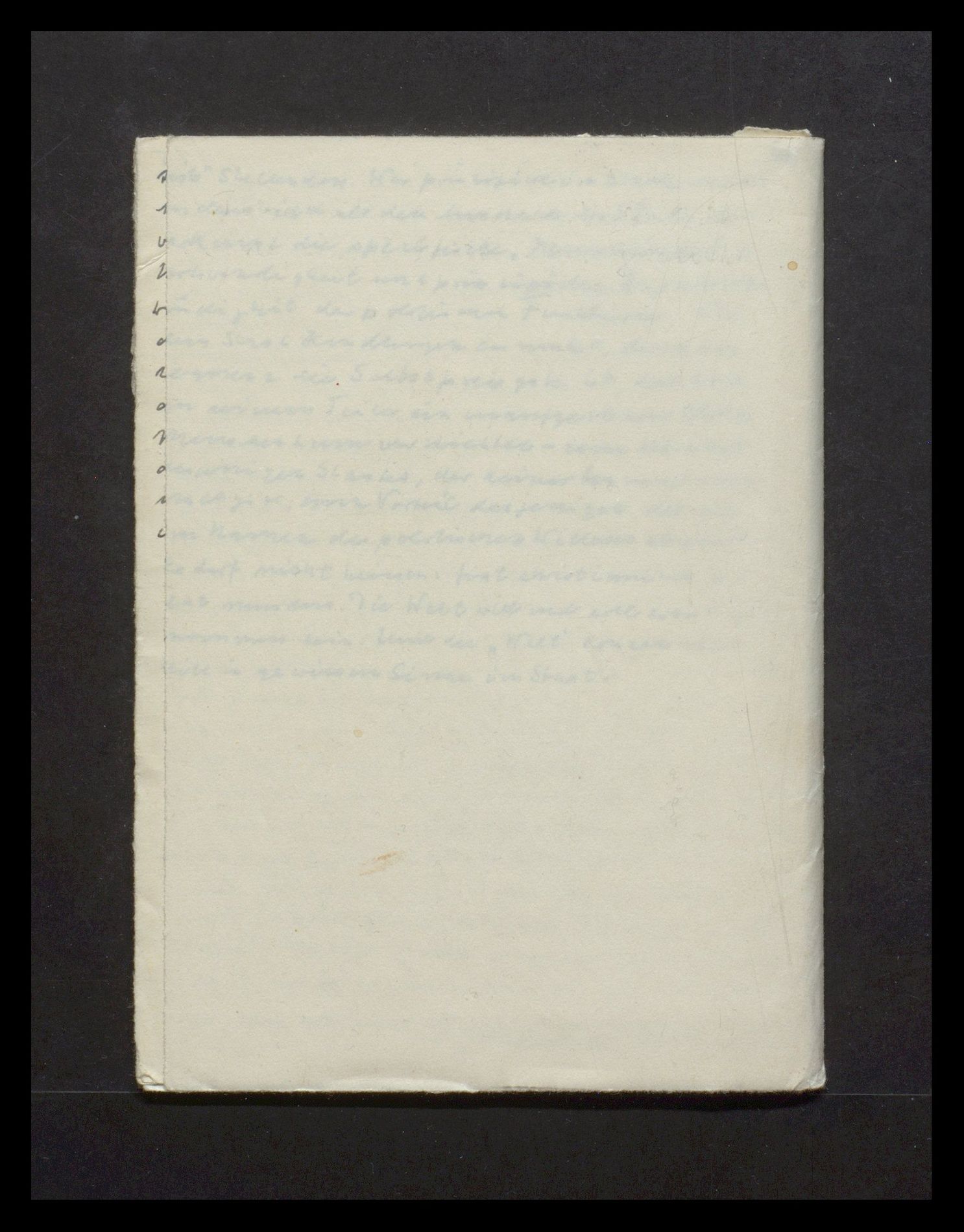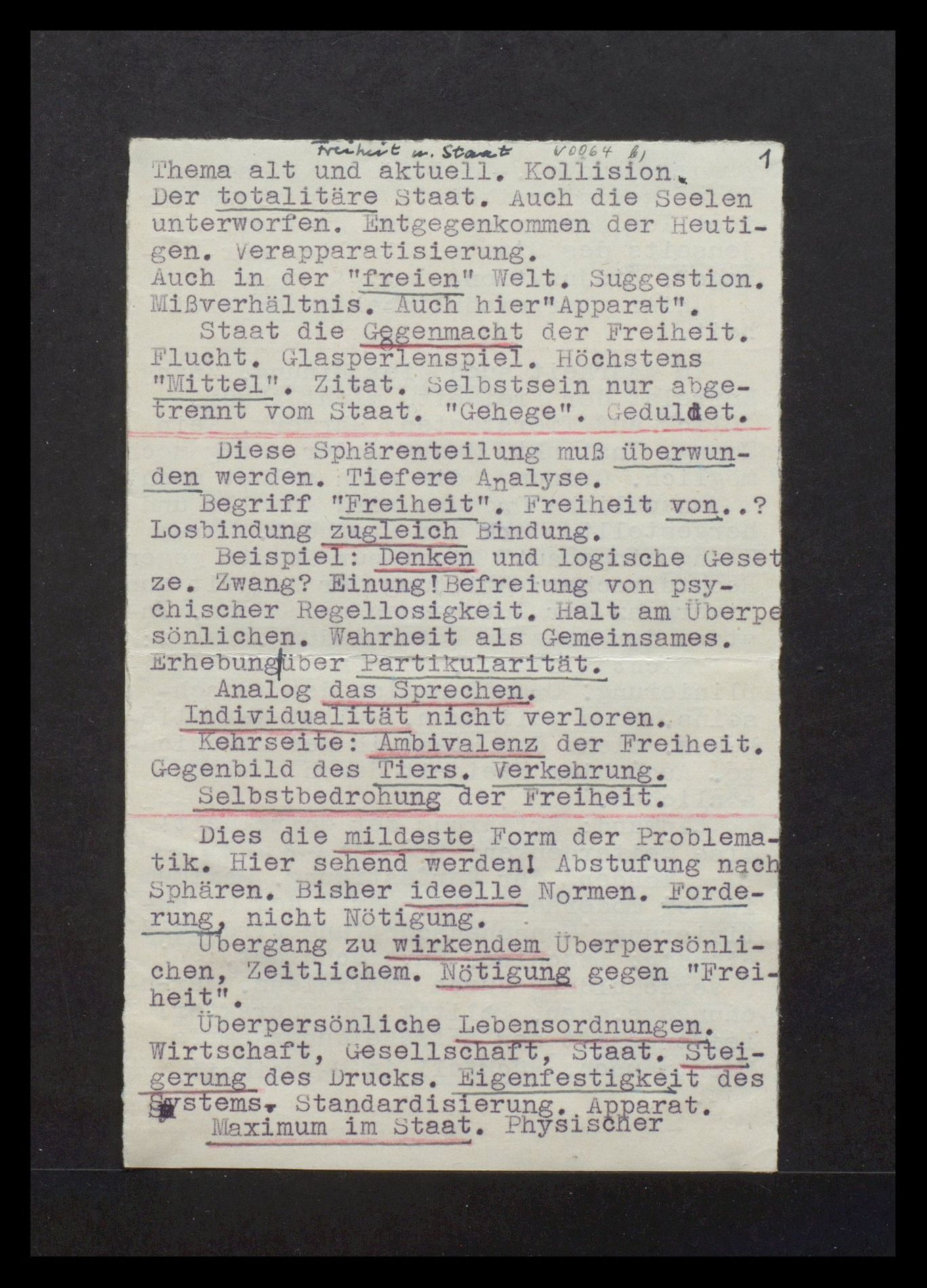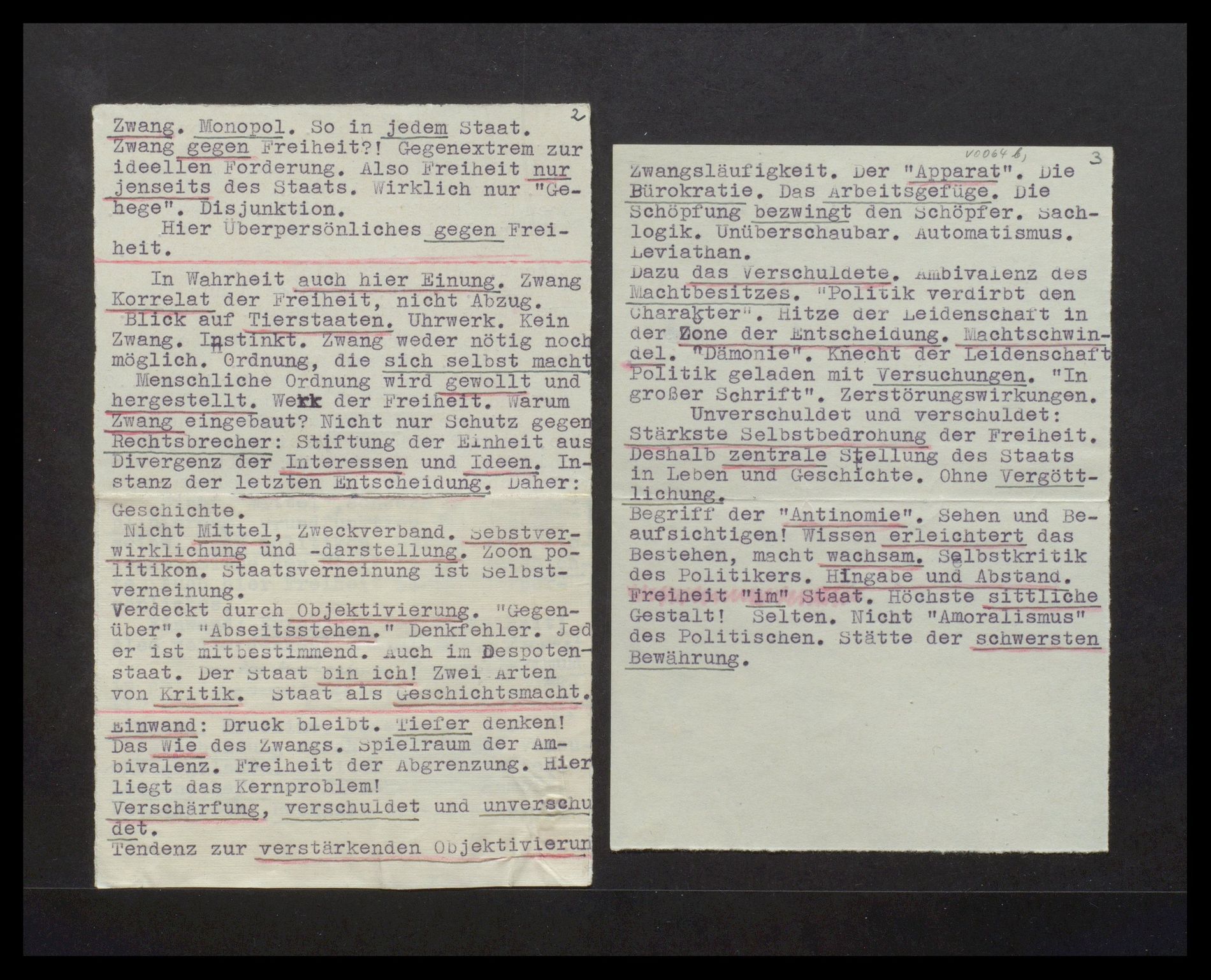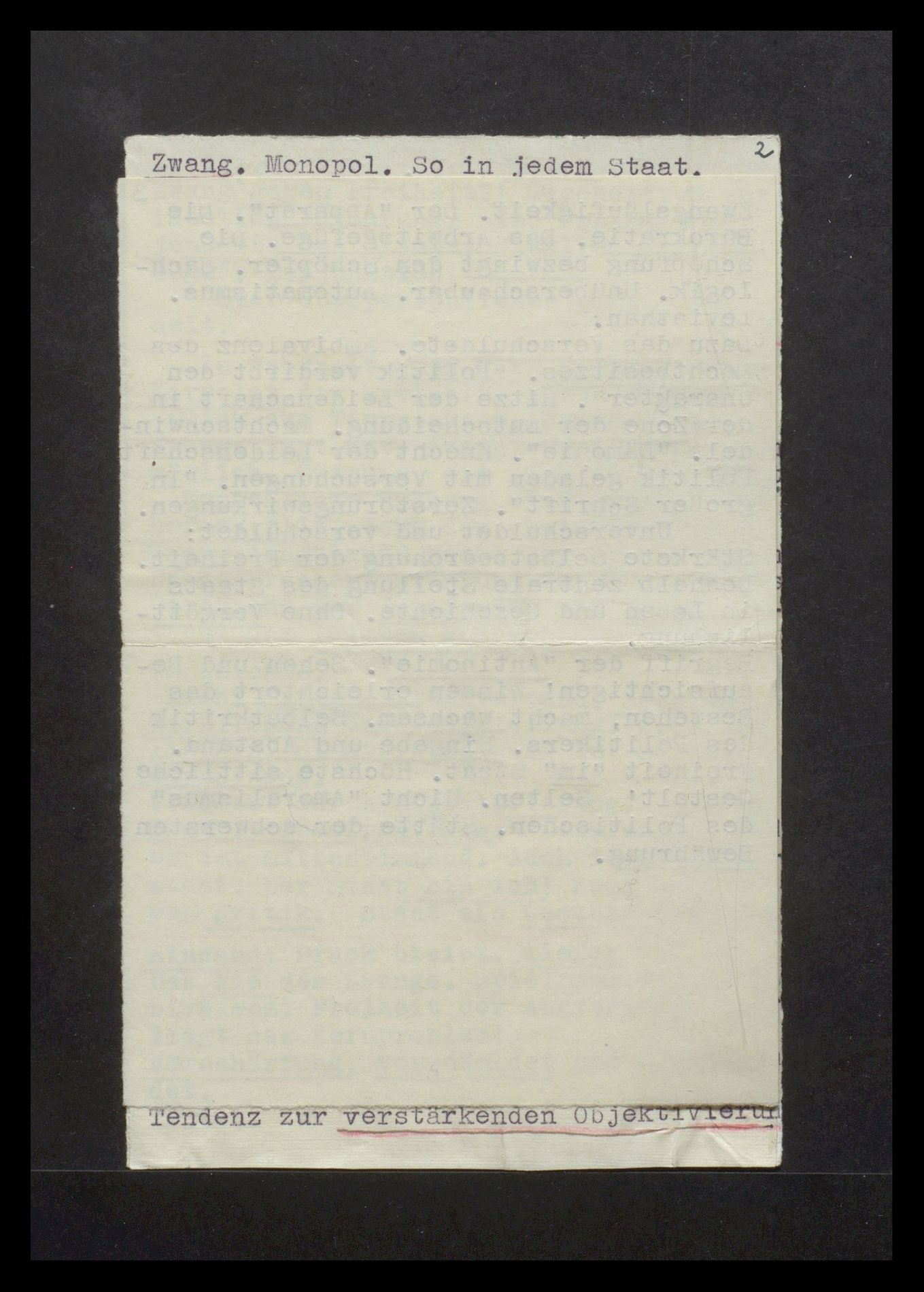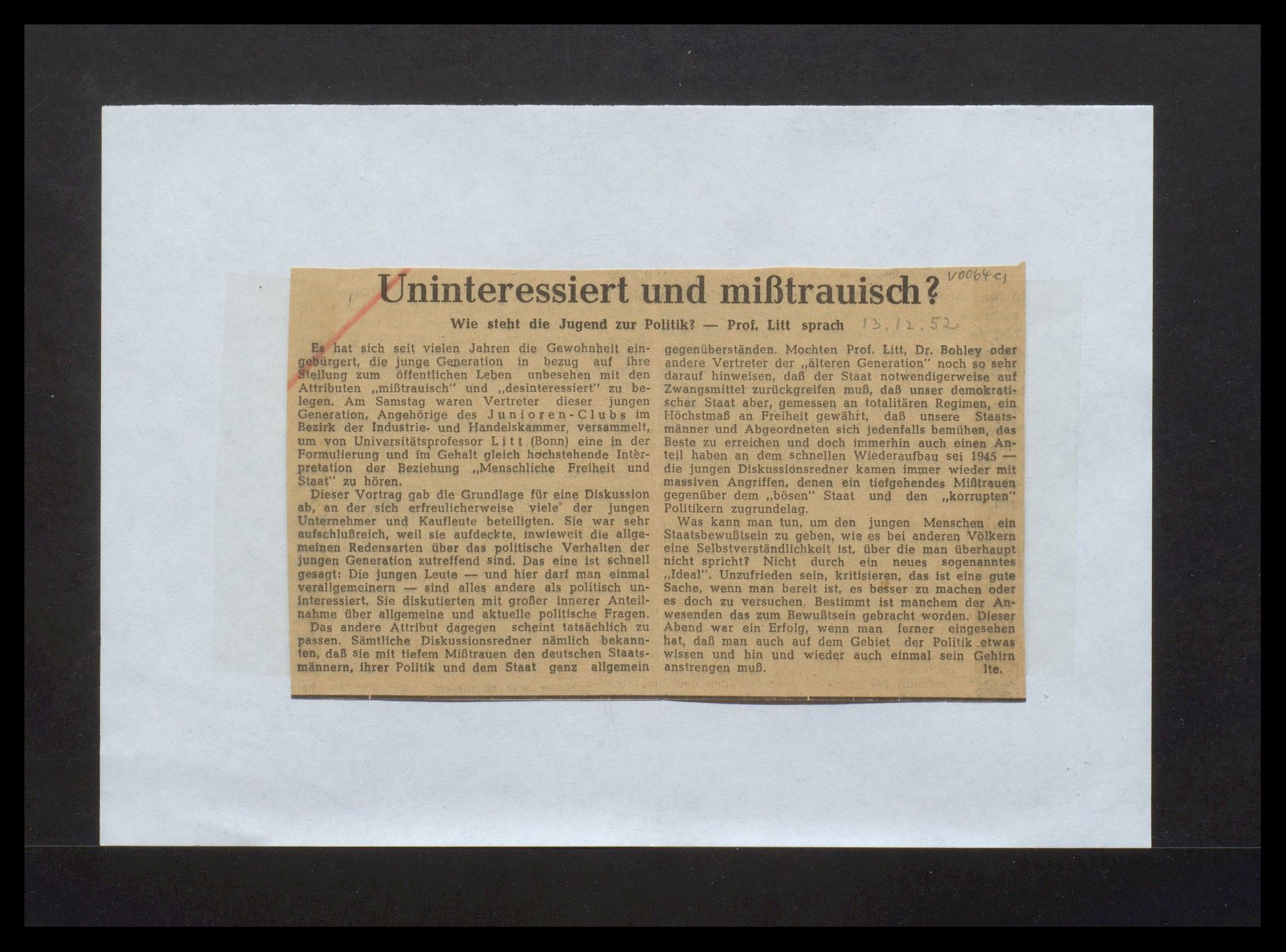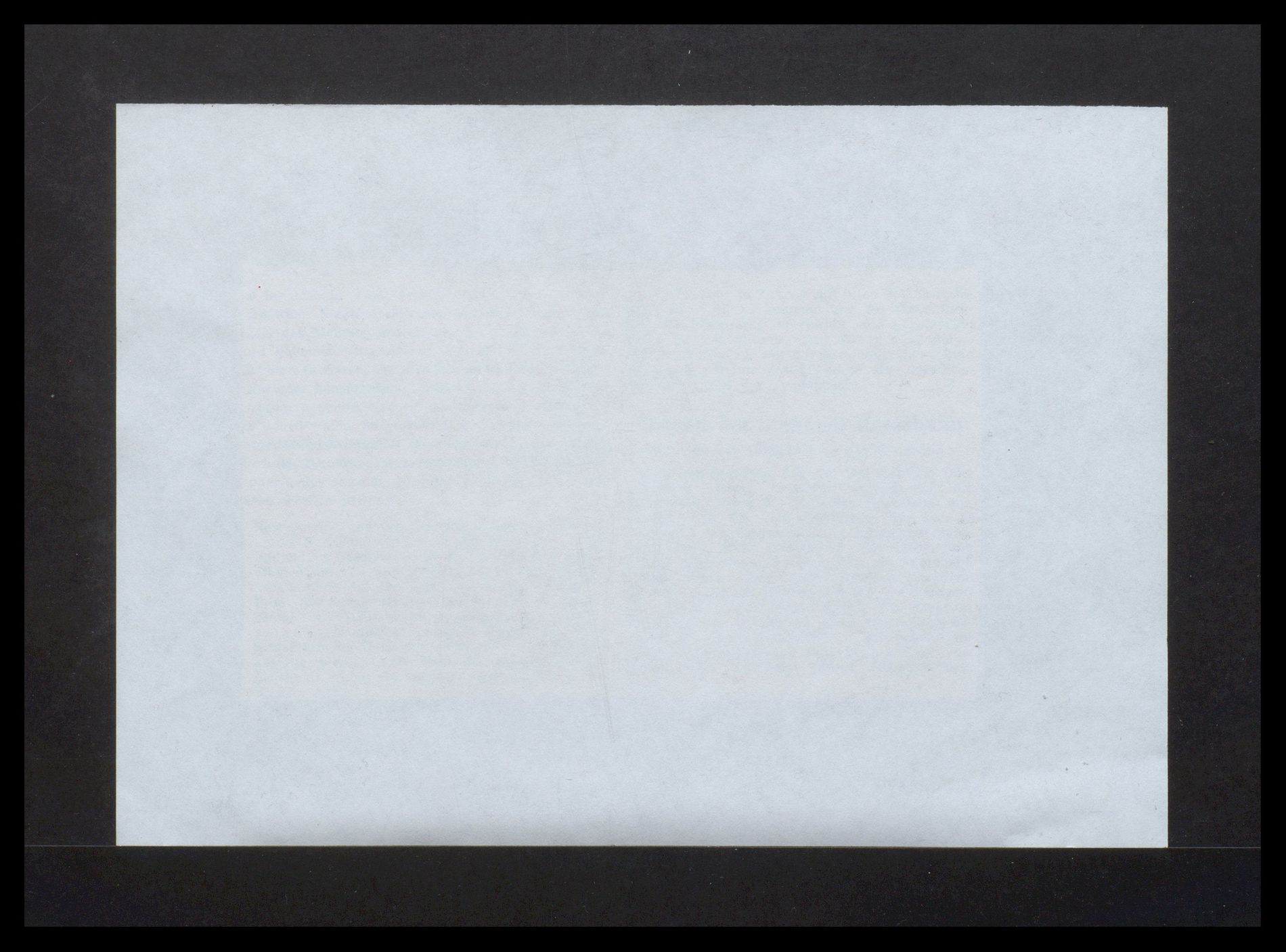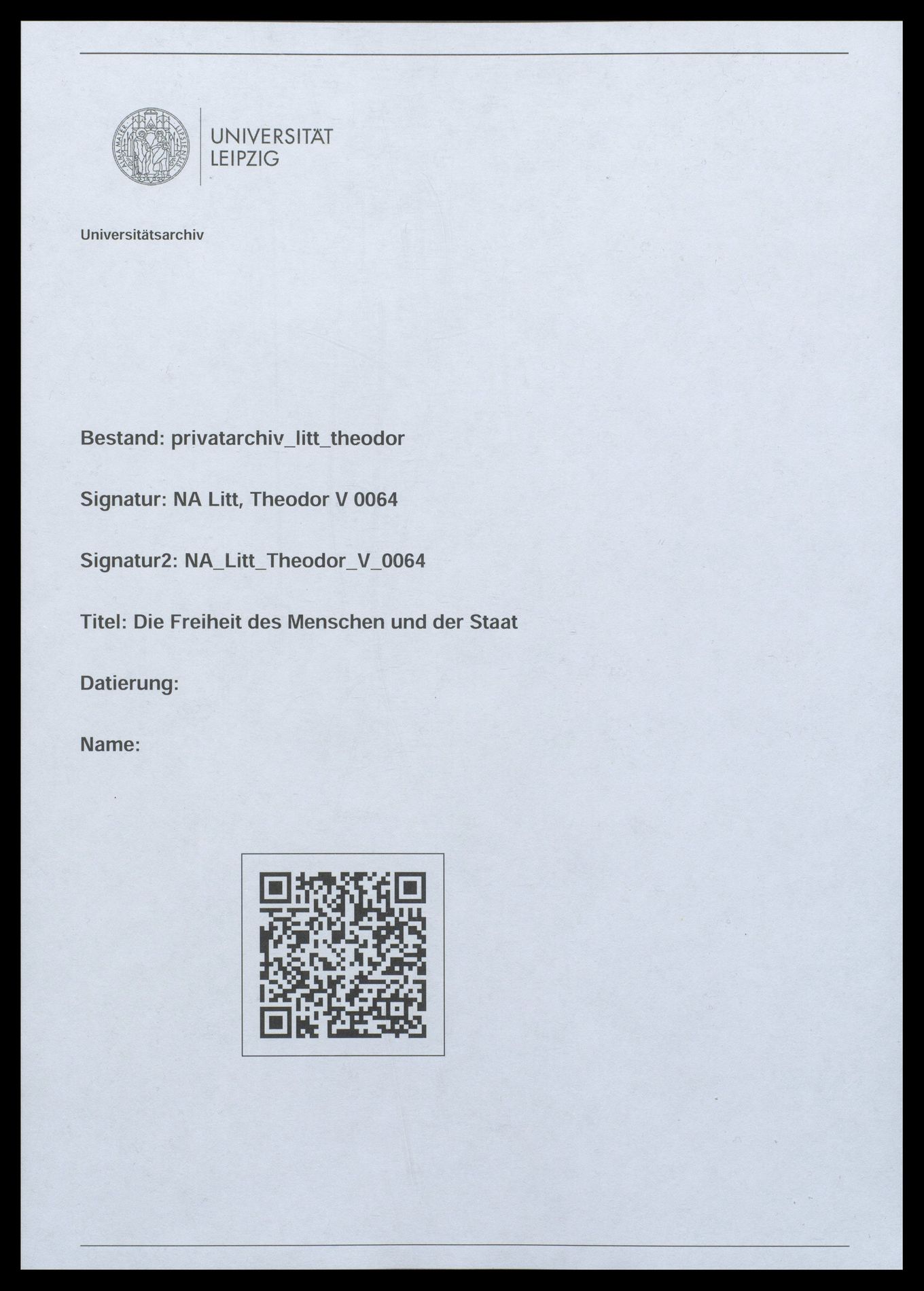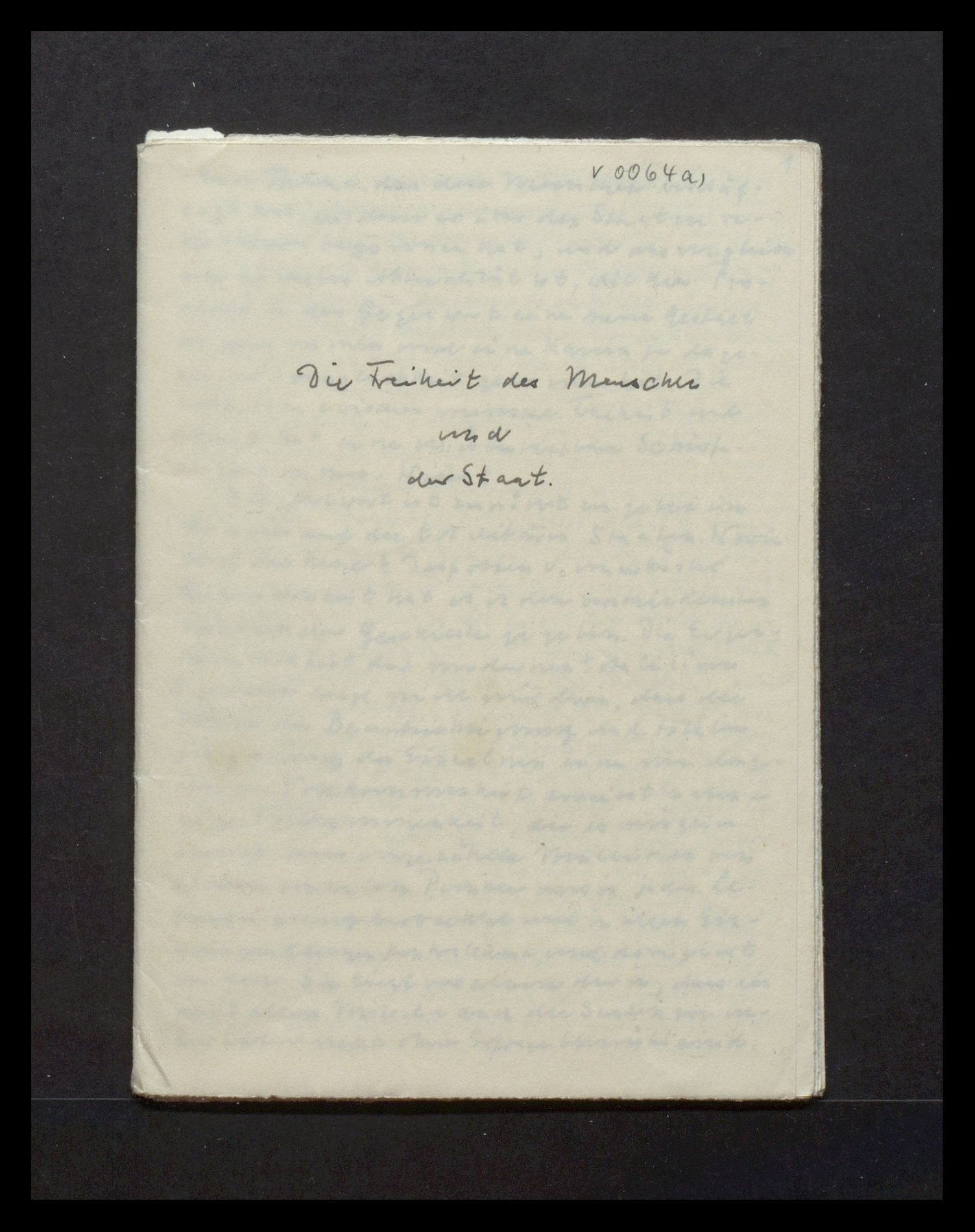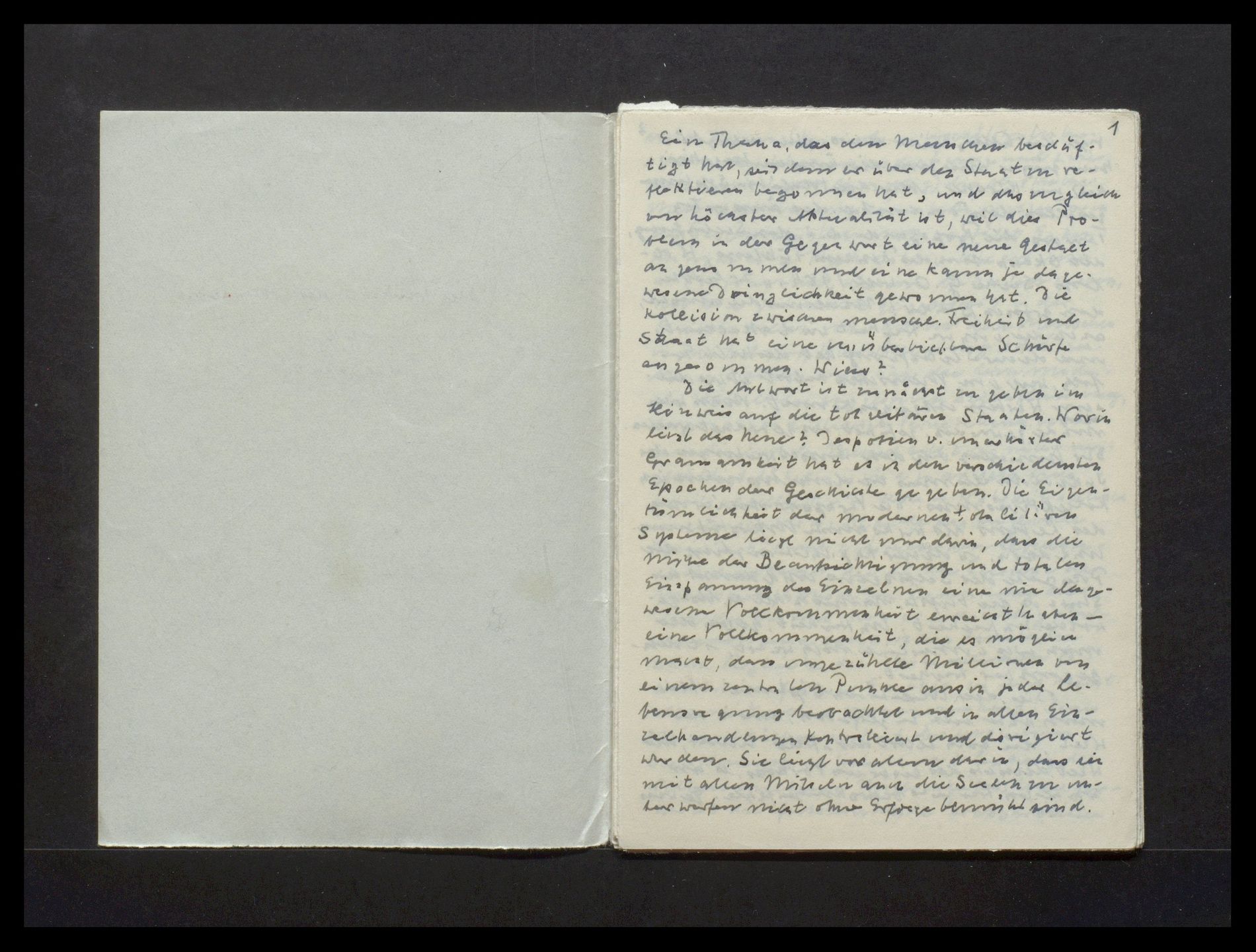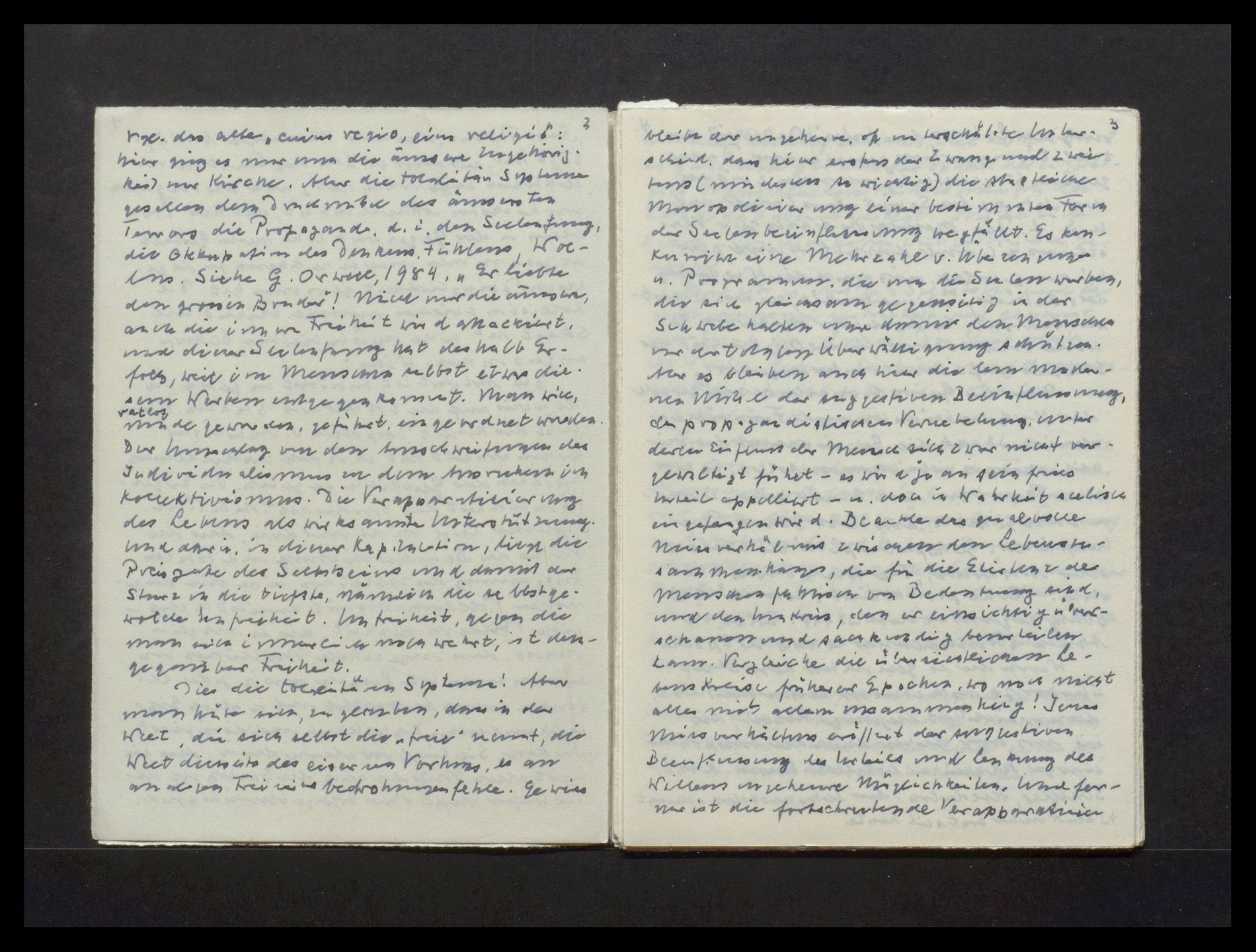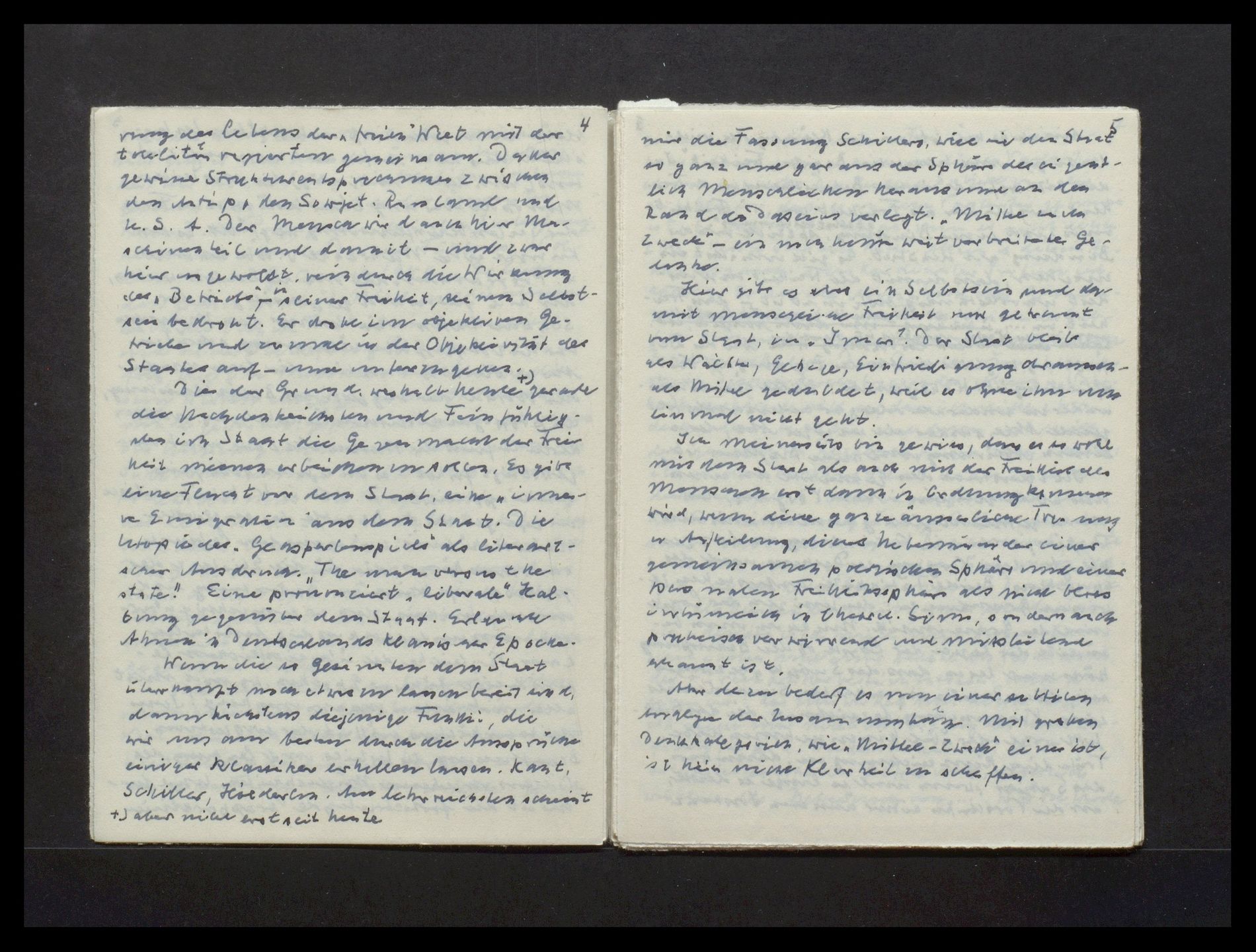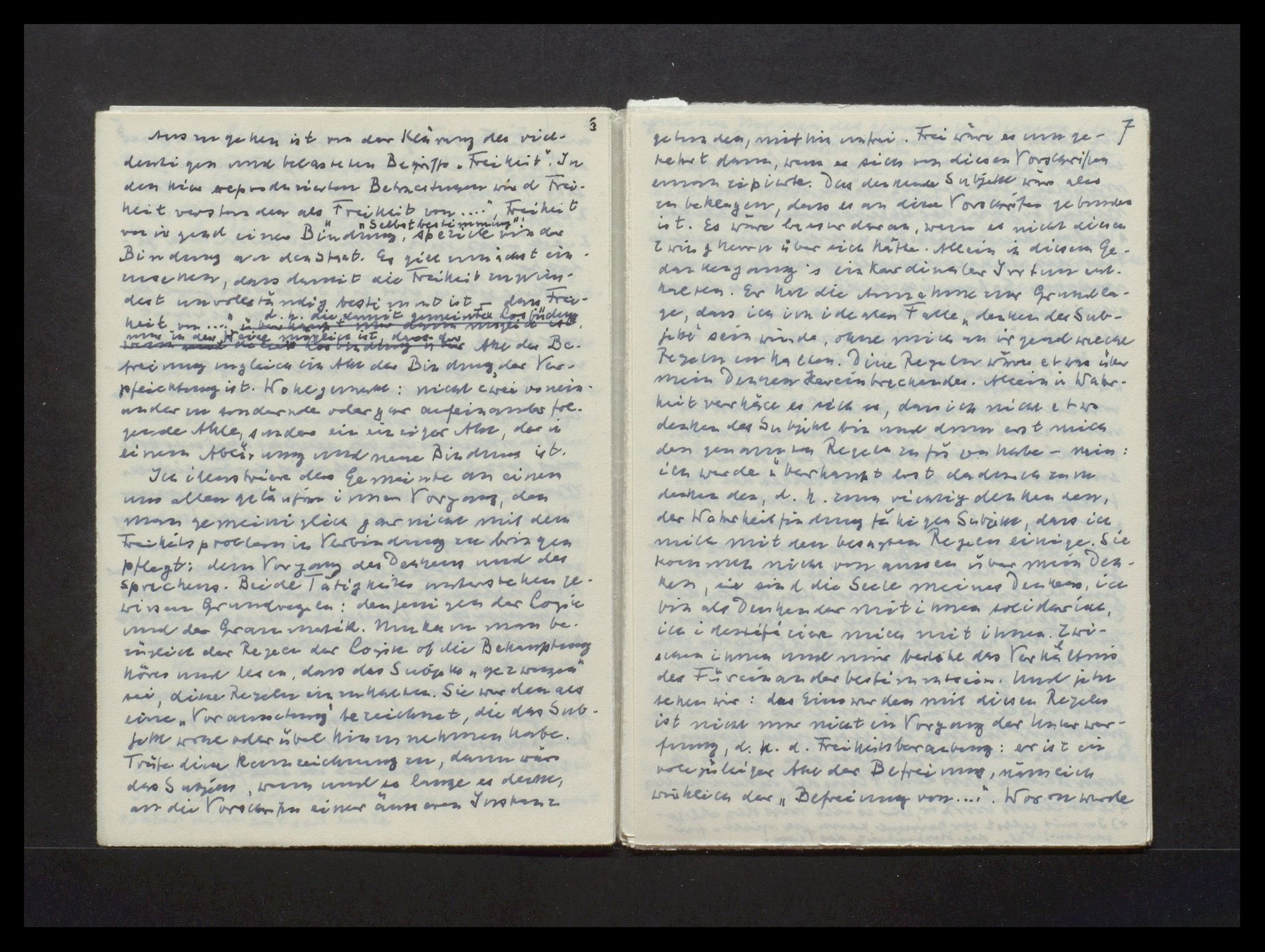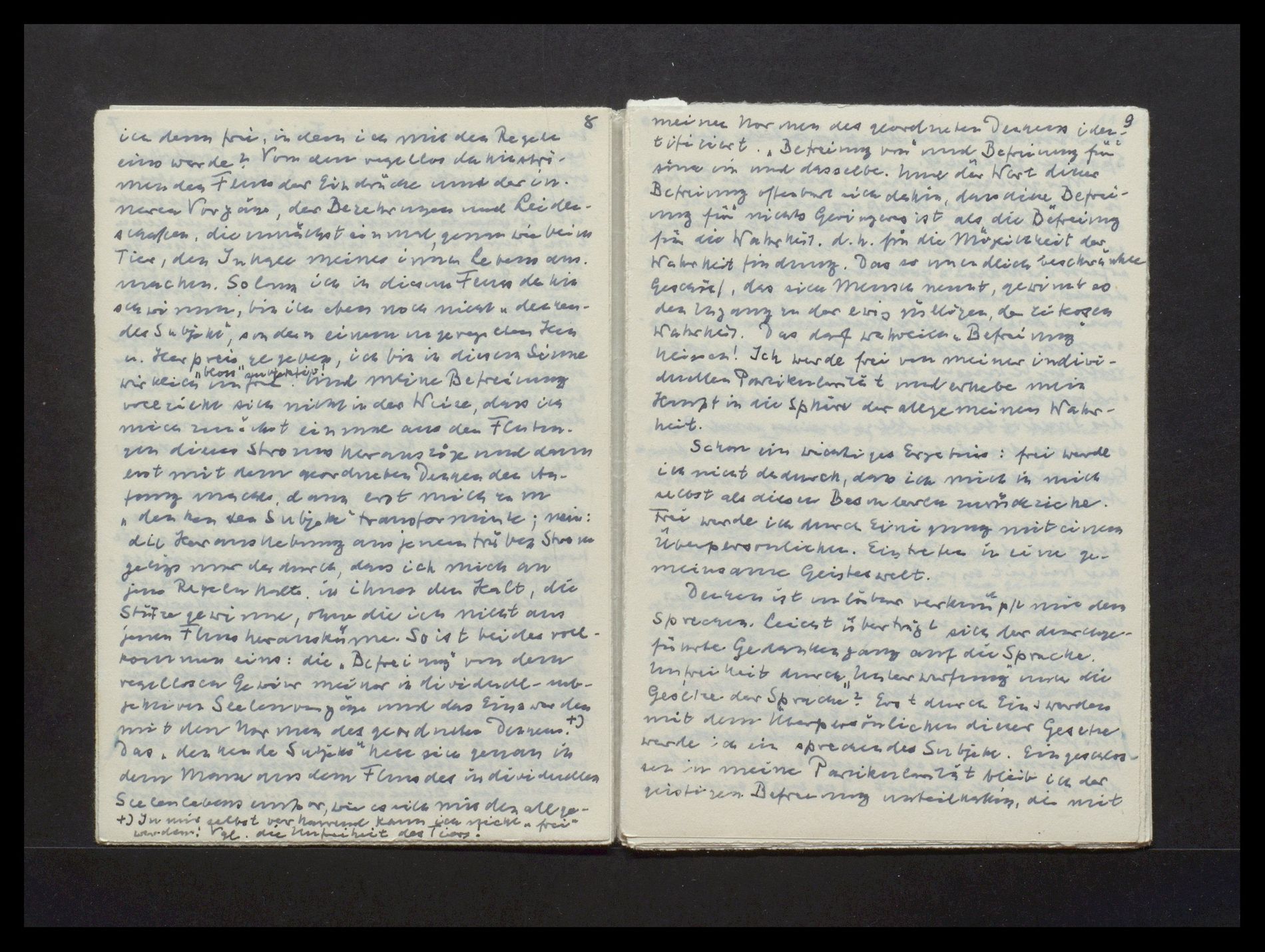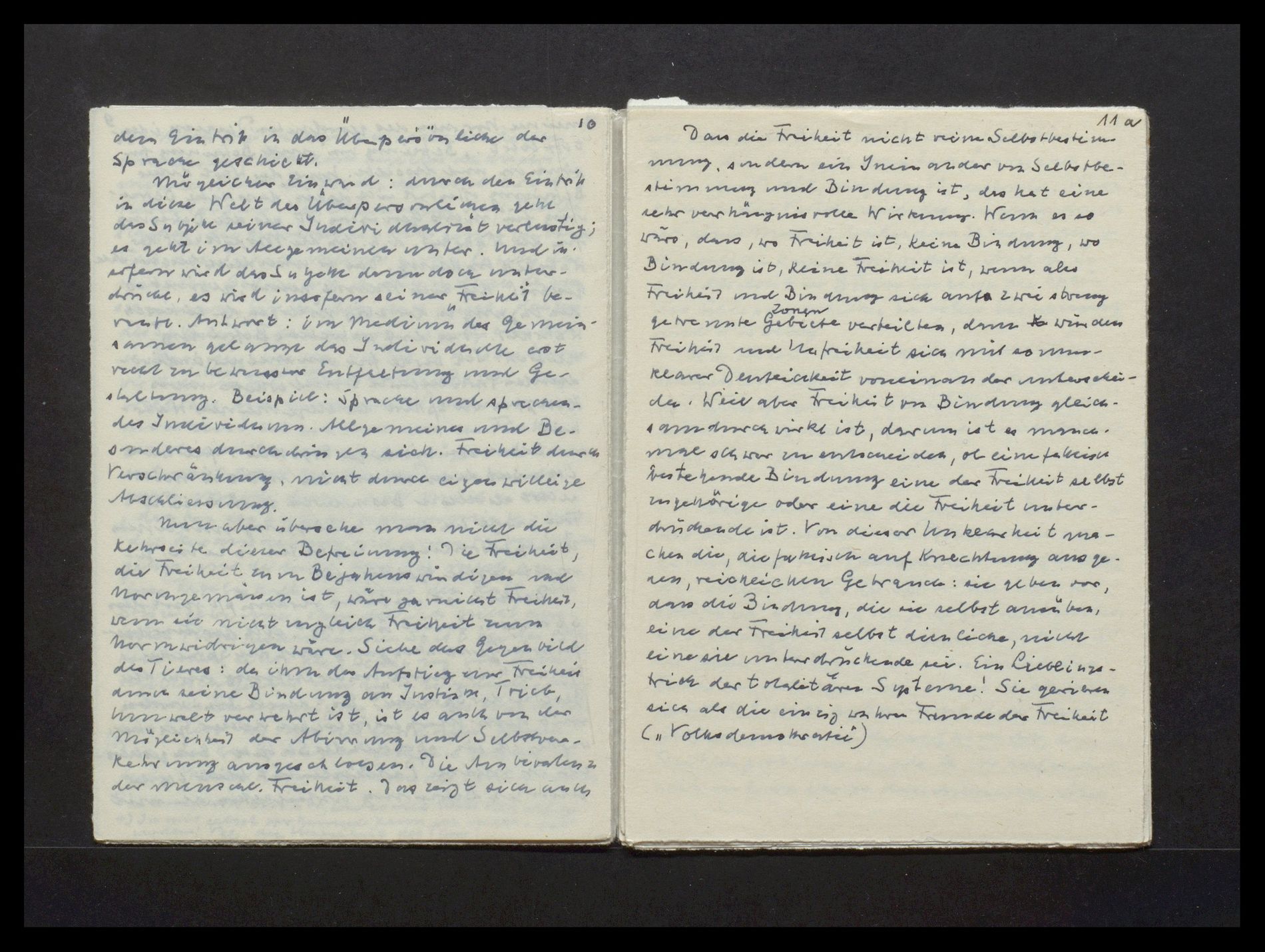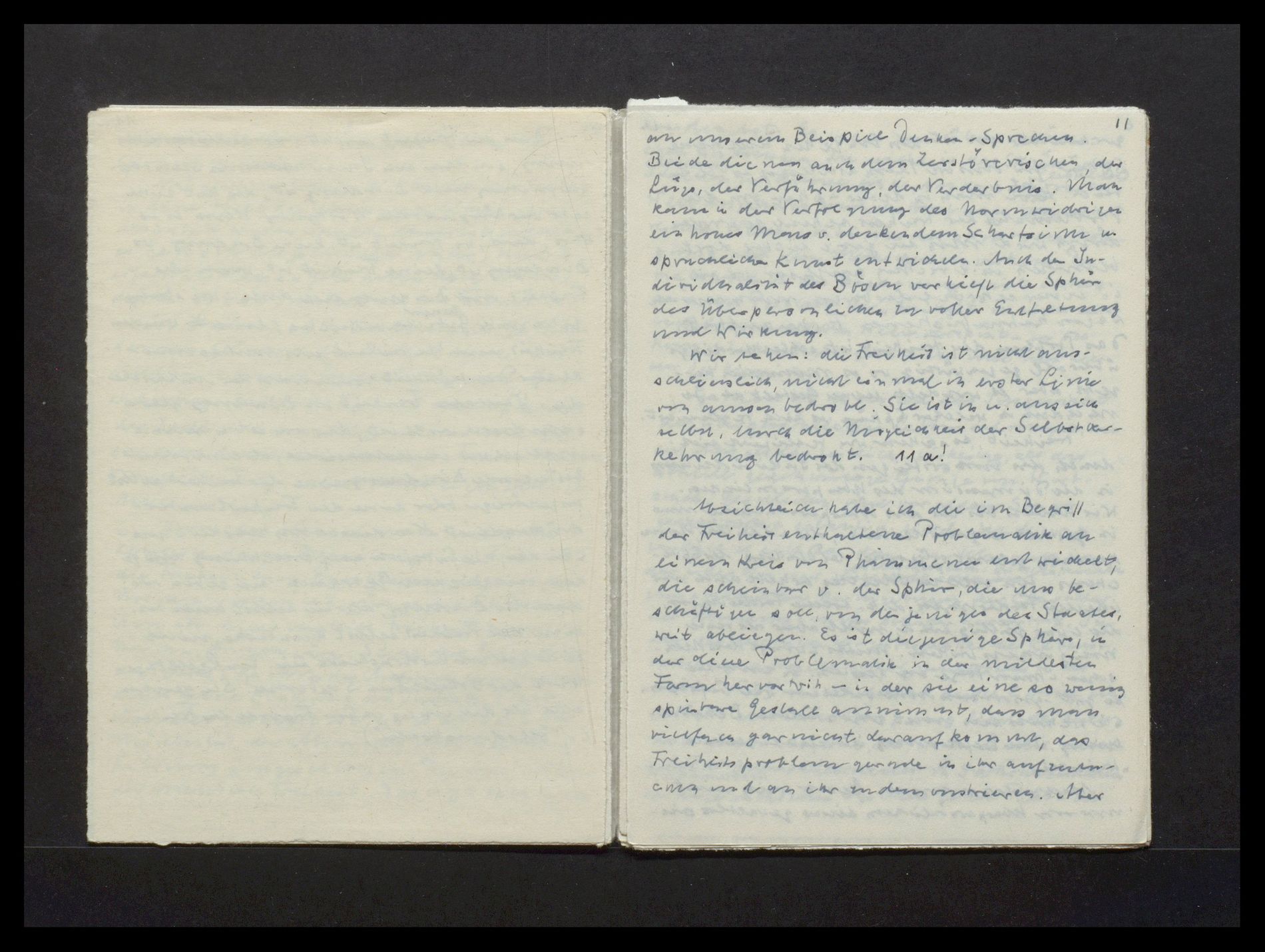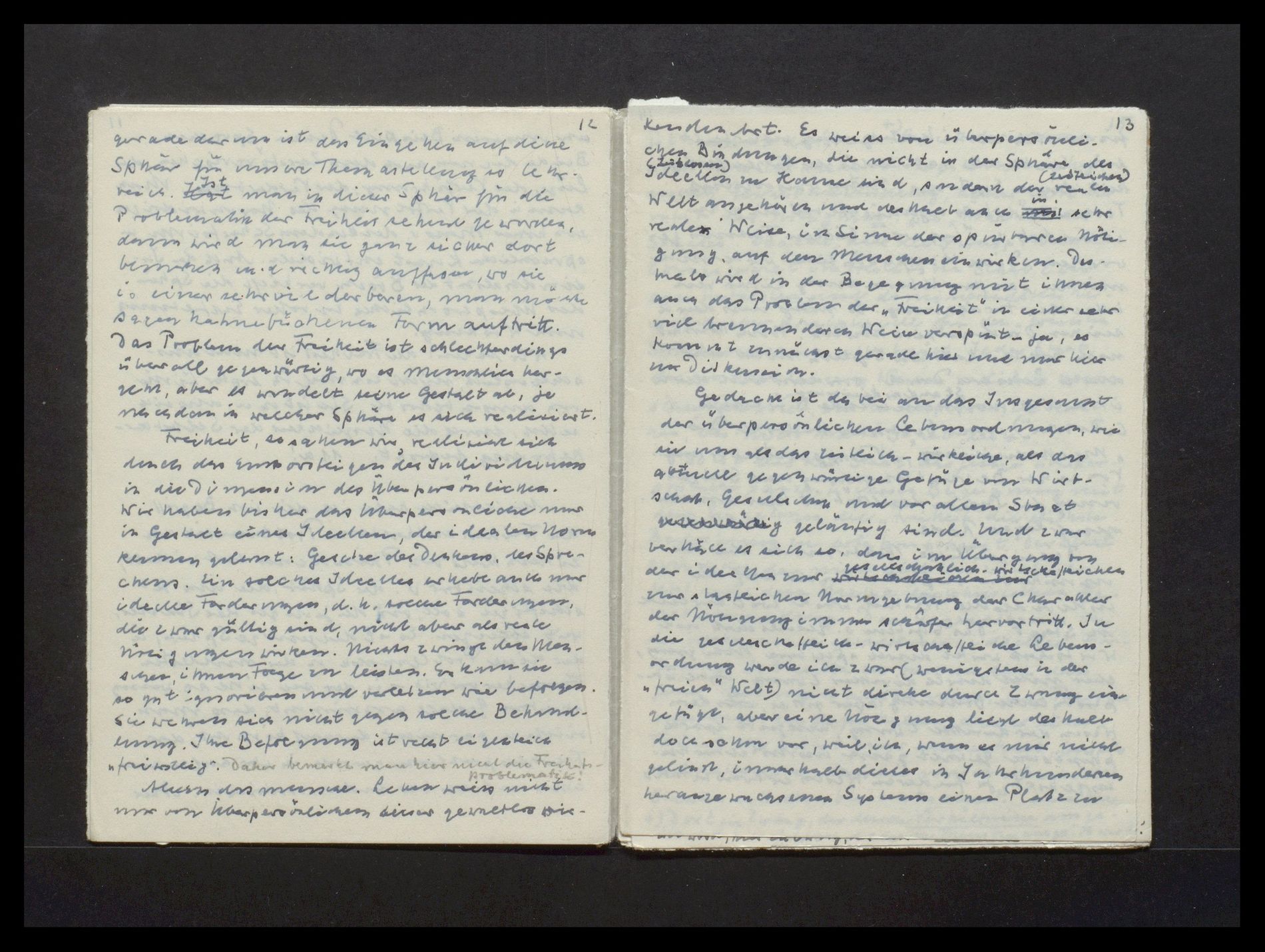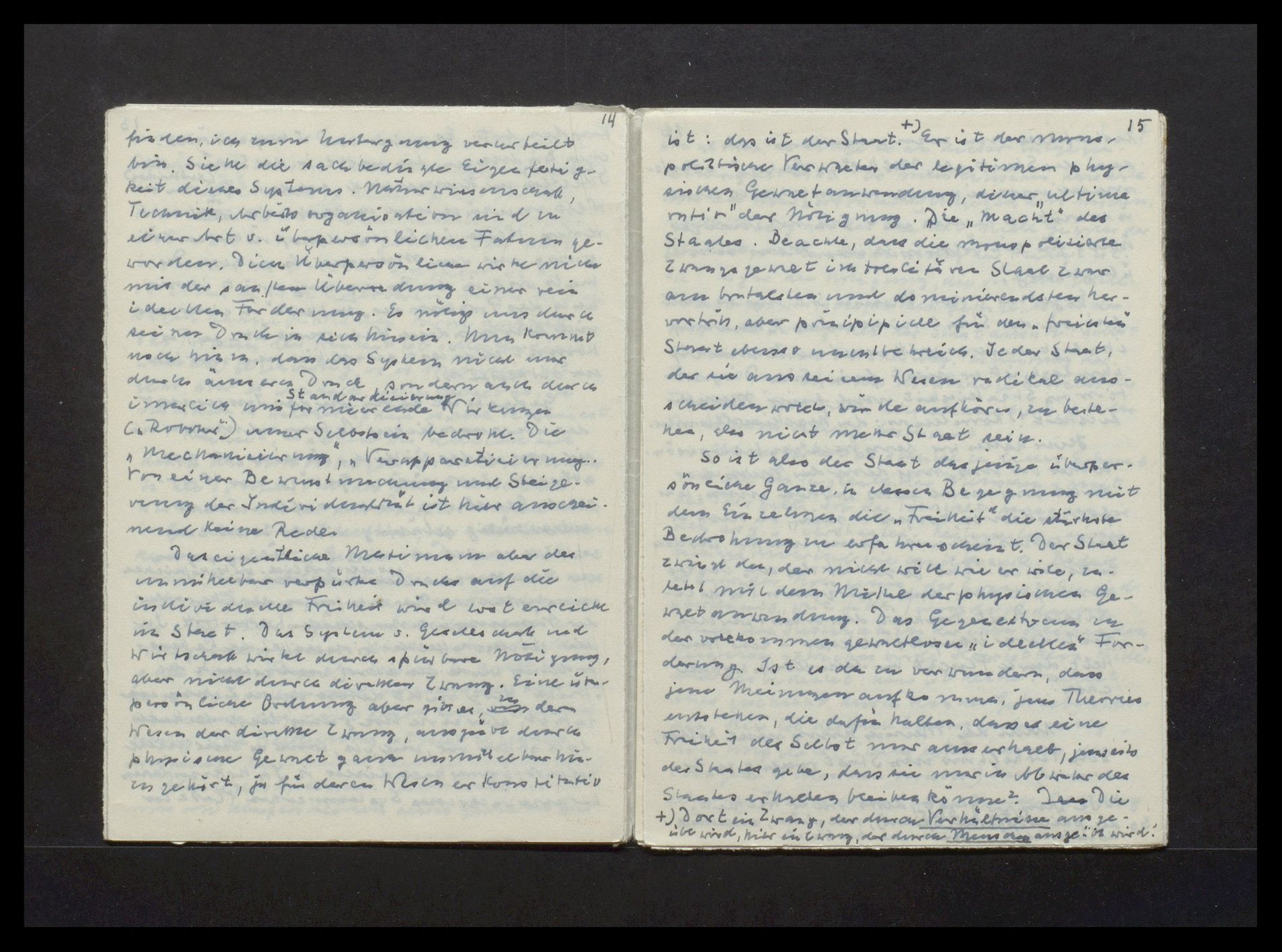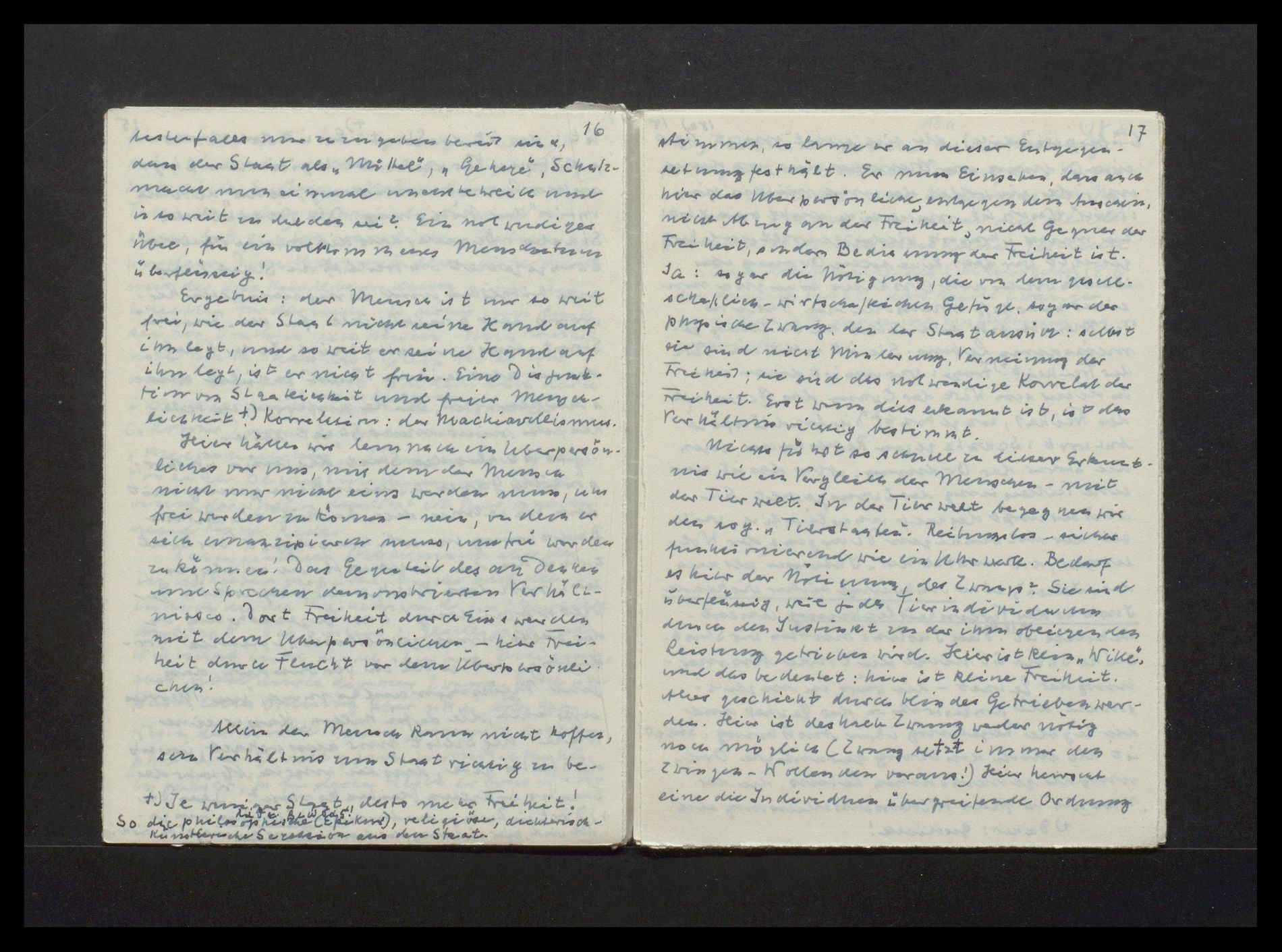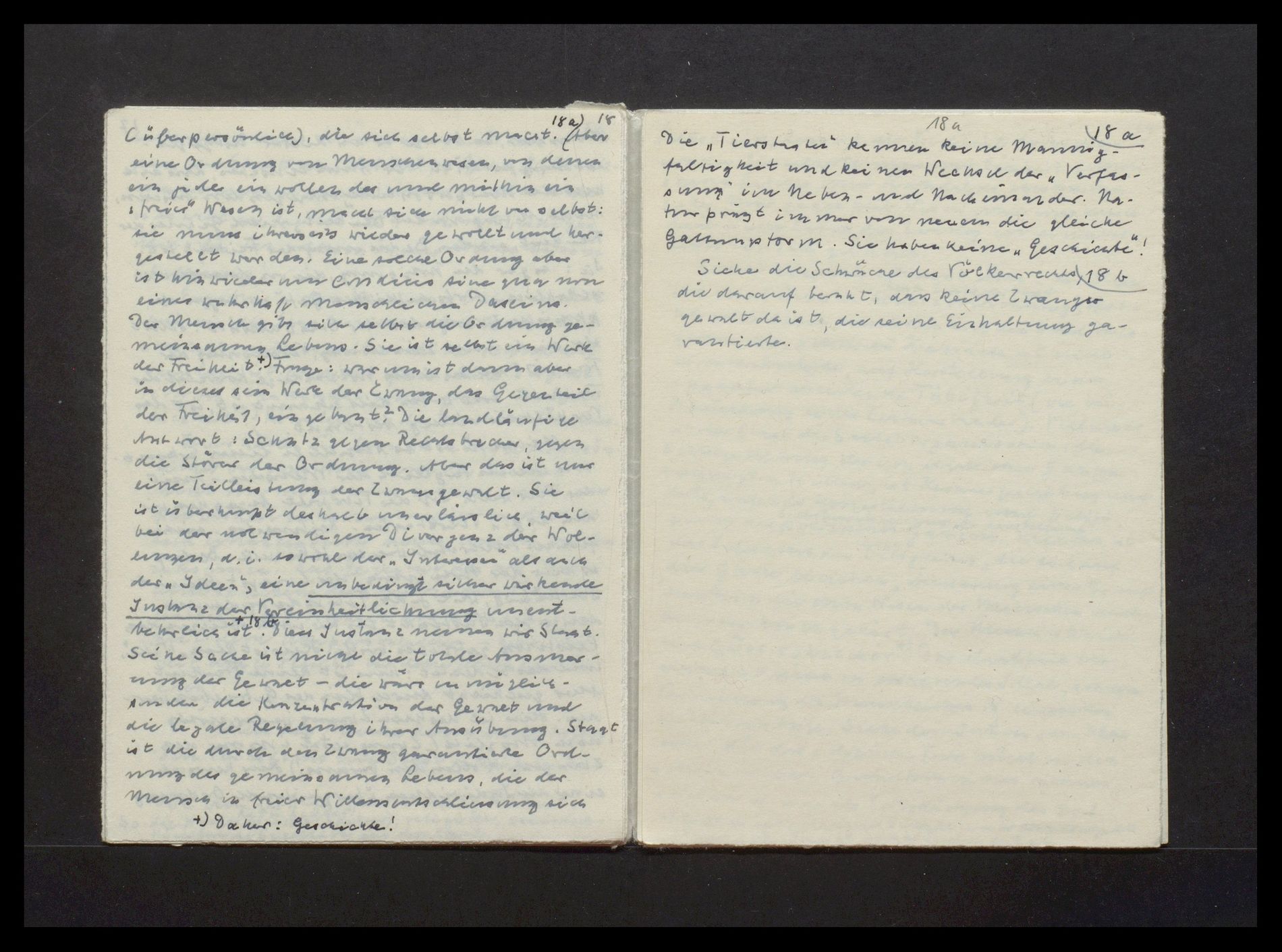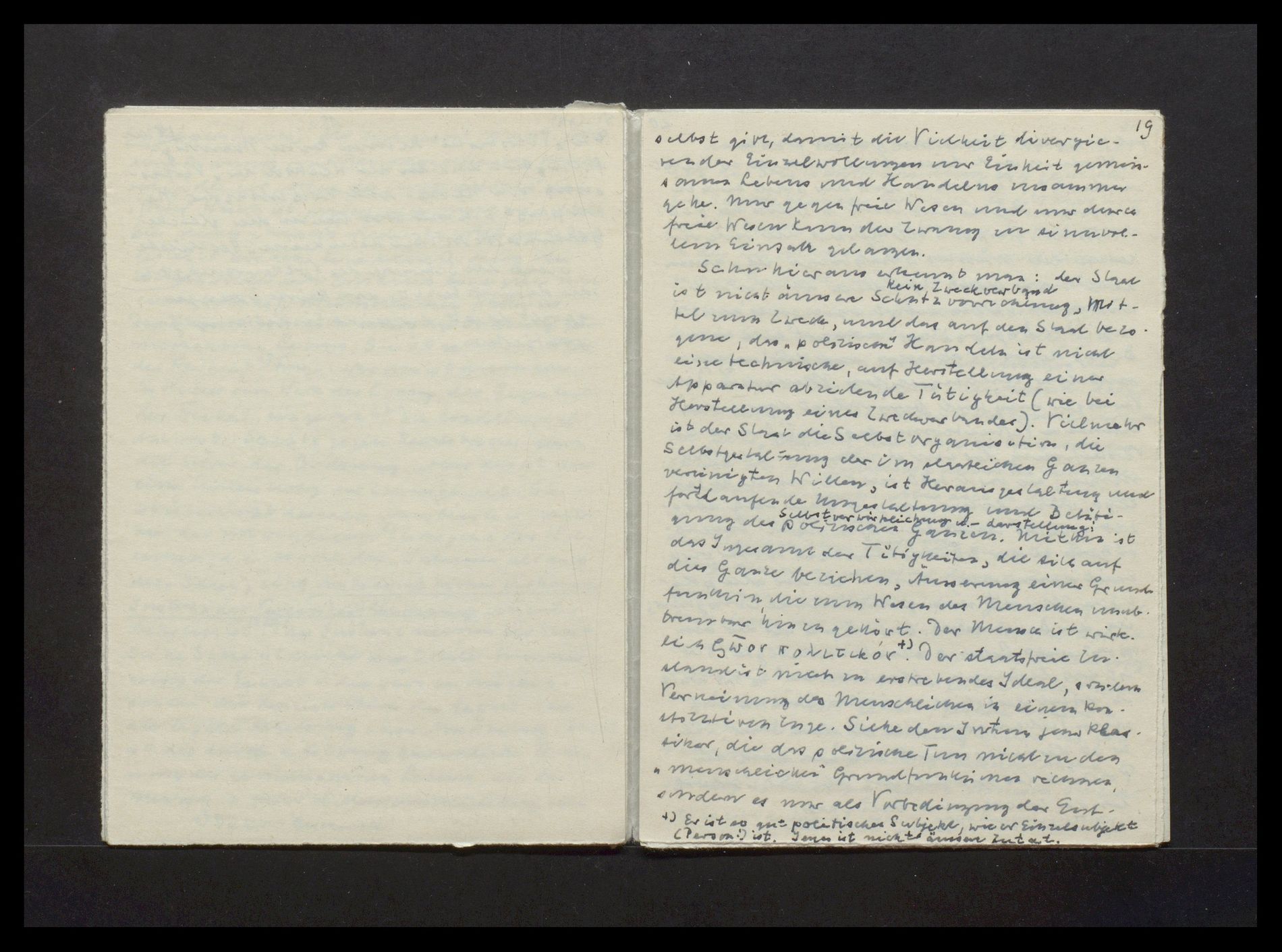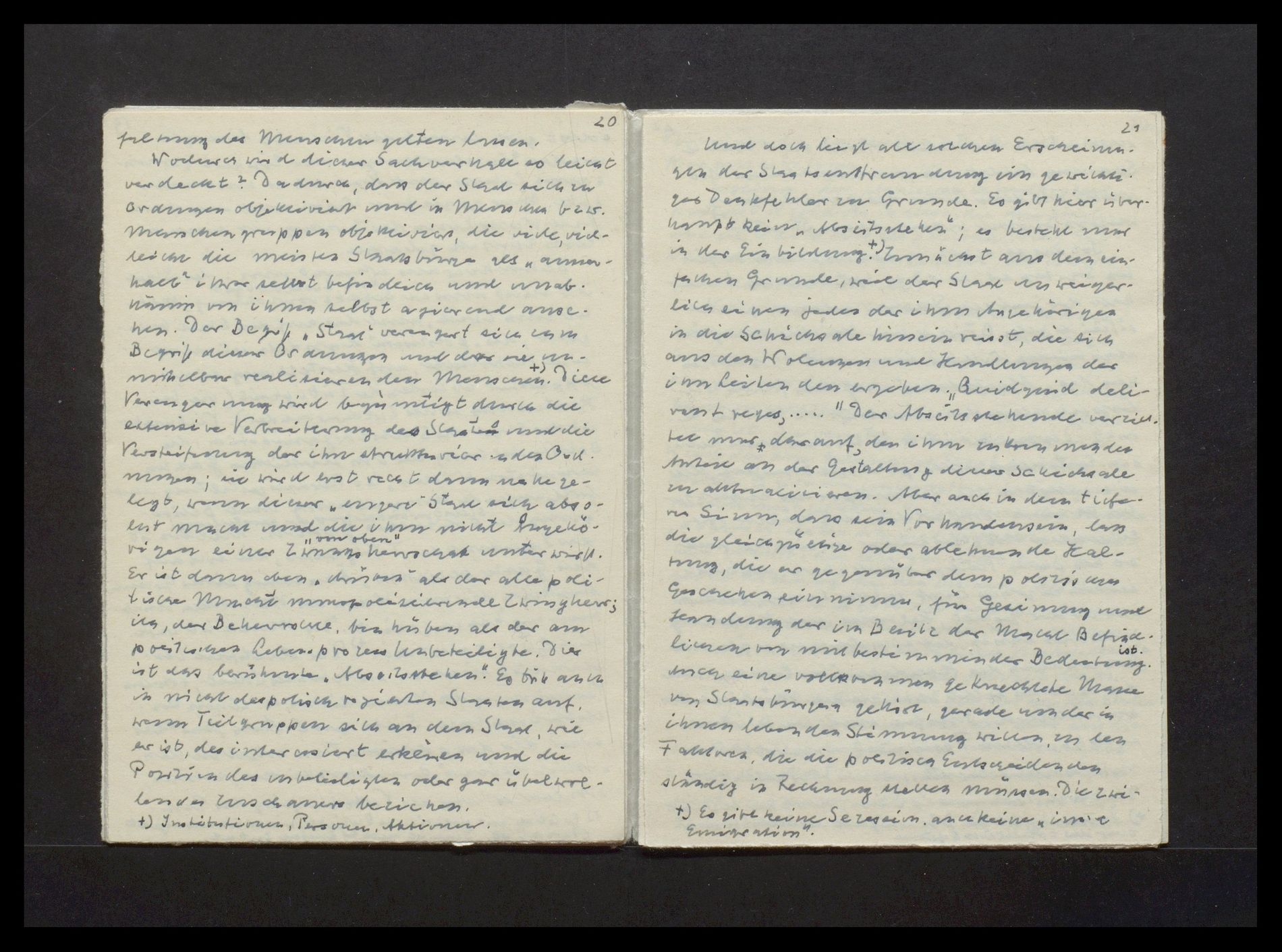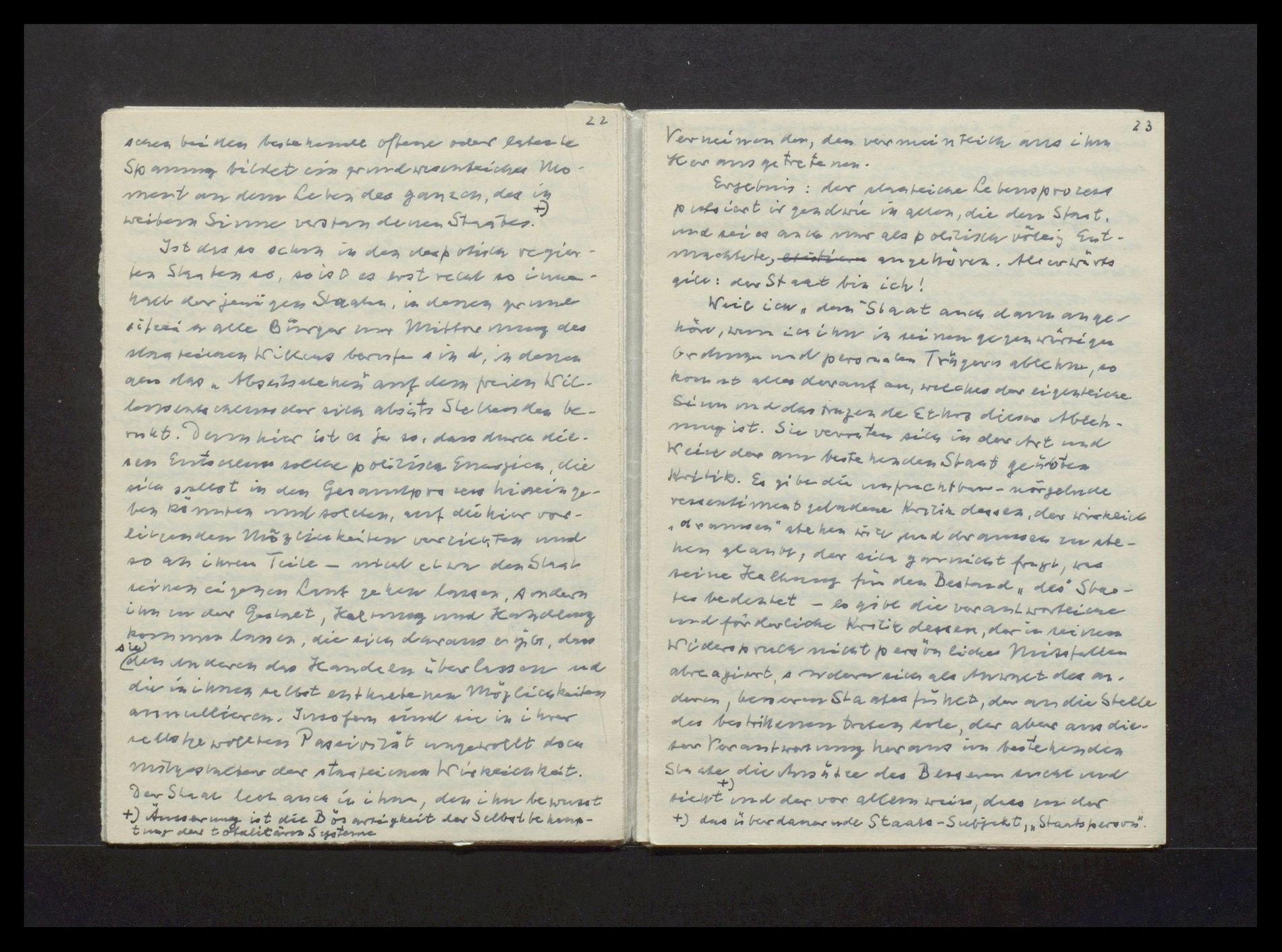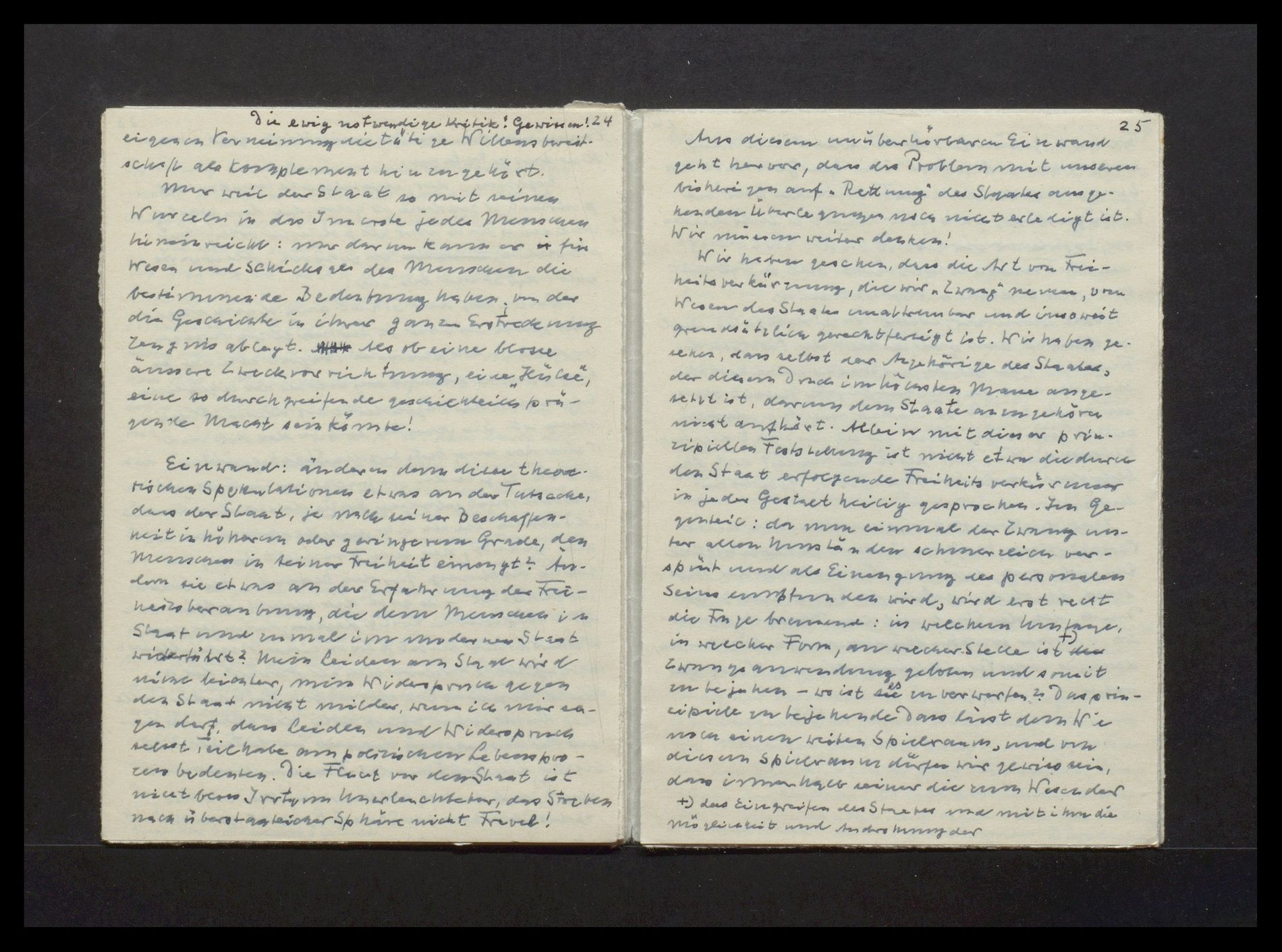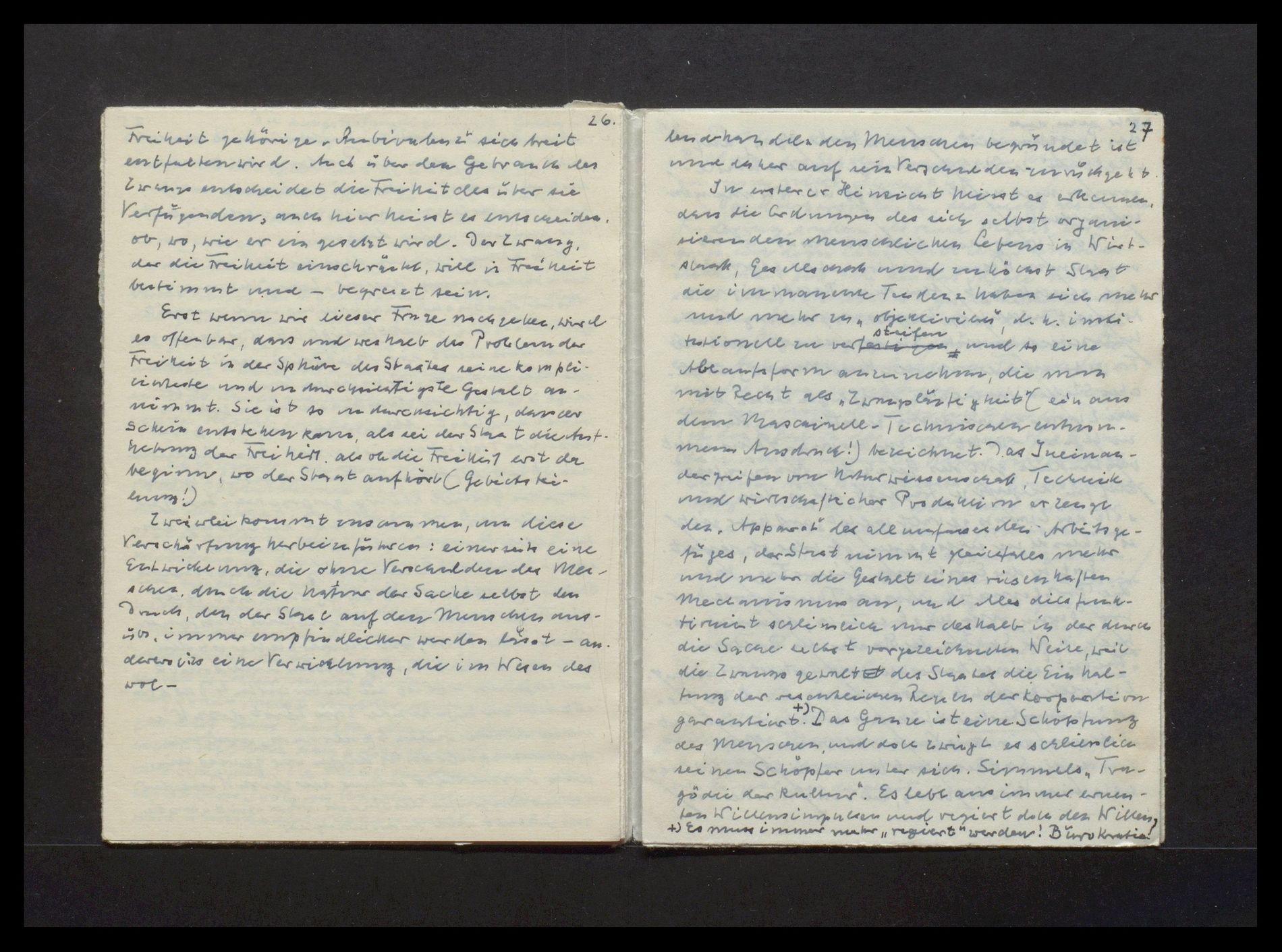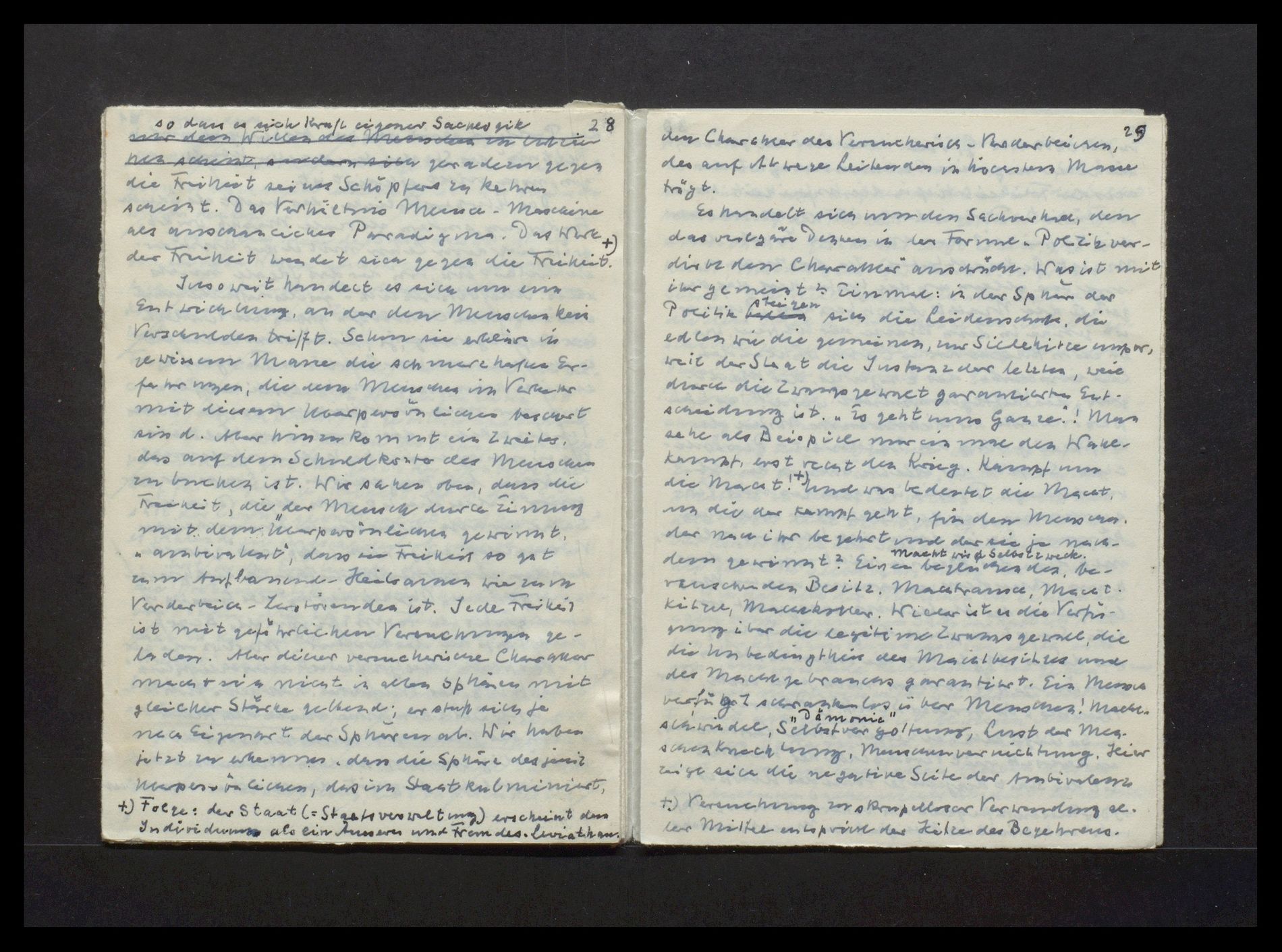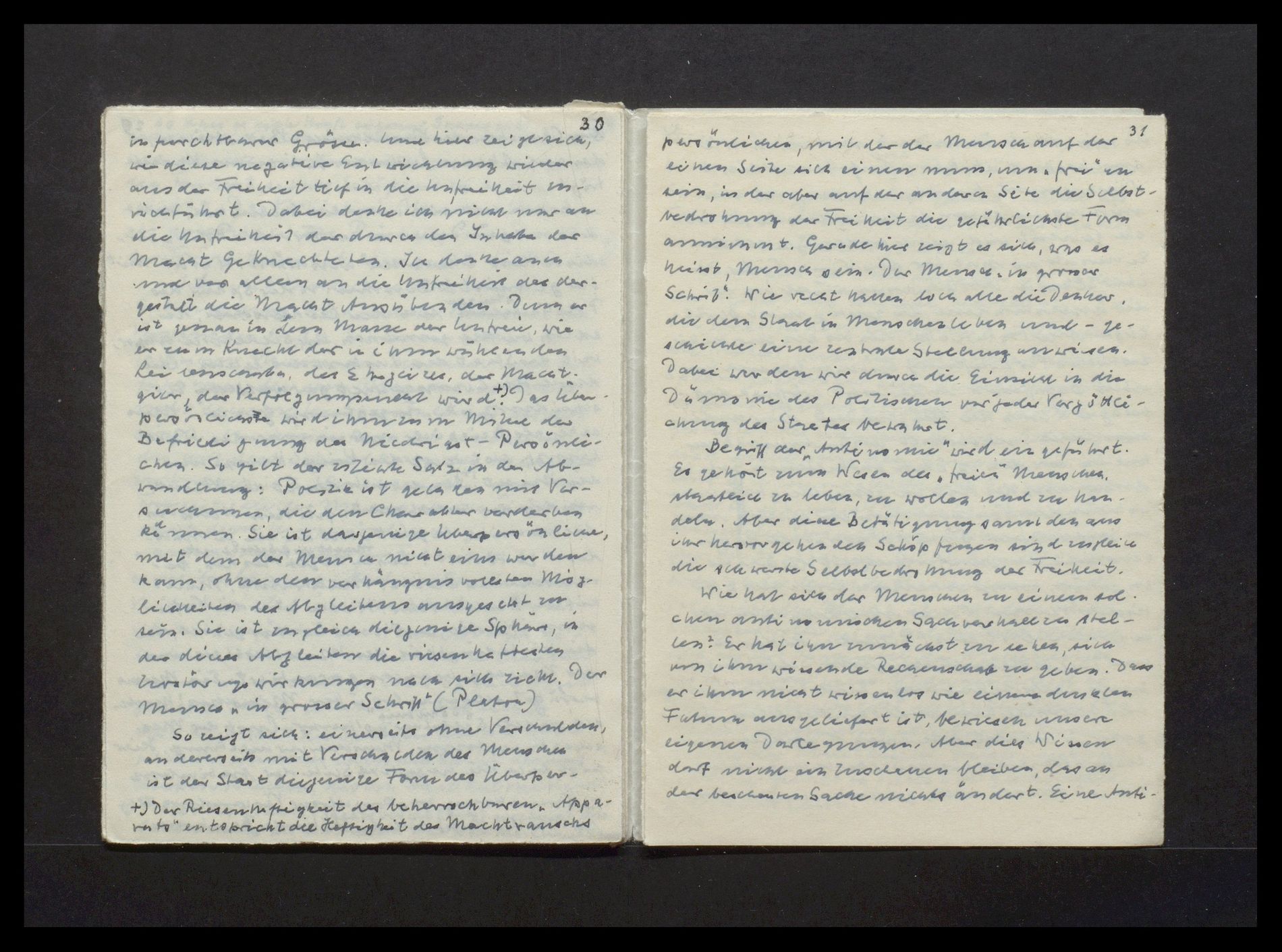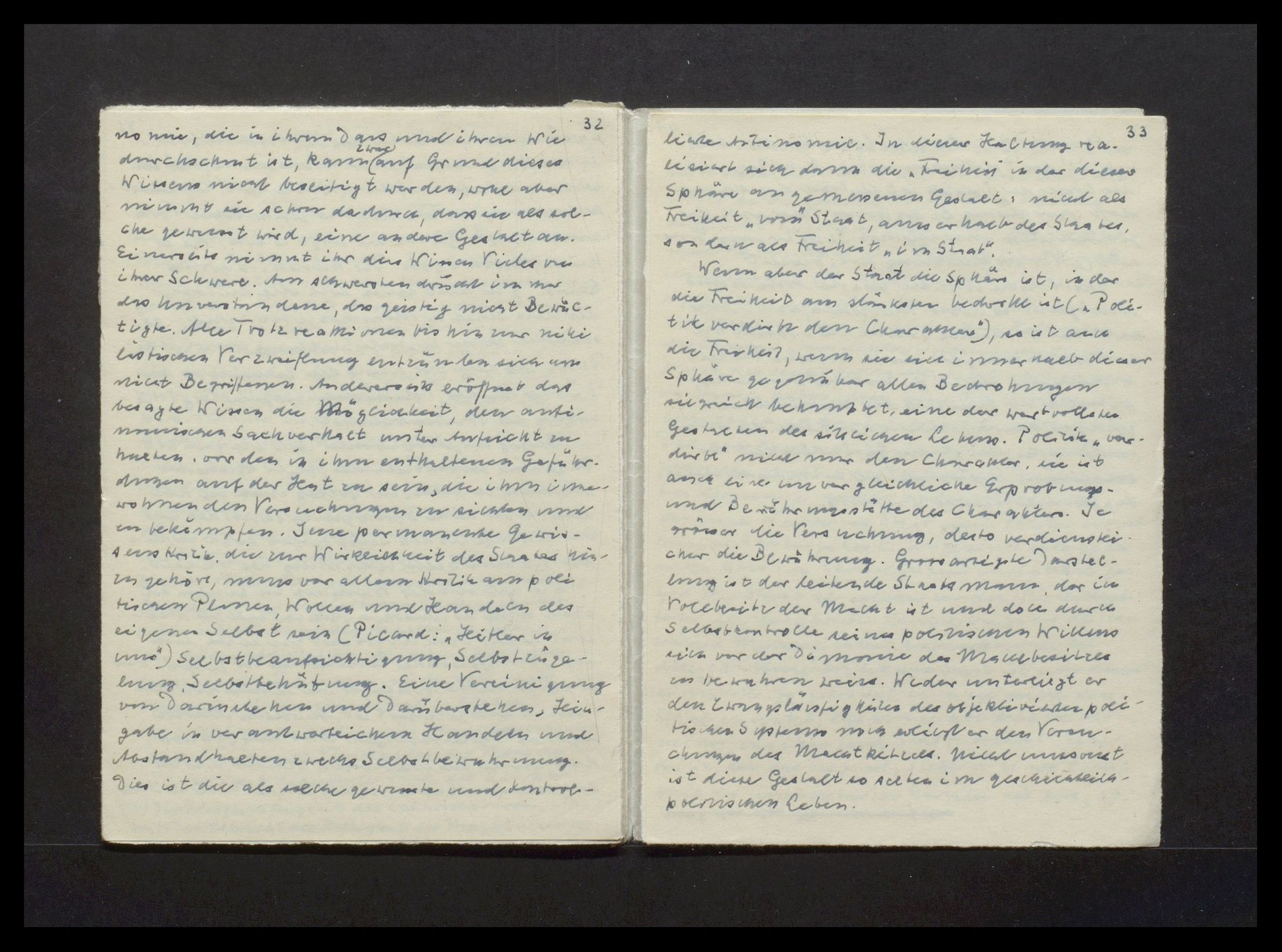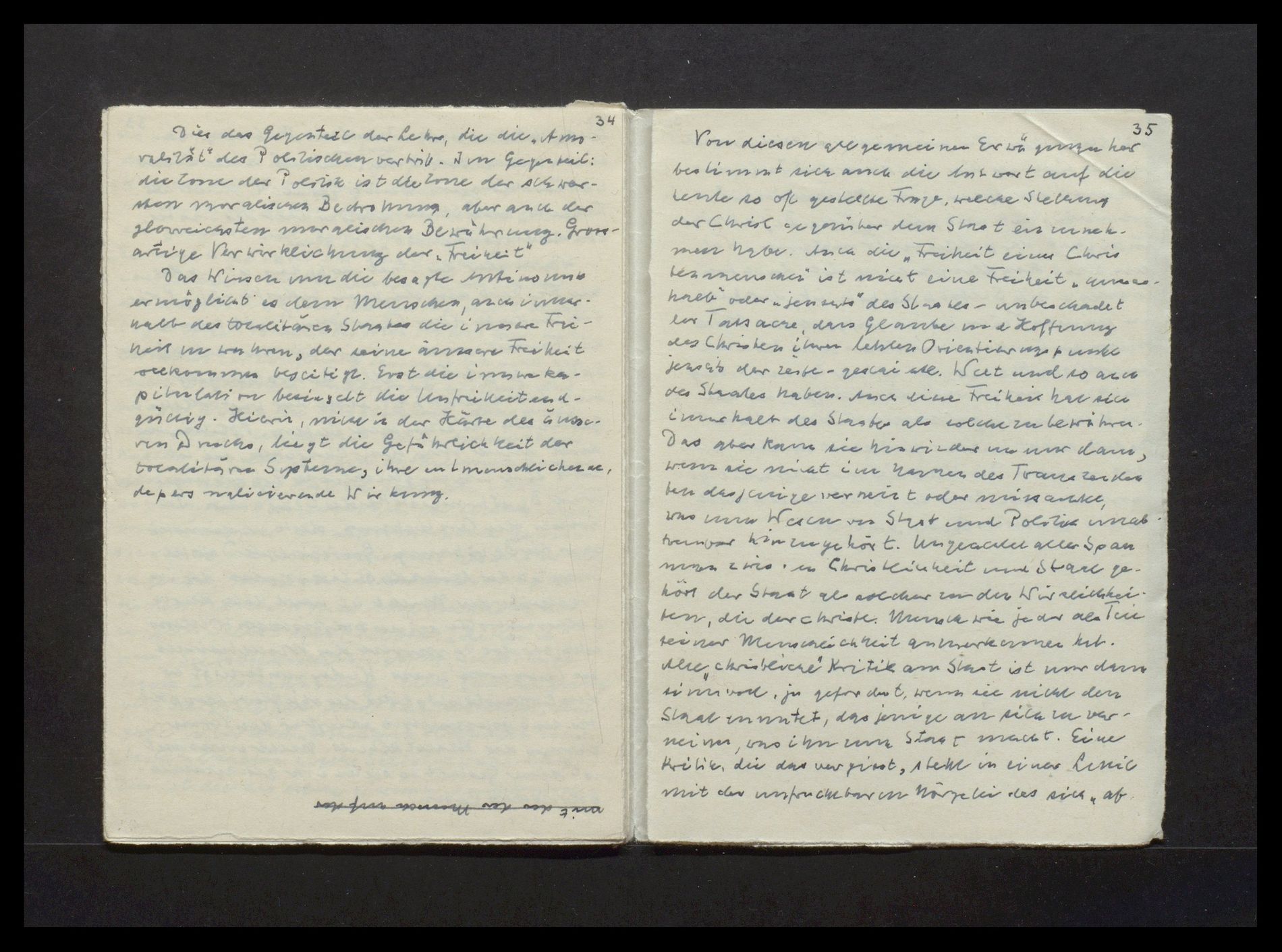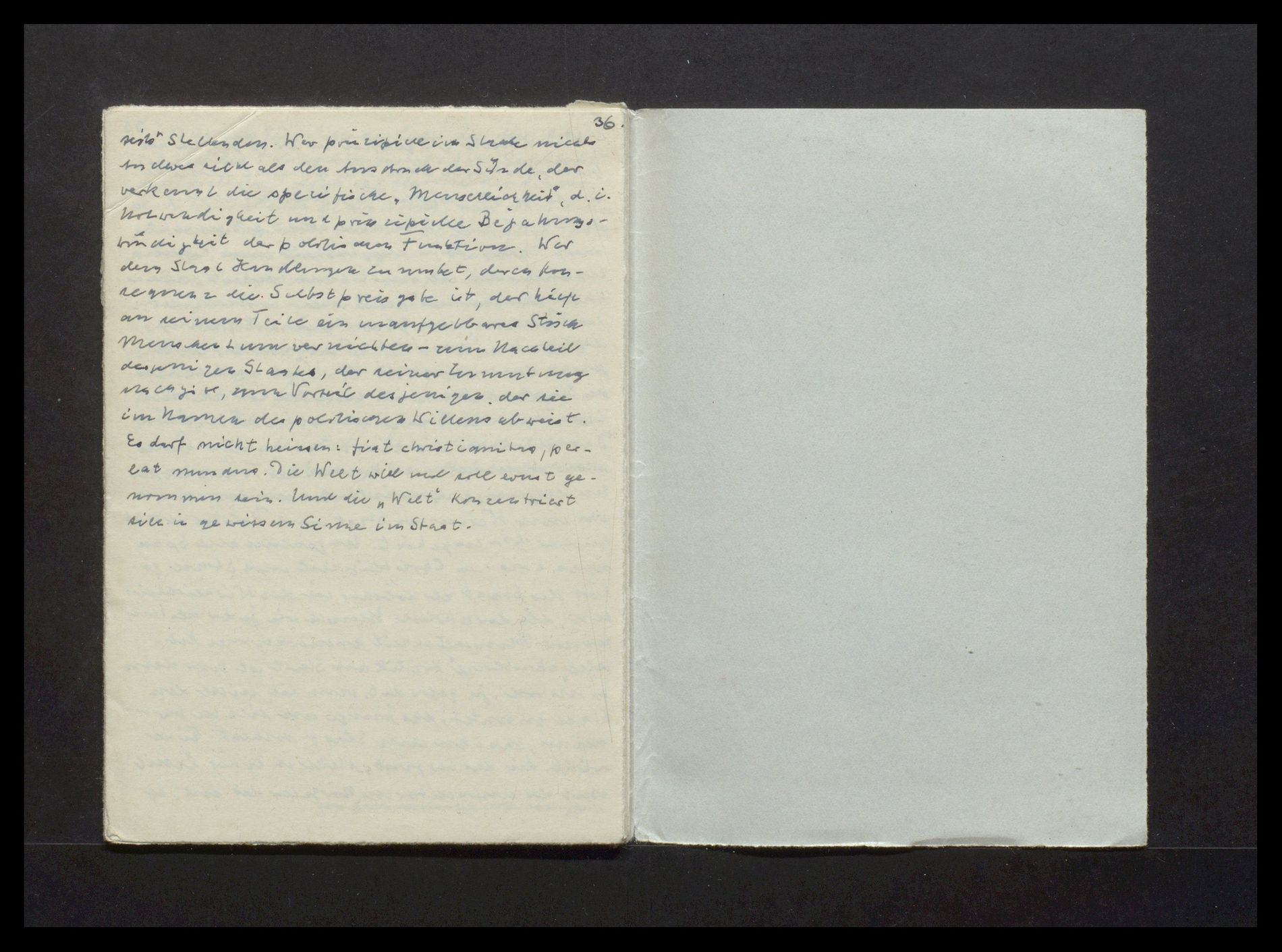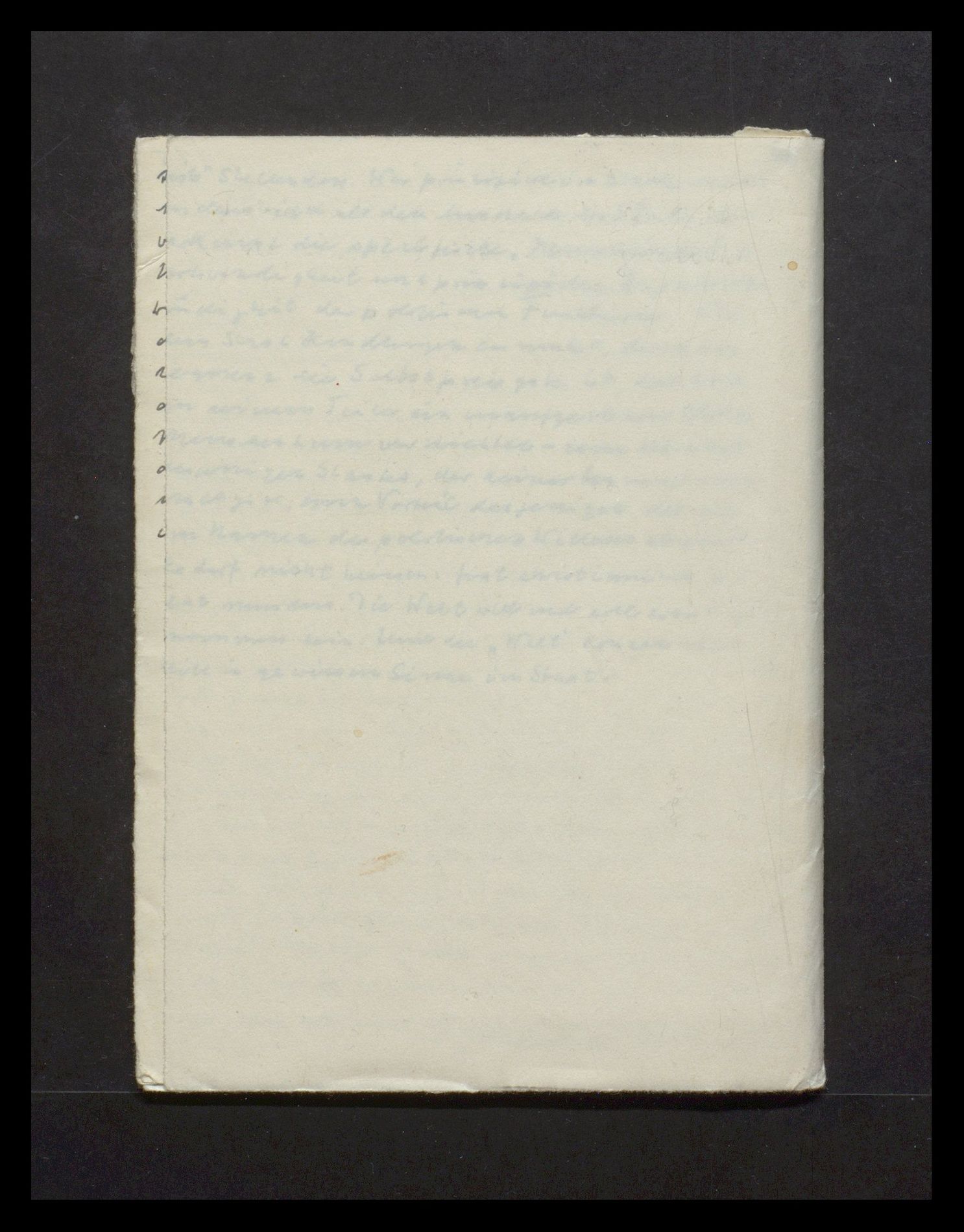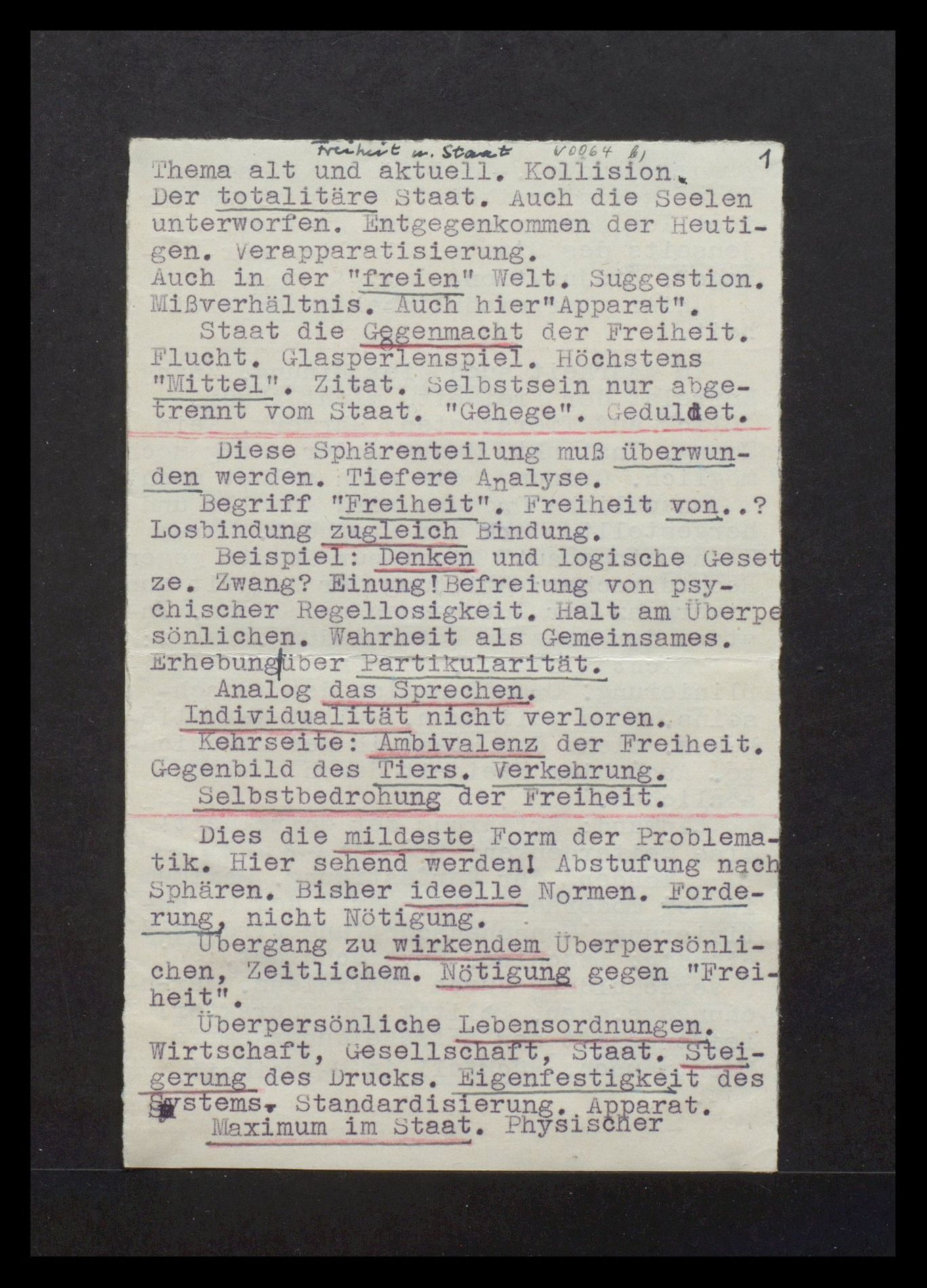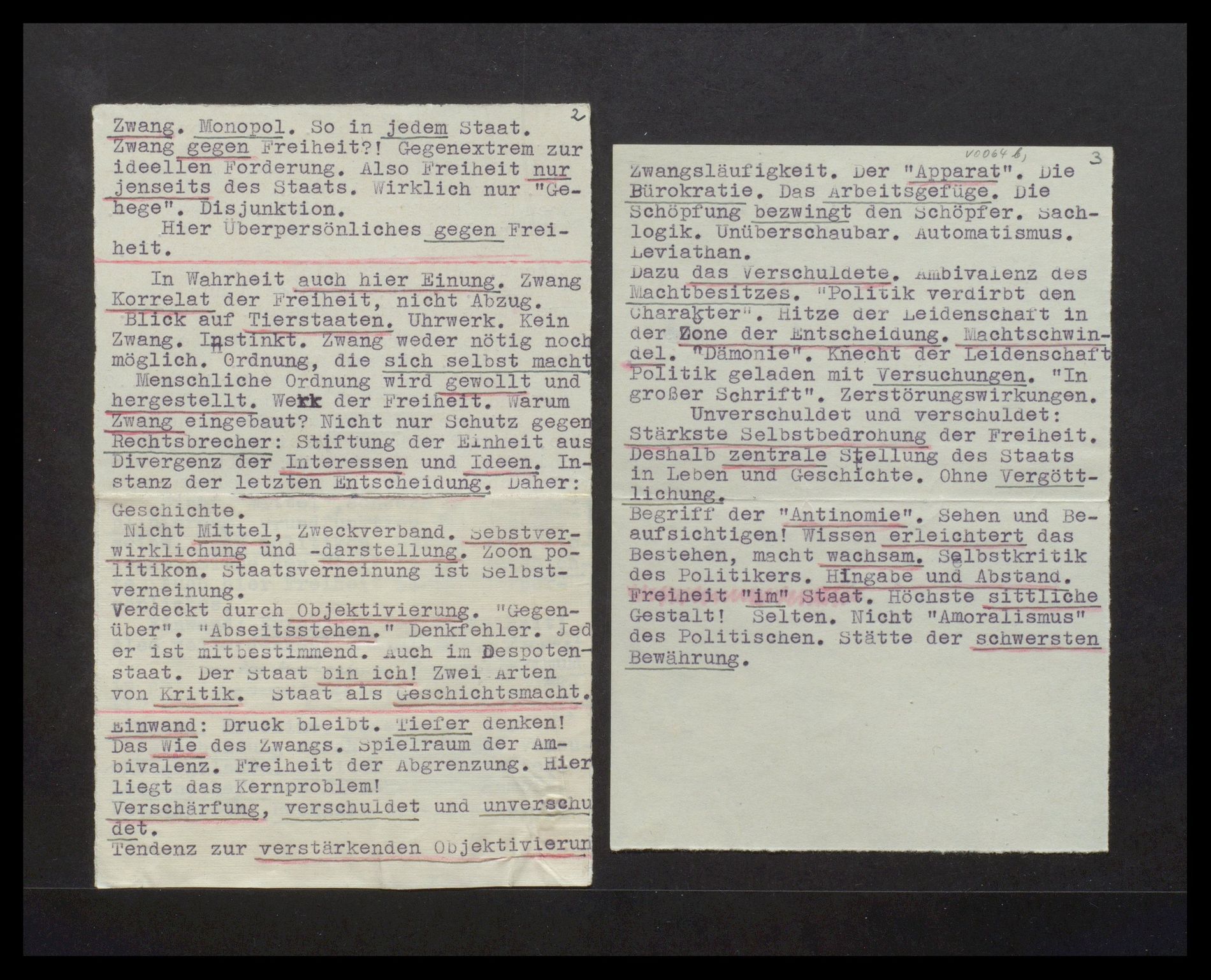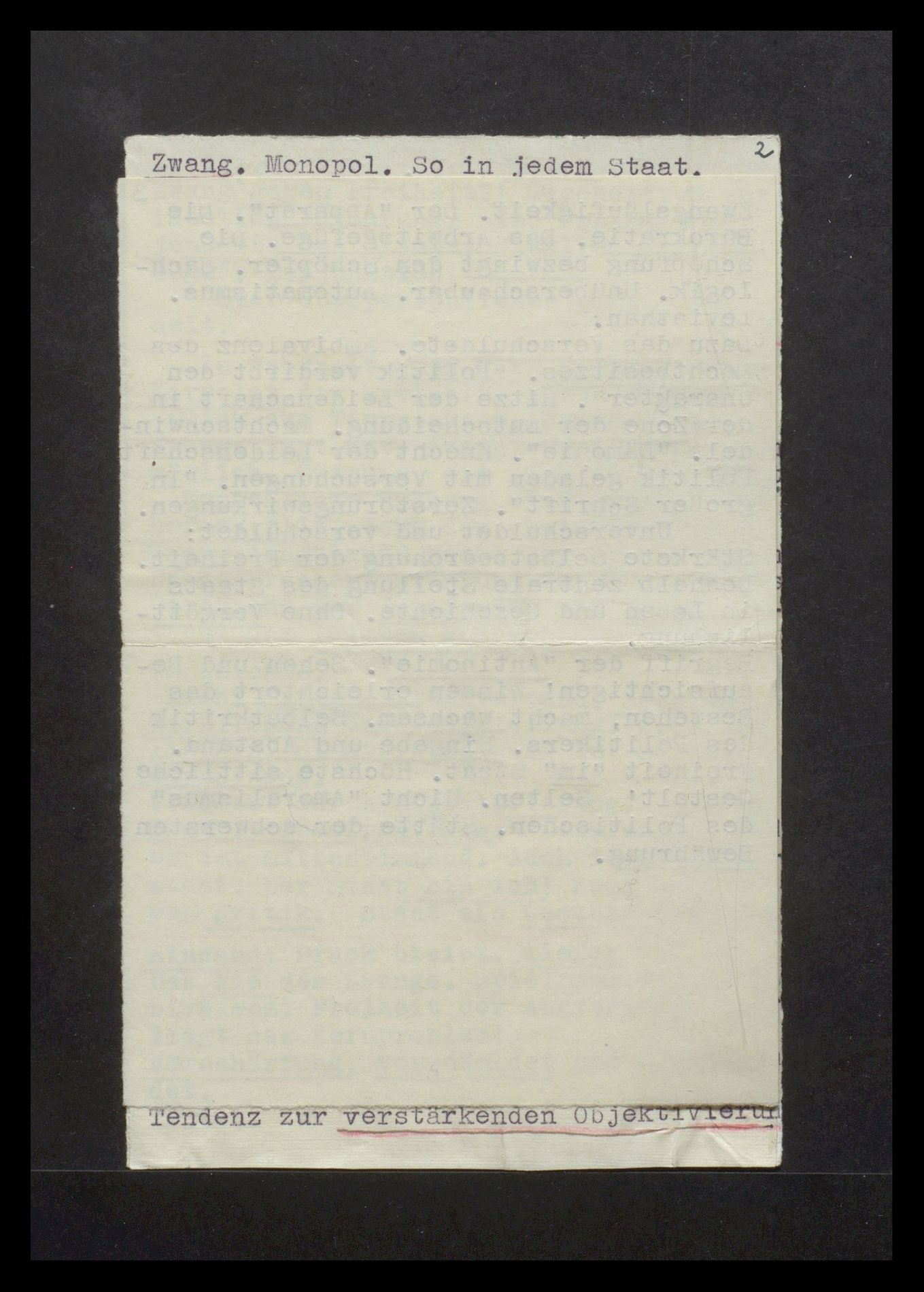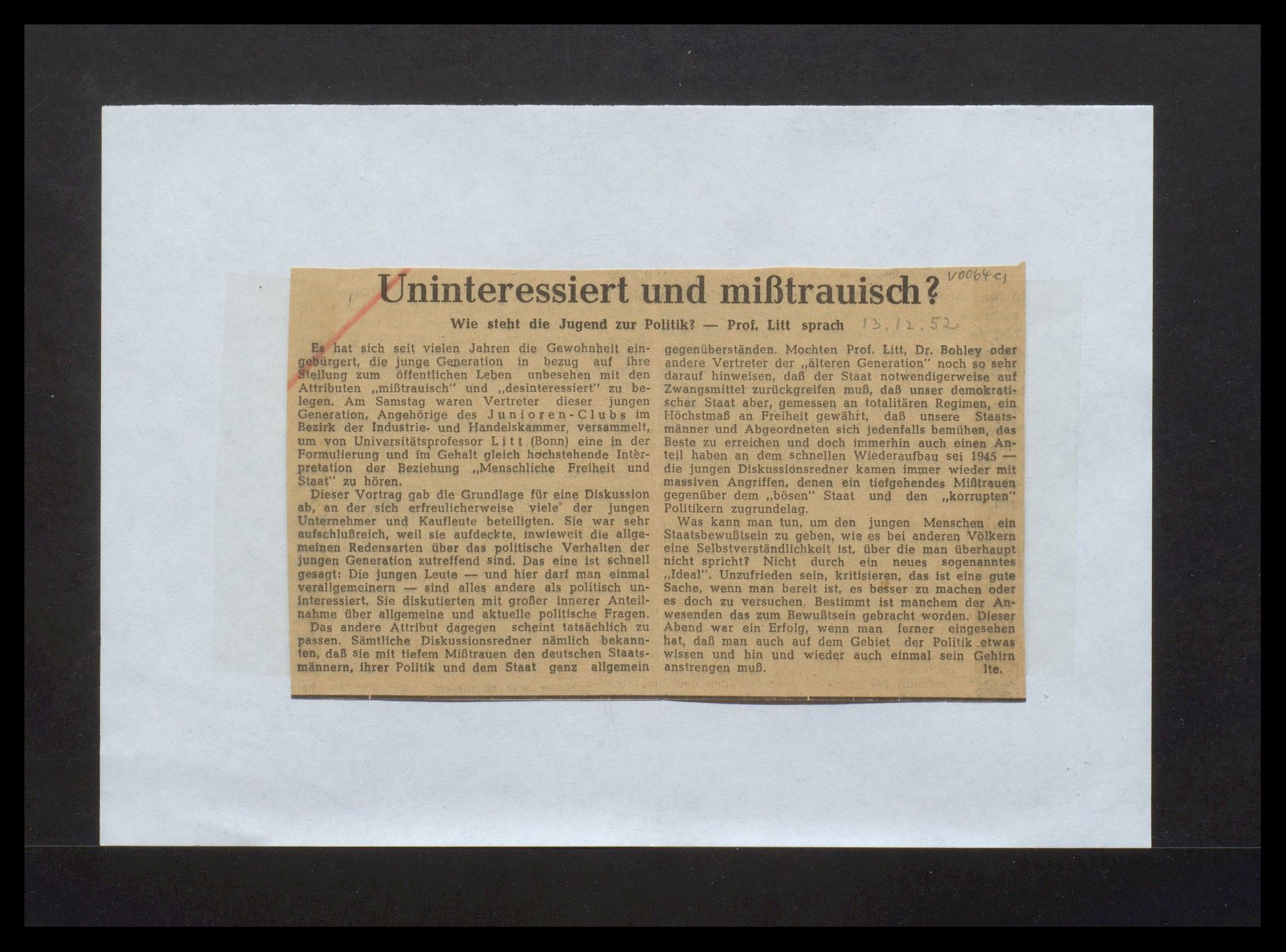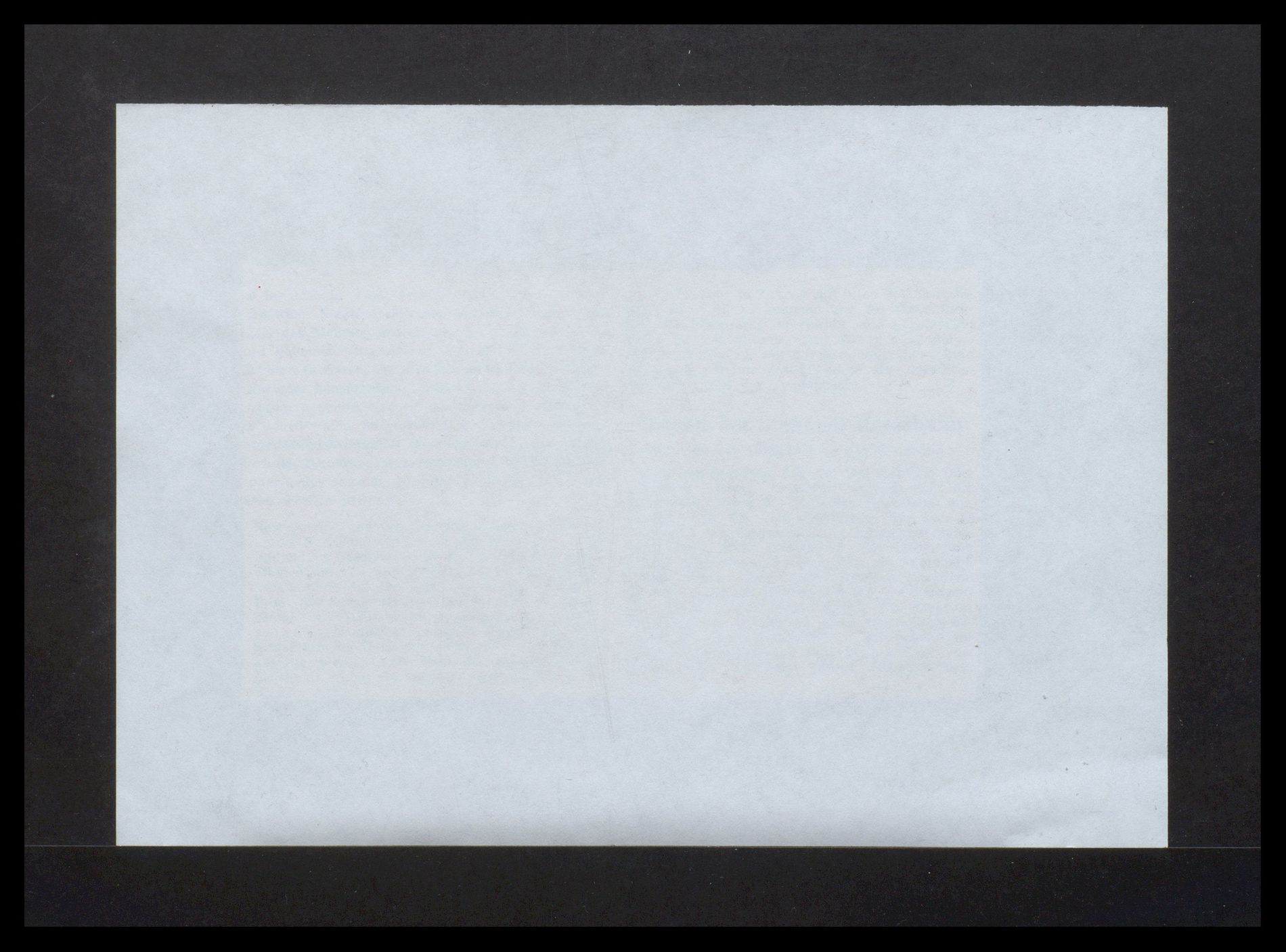| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0064a
(undatiert)
Titelblatt
Die Freiheit des Menschen und der Staat.
1
Ein Thema, das den Menschen beschäf-
tigt hat, seitdem der über den Staat zu re-
flektieren begonnen hat, und das zugleich
von höchster Aktualität ist, weil dies Pro-
blem in der Gegenwart eine neue Gestalt
angenommen und eine kaum je dage-
wesene Dringlichkeit gewonnen hat. Die
Kollision zwischen menschl. Freiheit und
Staat hat eine unüberbrückbare Schärfe
angenommen. Wieso?
Die Antwort ist zunächst zu geben im
Hinweis auf die totalitären Staaten. Worin
liegt das heute? Despotien v. unerhörter
Grausamkeit hat es in den verschiedensten
Epochen der Geschichte gegeben. Die Eigen-
tümlichkeit der modernen totalitären
Systeme liegt nicht nur darin, dass die
Mittel der Beaufsichtigung und totalen
Einspannung des Einzelnen eine nie dage-
wesene Vollkommenheit erreicht haben –
eine Vollkommenheit, die es möglcih
macht, dass ungezählte Millionen von
einem zetralen Punkte aus in jeder Le-
bensregung beobachtet und in allen Ein-
zelhandlungen kontrolliert und dirigiert
werden. Sie liegt vor allem darin, dass sie
mit allen Mitteln auch die Seelen zu un-
terwerfen nicht ohne Erfolge bemüht sind.
2
Vgl. das alte „“:
hier ging es nur um die äussere Zugehörig-
keit zur Kirche. Aber die totalitären Systeme
gesellen dem Druckmittel des äussersten
Terrors die Propaganda, d.i. den Seelenfang,
die Okkupation des Denkens, Fühlens, Wol-
lens. Siehe G. Orwell, 1984, „Er liebte
den grossen Bruder“! Nicht nur die äussere,
auch die innere Freiheit wird attackiert,
und dieser Seelenfang hat deshalb Er-
folg, weil im Menschen selbst etwas die-
sem Werben entgegenkommt. Man will,
ratlos
müde geworden, geführt, eingeordnet werden.
Der Umschlag von den Ausschweifungen des
Individualismus zu dem Ausruhen im
Kollektivismus. Die Verapparatisierung
des Lebens als wirksamste Unterstützung.
Und darin, in dieser Kapitulation, liegt die
Preisgabe des Selbstseins und damit der
Sturz in die tiefste, nämlich die selbstge-
wollte Unfreiheit. Unfreiheit, gegen die
man sich innerlich noch wehrt, ist dem-
gegenüber Freiheit.
Dies die totalitären Systeme: Aber
man hüte sich, zu glauben, dass in der
Welt, die sich selbst die „freie“ nennt, die
Welt diesseits des eisernen Vorhangs, es an
anderen Freiheitsbedrohungen fehle. Gewiss
3
bleibt der ungeheure, oft unterschätzte Unter-
schied, dass hier erstens der Zwang und zwei-
tens (mindestens so wichtig) die staatliche
Monopolisierung einer bestimmten Form
der Seelenbeeinflussung wegfällt. Es kon-
kurriert eine Mehrzahl v. Überzeugungen
u. Programmen, die um die Seelen werben,
die sich gleichsam gegenseitig in der
Schwebe halten und damit den Menschen
vor der totalen Überwältigung schützen.
Aber es bleiben auch hier die dem moder-
nen Mittel der suggestiven Beeinflussung,
der propagandistischen Verbnebelung, unter
deren Einfluss der Mensch sich zwar nicht ver-
gewaltigt fühlt – es wird ja an sein freies
Urteil appelliert – u. doch in Wahrheit seelisch
eingefangen wird. Beachte das qualvolle
Missverhältnis zwischen den Lebenszu-
sammenhängen, die für die Existenz des
Menschen faktisch von Bedeutung sind,
und den Umkreis, den er einsichtig über-
schauen und sachkundig beurteilen
kann. Vergleiche die übersichtlichen Le-
benskreise früherer Epochen, wo noch nicht
alles mit allem zusammenhing! Jenes
Missverhältnis eröffnet der sugestiven
Beeinflussung des Urteils und Lenkung des
Willens ungeheure Möglichkeiten. Und fer-
ner ist die frotschreitende Verapparatisie-
4
rung des Lebens der „freien“ Welt mit der
totalitär regierten gemeinsam. Daher
gewisse Strukturentsprechungen zwischen
den Antipoden Sowjet, Russland und
U.S.A. Der Mensch wird auch hier Ma-
schinenteil und damit – und zwar
hier ungewollt, rein durch die Wirkung
des „Betriebs“ – in seiner Freiheit, seinem Selbst-
sein bedroht. Er droht im objektiven Ge-
triebe und zumal in der Objektivität des
Staates auf- und unterzugehen.
Dies der Grund, weshalb heute +) gerade
die Nachdenklichsten und Feinfühlig-
sten im Staat die Gegenmacht der Frei-
heit meinen erblicken zu sollen. Es gibt
eine Flucht von dem Staat, eine „inne-
re Emigration“ aus dem Staat. Die
Utopie des „Glasperlenspiels“ als liteari-
scher Ausdruck. „The man the
state“. Eine prononzierte „liberale“ Hal-
tung gegenüber dem Staat. Erlauchte
Ahnen in Deutschlands klassischer Epoche.
Wenn die so Gesinnten dem Staat
überhaupt noch etwas zu lassen bereit sind,
dann höchstens diejenige Funktion, die
wir uns am besten durch die Aussprüche
einiger Klassiker erhellen lassen. Kant,
Schiller, Hölderlin. Am lehrreichsten scheint
aber nicht erst seit heute
5
mir die Fassung Schillers, weil sie den Staat
so ganz und gar aus der Sphäre des eigent-
lich Menschlichen heraus und an den
Rand des Daseins verlegt. „Mittel
Zweck“ – ein noch heute weit verbreiteter Ge-
danke.
Hier gibt es ein Selbstsein und da-
mit menschliche Freiheit nur getrennt
vom Staat, im 1. Der Staat bleibt
als Walter, Gehege, Einfriedung draussen –
als Mittel geduldet, weil es ohne ihn nun
einmal nicht geht.
Ich meinerseits bin gewiss, dass es sowohl
mit dem Staat als auch mit der Freiheit des
Menschen erst dann in Ordnung kommen
wird, wenn diese ganze äusserliche Trennung
u. Aufteilung, dieses Nebeneinander einer
gemeinsamen politischen Sphäre und einer
personalen Freiheitssphäre als bicht bloss
irrtümlich in theoret. Sinn, sondern auch
praktisch verwirrend und missleitend
erkannt ist.
Aber dazu bedarf es nun einer subtilen
Analyse der Zusammenhänge. Mit groben
Denkkategorien, wie „Mittel-Zweck“ einer ist,
ist hier nicht Klarheit zu schaffen.
6
Auszugehen ist von der Klärung des viel-
deutigen und belasteten Begriffs „Freiheit“. In
den hier reproduzierten Betrachtungen wird Frei-
heit verstanden als „Freiheit von ....“, Freiheit
„Selbstbestimmung“!
von irgend einer Bindung, speziell von der
Bindung an den Staat. Es gilt zunächst ein-
zusehen, dass damit die Freiheit zumin-
dest unvollständig bestimmt ist – dass Frei-
d.h. die damit gemeinte Losbindung
heit „von ...“ überhaupt + nur damit möglich ist,
nur in der Weise möglich ist, dass der
wenn <... ....> Losbindung über Akt der Be-
freiung zugleich ein Akt der Bindung, der Ver-
pflichtung ist. Wohlgemerkt: nicht zwei vonein-
ander zu sondernde oder gar aufeinenader fol-
gende Akte, sondern ein einziger Akt, der in
einem Ablösung und neue Bindung ist.
Ich illustriere das Gemeinte an einem
uns allen geläufigen innern Vorgang, den
man gemeiniglich gar nicht mit dem
Freiheitsproblem in Verbindung zu bringen
pflegt; dem Vorgang des Denkens und des
Sprechens. Beide Tätigkeiten unterstehen ge-
wissen Grundregeln: denjenigen der Logik
und der Grammatik. Nun kann man be-
züglich der Regeln der Logik oft die Behauptung
hören und lesen, dass das Subjekt „gezwungen“
sein, diese Regeln einzuhalten. Sie werden als
eine „Voraussetzung“ bezeichnet, die das Sub-
jekt wohl oder übel hinzunehmen habe.
Träfe diese Kennzeichnung zu, dann wäre
das Subjekt, wenn und so lange es ,
an die Vorschriften einer äusseren Instanz
7
gebunden, mithin unfrei. Frei wäre es umge-
kehrt dann, wenn es sich von diesen Vorschriften
emanzipierte. Das denkende Subjekt wäre also
zu beklagen, dass es an diese Vorschriften gebunden
ist. Es wäre besser daran, wenn es nicht diesen
Zwingherrschaft über sich hätte. Allein in diesem Ge-
dankengang ein kardinaler Irrtum ent-
halten. Er hat die Annahme zur Grundla-
ge, dass ich im idealen Falle „denkendes Sub-
jekt“ sein würde, ohne mich an irgend welche
Regeln zu halten. Diese Regeln wären etwas über
mein Denekn Hereinbrechendes. Allein in Wahr-
heit verhält es sich so, dass ich nicht etwa
denkendes Subjekt bin und erst mich
den genauen Regeln zu fügen habe – nein:
ich werde überhaupt erst dadurch zum
denkenden, d.h. zum richtig denkenden,
der Wahrheitsfindung fähigen Subjekt, dass ich
mich mit den besagten Regeln einige. Sie
kommen nicht von aussen über mein Den-
ken, sie sind die Seele meines Denkens, ich
bin als Denkender mit ihnen solidarisch,
ich identifiziere mich mit ihnen. Zwi-
schen ihnen und mir besteht das Verhältnis
des Füreinander bestimmtsein. Und jetzt
sehen wir: das Einswerden mit diesen Regeln
ist nicht nur nicht ein Vorgang der Unterwer-
fung, d.h. d. Freiheitsberaubung: er ist ein
vollgültiger Akt der Befreiung, nämlich
wirklich der „Befreiung von ...“. Wovon wurde
8
ich denn frei, in dem ich mit den regeln
eins werde? Von den regellos dahinströ-
menden Fluss der Eindrücke und der in-
neren Vorgänge, der Begehrungen und Leiden-
schaften, die zunächst einmal, genau wie beim
Tier, den Inhalt meines innern Lebens aus-
machen. O lange ich in diesem Fluss dahin-
schwimme, bin ich eben noch nicht „denken-
des Subjekt“, sondern einem ungeregelten Hin
u. Her preisgegeben, ich bin in diesem Sinne
„bloss“ subjektiv!
wirklich unfrei. Und meine Befreiung
vollzieht sich nicht in der Weise, dass ich
mich zunächst einmal aus den Flutun-
gen dieses Stroms herauszöge und dann
erst mit dem geordneten Denken den An-
fang machte, dann erst mich zum
„denkenden Subjekt“ transformierte; nein:
die Heraushebung aus jenem trüben Strom
gelingt nur dadurch, dass ich mich an
jene Regeln halte, in ihnen den Halt, die
Stütze gewinne, ohne die ich nicht aus
jenen Fluss herauskäme. So ist beides voll-
kommen eins: die „Befreiung“ von dem
regellosen Gewirr meiner individuell-sub-
jektiven Seelenvorgänge und das Einswerden
mit den Normen des geordneten Denkens. +)
Das „denkende Subjekt“ hebt sich genau in
dem Masse aus dem Fluss des individuellen
Seelenlebens empor, wie es sich mit den allge-
+) In mir selbst verharrend kann ich nicht „frei“
werden! Vgl. die Unfreiheit des Tiers!
9
meinen Normen des geordneten Denkens iden-
tifiziert. „Befreiung von“ und „Befreiung für“
sind ein und dasselbe. Und der Wert dieser
Befreiung offenbart sich dahin, dass diese Befrei-
ung für nichts Geringeres ist als die Befreiung
für die Wahrheit, d.h. für die Möglichkeit der
Wahrheitfindung. Das so unendlich beschränkte
Geschöpf, das sich Mensch nennt, gewinnt so
den Zugang zu der ewig gültigen, der zeitlosen
Wahrheit. Das darf wahrlich „Befreiung“
heissen! Ich werde frei von meiner indivi-
duellen Partikularität und erhebe mein
Haupt in die Sphäre der allgemeinen Wahr-
heit.
Schon ein wichtiges Ergebnis: frei wurde
ich nicht dadurch, dass ich mich in mich
selbst als diesen Besonderen zurückziehe.
Frei wurde uch durch Einigung mit einem
Überpersönlichen. Eintreten in eine ge-
meinsame Geisteswelt.
Denken ist unlösbar verknüpft mit dem
Sprechen. Leicht überträgt sich der durchge-
führte Gedankengang uaf die Sprache.
Unfreiheit durch „Unterwerfung“ unter die
Gesetze der Sprache? Erst durch Einswerden
mit dem Überpersönlichen dieser Gesetze
werde ich ein sprechendes Subjekt. Eingeschlos-
sen in meine Partikularität bleib ich der
geistigen Befreiung unteilhaftig, die mit
10
dem Eintritt in das Überpersönliche der
Sprache geschieht.
Möglicher Einwand: durch den Eintritt
in diese Welt des Überpersönlichen geht
das Subjekt seiner Individualität verlustig;
es geht im Allgemeinen unter. Und in-
sofern wird das Subjekt dann doch unter-
drückt, es wird: im Medium des Gemein-
samen gelangt das Individuum erst
recht zu bewusster Entfaltung und Ge-
staltung. Beispiel: Sprache und sprechen-
des Individuum. Allgemeines und Be-
sonderes durchdringen sich. Freiheit durch
Verschränkung, nicht durch eigenwillige
Abschliessung.
Nun aber übersehe man nicht die
Kehrseite dieser Befreiung! Die Freiheit,
die Freiheit zum Bejahenswürdigen und
Normgemässen ist, wäre garnicht Freiheit,
wenn sie nicht zugleich Freiheit zum
Normwirdirgen wäre. Siehe das Gegenbild
des Tieres: da ihm der Aufstieg zur Freiheit
durch seine Bindung an Instinkt, Trieb
Umwelt verwehrt ist, ist es auch von der
Möglichkeit der Abirrung und Selbstver-
kehrung ausgeschlossen. Die Ambivalenz
der menschl. Freiheit. Das zeigt aich auch
11
an unserem Beispiel Denken – Sprechen.
Beide dienen auch dem Zerstörerischen, der
Lüge, der Verführung, der Verderbnis. Man
kann in der Verfolgung des Normwidrigen
ein hohes Mass v. denkendem Scharfsinn in
sprachlicher Kunst entwickeln. Auch der In-
dividualität des Bösen verhilft die Sphäre
des Überpersönlichen zu voller Entfaltung
und Wirkung.
Wir sehen: die Freiheit ist nicht aus-
schliesslich, nicht einmal in erster Linie
von aussen bedroht. Sie ist in u. aus sich
selbst, durch die Möglichkeit der Selbstver-
kehrung bedroht. 11a!
11a
Das die Freiheit nicht reine Selbstbestim-
mung, sondern ein Ineinander von Selbstbe-
stimmung und Bindung ist, das hat eine
sehr verhängnisvolle Wirkung. Wenn es so
wäre, dass, wo Freiheit ist, keine Bindung, wo
Bindung ist, keine Freiheit ist, wenn also
Freiheit und Bindung sich auf zwei streng
Zonen
getrennte Gebiete verteilten, dann xx würden
Freiheit und Unfreiheit sich mit sonnen-
klarer Deutlichkeit voeinander unterschei-
den. Weil aber Freiheit von Bindung gleich-
sam durchwirkt ist, darum ist es manchmal
schwer zu entscheiden, ob eine faktisch
bestehende Bindung eine der Freiheit selbst
zugehörige oder eine die Freiheit unter-
drückende ist. Von dieser Unklarheit ma-
chen die, die faktisch auf Knechtung ausge-
hen, reichlich Gebrauch: sie geben vor,
dass die Bindung, die sie selbst ausüben,
eine der Freiheit selbst dienliche, nicht
eine sie unterdrückende sei. Ein Lieblings-
trick der totalitären Systeme! Sie
sich als die einzig wahren Freunde der Freiheit
(„Volksdemokratie“)
Absichtlich habe ich die im Begriff
der Freiheit enthaltene Problematik an
einem Kreis von Phänomenen entwickelt,
die scheinbar v. der Sphäre, die uns be-
schäftigen soll, von denjenigen des Staates,
weit abliegen. Es ist diejenige Sphäre, in
der diese Problematik in der mildesten
Form hervortritt – in der sie eine so wenig
spürbare Gestalt annimmt, dass man
vielfach garnicht darauf kommt, das
Freiheitsproblem gerade in ihr aufzusu-
chen und an ihr zu demonstrieren. Aber
gerade darum ist das Eingehen auf diese
Sphäre für unsere Themastellung so lehr-
Ist
reich. Hat man in dieser Sphäre für alle
Problematik der Freiheit sehend geworden,
dann wird man sie ganz sicher dort
bemerken und richtig auffassen, wo sie
in einer sehr , man möchte
sagen hanebüchenen Form auftritt.
Das Problem der Freiheit ist schlechterdings
überall gegenwärtig, wo es menschlich her-
geht, aber es wandelt seine Gestalt ab, je
nachdem in welcher Sphäre es sich realisiert.
Freiheit, so sahen wir, realisiert sich
durch das Emporsteigen des Individualismus
in die Dimension des Überpersönlichen.
Wir haben bisher das Überpersönliche nur
in Gestalt eines Ideellen, der idealen Norn
kenngelernt: Gesetze des Denkens, des Spre-
chens. Ein solches Ideelles erhebe auch nur
ideelle Forderungen, d.h. solche Forderungen,
die zwar gültig sind, nicht aber als reale
Nötigungen wirken. Nichts zwingt den Men-
schen, ihnen Folge zu leisten. Er kann sie
so gut ignorieren und verletzen wie befolgen.
Sie wehren sich nicht gegen solche Behand-
lung. Ihre Befolgung ist recht eigentlich
„freiwillig“. Daher bemerkt man hier nicht die Freiheits-
problematik!
Allein das menschl. Leben weiss nicht
nur von Überpersönlichem dieser gewaltlos wir-
13
kenden Art. Es weiss von überpersönli-
chen Bindungen, die nicht in der Sphäre des
(zeitlosen) (zeitlichen)
Ideellen zu Hause sind, sondern der realen
in
Welt angehören und deshalb auch mit sehr
realer Weise, im Sinne der spürbaren Nöti-
gung, auf den Menschen einwirken. Des-
halb wird in der Begegnung mit ihnen
auch das Problem der „Freiheit“ in einer sehr
viel brennenderen Weise verspürt – ja, es
kommt zunächst gerade hier und nur hier
zur Diskussion.
Gedacht ist dabei an das Insgesamt
der überpersönlichen Lebensordnungen, wie
sie um all das zeitlich-wirkliche, als das
aktuell gegenwärtige Gefüge von Wirt-
schaft, Gesellschaft und vor allem Staat
xxxxxxxx geläufig sind. Und zwar
verhält es sich so, dass im Übergang von
gesellschaftlich-wirtschaftlichen
der ideellen zur wirtschaftlichen zur
zur staatlichen Normgebung der Charakter
der Nötigung immer schärfer hervortritt. In
die gesellschaftlich-wirtschaftliche Lebens-
ordnung werde ich zwar (wenigstens in der
„freien“ Welt) nicht direkt durch Zwang ein-
gefügt, aber eine Nötigung liegt deshalb
doch schon vor, weil ich, wenn es mir nicht
gelingt, innerhalb dieses in Jahrhunderten
herangewachsenen Systems einen Platz zu
14
finden, ich zum Untergang verurteilt
bin. Siehe die sachbedingte Eigenfertig-
keit dieses Systems. Naturwissenschaft,
Technik, Arbeitsorganisation sind zu
einer Art v. überpersönlichen Faktum ge-
worden. Dieses Überpersönliche wirkt nicht
mit der sanften Überredung einer rein
ideellen Forderung. Es nötigt uns durch
seinen Druck in sich hinein. Nun kommt
noch hinzu, dass das System nicht nur
durch äusseren Druck, sondern auch durch
Standardisierung
innerlich uniformierende Wirkungen
(„Roboter“9 unser Selbstsein bedroht. Die
„Mechanisierung“, „Verapparatisierung.
Von einer Bewusstmacheung und Steige-
rung der Individualität ist hier anschei-
nend keine Rede.
Das eigentliche Maximum aber des
unmittelbar verspürten Druckes auf die
individuelle Freiheit wird erst erreicht
im Staat. Das System Gesellschaft und
Wirtschaft wirkt durch spürbare Nötigung,
aber nicht durch direkten Zwang. Eine über-
zu
persönliche Ordnung aber gibt es, von deren
Wesen der direkte Zwang, ausgeübt durch
phsyische Gewalt ganz unmittelbar hin-
zugehört, ja für deren Wesen er konstitutiv
15
ist: das ist der Staat. +) Er ist der mono-
polistische Verwalter der legitimen phy-
sischen Gewaltanwendung, dieser „ultima
ratio“ der Nötigung. Die „Macht“ des
Staates. Beachte, dass die monopolisierte
Zwangsgewalt im totalitären Staat zwar
am brutalsten und dominierendsten her-
vortritt, aber prinzipiell für den „freiesten“
Staat ebenso unentbehrlich. Jeder Staat,
der sie aus seinem Wesen radikal aus-
scheiden wollte, würde aufhören, zu beste-
hen, also nicht mehr Staat sein.
So ist also der Staat dasjenige überper-
sönliche Ganze, in dessen Begegnung mit
dem Einzelnen die „Freiheit“ die stärkste
Bedrohung zu erfahren scheint. Der Staat
zwingt den, der nicht will wie er will, zu-
letzt mit dem Mittel der physischen Ge-
waltanwendung. Das zu
der vollkommen gewaltlosen „ideellen“ For-
derung. Ist es da zu verwundern, dass
jene Meinungen aufkommen, jene Theorien
entstehen, die dafür halten, dass es eine
Freiheit des Selbst nur ausserhalb, jenseits
des Staates gebe, dass sie nur in Abwehr des
Staates erhalten bleiben könne? Dass Die
+) Dort ein Zwang, der durch Verhältnisse ausge-
übt wird, hier ein Zwang, der durch Menschen ausgeübt wird!
16
bestenfalls nur zuzugeben bereit sind,
dass der Staat als „Mittel“, „Gehege“, Schutz-
macht nun einmal unentbehrlich und
in so weit zu dulden sei? Ein notwendiges
Übel, für ein vollkommenes Menschentum
überflüssig!
Ergebnis: der Mensch ist nur so weit
frei, wie der Staat nicht seine Hand auf
ihn legt, und so weit er seine Hand auf
ihn legt, ist er nicht frei. Eine von Staatlichkeit und freier Mensch-
lichkeit. +) Korrelation: der Machiavellismus.
Hier hätten wir demnach ein Überpersön-
liches vor uns, mit dem der Mensch
nicht nur nicht eins werden muss, um
frei werden zu können – nein, von dem er
sich emanzipieren muss, um frei werden
zu können! Das Gegenteil des an Denken
und Sprechen demonstrierten Verhält-
nisses. Dort Freiheit durch Eins werden
mit dem Überpersönlichen – hier Frei-
heit durch Flucht vor dem Überpersönli-
chen!
Allein der Mensch kann nicht hoffen,
sein Verhältnis zum Staat richtig zu be-
+) Je weniger Staat, destso mehr Freiheit!
<...............5!
So die philosophische (Epikur), religiöse, dichterisch-
künstlerische Segession aus dem Staat.
17
stimmen, so lange er an dieser Entgegen-
setzung festhält. Er muss Einsehen, dass auch
hier das Überpersönliche entgegen dem Anschein,
nicht Abzug an der Freiheit, nicht Gegner der
Freiheit, sondern Bedingung der Freiheit ist.
Ja: sogar die Nötigung, die von dem gesell-
schaftlich-wirtschaflichen Gefüge, sogar der
physische Zwang, den der Staat ausübt: selbst
sie sind nicht Minderung, Verneinung der
Freiheit; sie sind das notwendige Korrelat der
Freiheit. Erst wenn dies erkannt ist, ist das
Verhältnis richtig bestimmt.
Nichts führt so schnell zu dieser Erkennt-
nis wie ein Vergleich der Menschen – mit
der Tierwelt. in der Tierwelt begegnen wir
den sog. „Tierstaaten“. Reibungslos – sicher
funktionierend wie ein Uhrwerk. Bedarf
es hier der Nötigung, des Zwangs? Sie sind
überflüssig, weil jedes Tierindividuum
durch den Instinkt zu der ihm obliegenden
Leistung getrieben wird. Hier ist kein „Wille“,
und das bedeutet: hier ist keine Freiheit.
Alles geschieht durch blindes Getriebenwer-
den. Hier ist deshalb Zwang weder nötig
noch möglich (Zwang setzt immer den
Zwingen-Wollenden voraus!) Hier herrscht
eine die Individuen übergreifende Ordnung
18
(überpersönlich), die sich selbst macht. / 18a Aber
eine Ordnung von Menschenwesen, von denen
ein jedes ein wollendes und mithin ein
„freies“ Wesen ist, macht sich nicht von selbst:
sie muss ihrerseits wieder gewollt und her-
gestellt werden. Eine solche Ordnung aber
ist
eines wahrhaft menschlichen Daseins.
Der Mensch gibt sich selbst die Ordnung ge-
meinsamen Lebens. Sie ist selbst ein Werk
der Freiheit. +) Frage: warum ist dann aber
in dieses sein Werk der Zwang, das Gegenteil
der Freiheit, eingebaut? Die landläufige
Antwort: Schutz gegen Rechtsbrecher, gegen
die Störer der Ordnung. Aber das ist nur
eine Teilleistung der Zwangsgewalt. Sie
ist überhaupt deshalb unerlässlich, weil
bei der notwendigen Divergenz der Wol-
lungen, d.i. sowohl der „Interessen“ als auch
der „Ideen“, eine unbedingt sicher wirkende
Instanz der Vereinheitlichung unent-
behrlich ist. + 18b Diese Instanz nennen wir Staat.
Seine Sache ist nicht die totale Ausmer-
zung der Gewalt – die wäre unmöglich –
sondern die Konzentration der Gewalt und
die legale Regelung ihrer Ausübung. Staat
ist die durch den Zwang garantierte Ord-
nung des gemeinsamen Lebens, die der
Mensch in freier Willensentschliessung sich
+) Daher: Geschichte!
18a
18a:
Die „Tierstaaten“ kennen keine Mannig-
faltigkeit und keinen Wechsel der „Verfas-
sung“ im Neben- und Nacheinander. Na-
tur prägt immer von neuem die gleiche
Gattungsform. Sie haben keine „Geschichte“!
18b:
Siehe die Schwäche des Völkerrechts,
die darauf beruht, dass keine Zwangs-
gewalt da ist, die seine Einhaltung ga-
rantiert.
19
selbst gibt, damit die Vielheit divergie-
render Einzelwollungen zur Einheit gemein-
samer Lebens und Handelns zusammen
gehe. Nur gegen freie Wesen und nur durch
freie Wesen kann der Zwang zu sinnvol-
lem Einsatz gelangen.
Schon hieraus erkennt m an: der Staat
kein Zweckverband
ist nicht äussere Schutzvorrichtung, Mit-
tel zum Zweck, und das auf den Staat bezo-
gene, das „politische“ Handeln ist nicht
eine technische, auf Herstellung einer
Apparatur abzielende Tätigkeit (wie bei
Herstellung eines Zweckverbandes). Vielmehr
ist der Staat die Selbstorganisation, die
Selbstgestaltung der im staatlichen Ganzen
vereingten Willen, ist Herausgestaltung und
fortlaufende Umgestaltung und Betäti-
Selbstverwirklichung u. –darstellung!
gung des politischen Ganzen. Mithin ist
das Insgesamt der Tätigkeiten, die sich auf
dies Ganze beziehen, Äusserung einer Grund-
funktion, die zum Wesen des Menschen unab-
trennbar hinzugehört. Der Mensch ist wirk-
lich . +) Der staatsfreie Zu-
stand ist nicht zu erstrebendes Ideal, sondern
Verneinung des Menschlichen in einem kon-
struktiven Zuge. Siehe den Irrtum jener Klas-
siker, die das politische Tun nicht zu den
„menschlichen“ Grundfunktionen rechnen,
sondern es nur als Vorbedingung der Ent-
+) Er ist so gut poltisches Subjekt, wie er Einzelsubjekt
(Person!) ist. Jenes ist nicht äussere Zutat.
20
faltung des Menschen gelten lassen.
Wodurch wird dieser Sachverhalt so leicht
verdeckt? Dadurch, dass der Staat sich zu
Ordnungen objektiviert und in Menschen bzw.
Menschengruppen objektiviert, die viel, viel-
leicht die meisten Staatsbürger als „ausser-
halb“ ihrer selbst befindlich und unab-
hängig von ihnen selbst agierend anse-
hen. Der Begriff „Staat“ verengert sich zum
Begriff dieser Ordnungen und der sie un-
mittelbar realisierenden Menschen. +) Diese
Verengerung wird begünstigt durch die
extensive Verbreiterung des Staates und die
Versteifung der ihn strukturierenden Ord-
nungen; sie wird erst recht dann nahege-
legt, wenn dieser „engere“ Staat abso-
lut macht und die ihm nicht Angehö-
„von oben“
rigen einer Zwangsherrschaft unterwirft.
Er ist dann eben „drüben“ als der alle poli-
tische Macht monopolisierende Zwingherr;
ich, der Beherrschte, bin hüben, als der am
politischen Lebensprozess Unbeteiligte. Dies
ist das berühmte „Anseitsstehen“. Es tritt auch
in nicht despolitisch regierten Staaten auf,
wenn Teilgruppen sich an dem Staat, wie
er ist, desinteressiert erklären und die
Position des unbeteiligten oder gar übelwol-
lenden Zuschauers beziehen.
+) Institutionen, Personen, Aktionen.
21
Und doch liegt all solchen Erscheinun-
gen der Staatsentbrandung ein gewichti-
ger Denkfehler zu Grunde. Es gibt hier über-
haupt kein „Abseitsstehen“; es besteht nur
in der Einbildung. +) Zunächst aus dem ein-
fachen Grunde, weil der Staat unweiger-
lich einen jeden der ihm Angehörigen
in die Schicksale hineinreisst, die sich
aus den Wollungen und Handlungen der
ihn Leitenden ergeben. „, ....“ Der Abseitsstehende verzich-
tet nur darauf, den ihm zukommenden
Anteil an der Gestaltung dieser Schicksale
zu aktualisieren. Aber auch in dem tiefe-
ren Sinn, dass sein Vorhandensein, dass
die gleichgültige oder ablehnende Hal-
tung, die er gegenüber dem politischen
Geschehen einnimmt, für Gesinnung und
Handlung der im Besitz der Macht Befind-
lichen von mitbestimmender Bedeutung ist.
Auch eine vollkommen geknechtete Masse
von Staatsbürgern gehört, gerade um der in
ihnen lebenden Stimmung willen, zu den
Faktoren, die die politisch Entscheidenden
ständig in Rechnung stellen müssen. Die zwi-
+) Es gibt keine Sezession, auch keine „innere
Emigration“.
22
schen beiden bestehende offene oder latente
Spannung bildet ein grundwesentliches Mo-
ment an dem Leben des ganzen, des in
weiten Sinne verstandenen Staates. +)
Ist das so schon in den despotisch regier-
ten Staaten so, so ist es erst recht so inner-
halb derjenigen Staaten, in denen grund-
sätzlich alle Bürger zur des
staatlichen Willens berufen sind, in denen
also das „Abseitsstehen“ auf dem freien Wil-
lensentschluss der sich abseits Stellenden be-
ruht. Denn hier ist es ja so, dass durch die-
sen Entschluss solche politische Energien, die
sich selbst in den Gesamtprozess hineinge-
ben könnten und solchen, auf die hier vor-
liegenden Möglichkeiten verzichten und
so an ihren Teile – nicht etwa den Staat
seinen eigenen Lauf gehen lassen, sondern
ihn zu der Gestalt, Haltung und Handlung
kommen lassen, die sich daraus ergibt, dass
sich den Anderen das Handelns überlassen und
die in ihnen selbst enthaltenen Möglichkeiten
annulieren. Insofern sind sie in ihrer
selbstgewollten Passivität ungewollt doch
Mitgestalter der staatlichen Wirklichkeit.
Der Staat lebt auch in ihnen, den ihn bewusst
+) Äusserung ist die Bösartigkeit der Selbstbehaup-
tung der totalitären Systeme
23
Verneinenden, den vermeintlich aus ihm
Herausgetretenen.
Ergebnis: der staatliche Lebensprozess
irgendwie in allen, die den Staat,
und sei es auch nur als politisch völlig Ent-
machtete, existieren angehören. Allerwärts
gilt: der Staat bin ich!
Weil ich „dem“ Staat auch dann ange-
höre, wenn ich ihn in seinen gegenwärtigen
Ordnungen und personalen Trägern ablehne, so
kommt alles darauf an, welches der eigentliche
Sinn und das tragende Ethos dieser Ableh-
nung ist. Sie verraten sich in der Art und
Weise der am bestehenden Staat geübten
Kritik. Es gibt die unfruchtbar-nörgelnde
ressentiment geladene Kritik dessen, der wirklich
„draussen“ stehen will und der draussen zu ste-
hen glaubt, der sich garnicht fragt, was
seine Haltung für den Bestand „des“ Staa-
tes bedeutet – es gibt die verantwortliche
und förderliche Kitik dessen, der in seinem
Widerspruch nicht persönliches Missfallen
abreagiert, sondern sich als Anwalt des an-
deren, besseren Staates fühlt, der an die Stelle
des bestrittenen treten soll, der aber aus die-
ser Verantwortung heraus im bestehenden
Staate die Ansätze des Besseren sucht und
sieht +) und der vor allem weiss, dass zu der
+) das überdauernde Staats-Subjekt, „Staatsperson“.
24
Die ewig notwendige Kritik! Gewissen!
eigenen Verneinung die tätige Willenbereit-
schaft als komplement hinzugehört.
Nur weil der Staat so mit seinen
Wurzeln in das Innerste jedes Menschen
hineinreicht: nur darum kann er ix für
Wesen und Schicksal des Menschen die
bestimmende bedeutung haben, von der
die Geschichte in ihrer ganzen Erstreckung
Zuegnis ablegt. xxx Als ob eine blosse
äussere Zweckvorrichtung, eine „Hülse“,
eine so durchgreifende geschichtlich prä-
gende Macht sein könnte!
Einwand: ändern dann diese theore-
tischen Spekulationen etwas an der Tatsache,
dass der Staat, je nach seiner Beschffen-
heit in höherem oder geringerem Grade, den
Menschen in seiner Freiheit einengt? Ändern
sie etwas an der Erfahrung der Frei-
heitsberaubung, die dem Menschen in
Staat und zumal im modernen Staat
widerfährt? Mein Leiden am Staat wird
nicht leichter, mein Widerspruch gegen
den Staat nicht milder, wenn ich mir
sagen darf, das Leiden und Widerspruch
selbst, Teilhabe am politischen Lebenspro-
zess bedeuten. Die Flucht vor dem Staat ist
nicht bloss Irrtum Unerleuchteter, das Strben
nach überstaatlicher Sphäre nicht Frevel!
25
Aus diesem unüberhörbaren Einwand
geht hervor, das das Problem mit unseren
bisherigen auf „Rettung“ des Staates ausge-
henden Überlegungen noch nicht erledigt ist.
Wir müssen weiter denken!
Wir haben gesehen, dass die Art von Frei-
heitsverkürzung, die wir „Zwang“ nennen, vom
Wesen des Staates unabtrennbar und insoweit
grundsätzlich gerechtfertigt ist. Wir haben ge-
sehen, dass selbst der Angehörige des Staates,
der diesem Druck im höchsten Masse ausge-
setzt ist, darum dem Staate anzugehören
nicht aufhört. Allein mit dieser prin-
zipiellen Feststellung ist nicht etwa die durch
den Staat erfolgende Freiheitsverkürzung
in jeder Gestalt heilig gesprochen. Im Ge-
genteil: da nun einmal der Zwang un-
ter allen Umständen schmerzlich ver-
spürt und als Einengung des personalen
Seins empfunden wird, wird erst recht
die Frage brennend: in welchem Umfange,
in welcher Form, an welcher Stelle ist den
Zwanganwendung geboten und somit
es
zu bejahen – wo ist sie zu verwerfen? Das prin-
zipielle zu bejahende Dass lässt dem Wie
noch einen weiten Spielraum, und von
diesem Spielraum dürfen wir gewiss sein,
dass innerhalb seiner die zum Wesen der
+) das Eingreifen des Staates und mit ihm die
Möglichkeit und Androhung der
26
Freiheit gehörige „Ambivalenz“ sich breit
entfalten wird. Auch über den Gebrauch des
Zwangs entscheidet die Freiheit des über sie
Verfügenden, auch hier heisst es entscheiden
ob, wo, wie er gesetzt wird. Der Zwang,
der die Freiheit einschränkt, will in Freiheit
bestimmt und – begrenzt sein.
Erst wenn wir dieser Frage nachgehen, wird
es offenbar, dass und weshalb das Problem der
Freiheit in der Sphäre des Staates seine kompli-
zierteste und undurchsichtigste Gestalt an-
nimmt. Sie ist so undurchsichtig, dass der
Schein entstehen kann, als sei der Staat die Auf-
hebung der Freiheit, als ob die Freiheit erst da
beginnt, wo der Staat aufhört (Gebietstei-
lung!)
Zweierlei kommt zusammen, um diese
Verschärfung herbeizuführen: einerseits eine
Entwicklung, die ohne Verschulden des Men-
schen, durch die Natur der Sache selbst den
Druck, den der Staat auf den Menschen aus-
übt, immer empfindlicher werden lässt – an-
dererseits eine Verwicklung, die im Wesen des
wol-
27
lend handelnden Menschen begründet ist
und daher auf sein Verschulden zurückgeht.
In erster Hinsicht heisst es erkennen,
dass die Ordnungen des sich selbst organi-
sierenden menschlichen Lebens in Wirt-
schaft, Gesellschaft und zuhöchst Staat
die immanente Tendenz haben sich mehr
und mehr zu „objektivieren“, d.h. insti-
steifen
tutionell zu verfestigen, und so eine
Ablaufsform anzunehmen, die man
mit Recht als „Zwangsläufigkeit“ (ein aus
dem Maschinell-Technischen entnom-
mener Ausdruck!) bezeichnet. Das Ineinan-
dergreifen von Naturwissenschaft, Technik
und wirtschaftlicher Produktion erzeugt
den „Apparat“ des allumfassenden Arbeitsge-
füges, der Staat nimmt gleichfalls mehr
und mehr die Gestalt eines riesenhaften
Mechanismus an, und alles dies funk-
tioniert schliesslich nur deshalb in der durch
die Sache selbst vorgezeichneten Weise, weil
die Zwangsgewalt xx des Staates die Einhal-
tung der wesentlichen Regeln der Kooporation
garantiert. +) Das Ganze ist eine Schöpfung
des Menschen und doch zwingt es schliesslich
seinen Schöpfer unter sich. Simmels „Tra-
gödie der Kultur“. Es lebt aus immer erneu-
ten Willensimpulsen und regiert doch den Willen,
+) Es muss immer mehr „regiert“ werden! Bürokratie.
28
so dass es sich Kraft eigener Sachlogik
nur dem Willen des Menschen zu entzei-
hen scheint, sondern sich geradezu gegen
die Freiheit seines Schöpfers zu kehren
scheint. Das Verhältnis Mensch – Maschine
als anschauliches Paradigma. Das Werk
der Freiheit wendet sich gegen die Freiheit. +)
Insoweit handelt es sich um eine
Entwicklung, an der den Menschen kein
Verschulden trifft. Sehen sie erklärt in
gewissen Masse die schmerzhaften Er-
fahrungen, die dem Menschen im Verkehr
mit diesem Überpersönlichen beschert
sind. Aber hinzu kommt ein Zweites,
das auf dem Schuldkonto des Menschen
zu buchen ist. Wir sahen oben, dass die
Freiheit, die der Mensch durch Einung
mit dem Überpersönlichen gewinnt,
„ambivalent“, dass >die> Freiheit so gut
zum Aufbauend-Heilsamen wie zum
Verderblich-Zerstörenden ist. Jede Freiheit
ist mit gefährlichen Versuchungen ge-
laden. Aber dieser versucherische Charakter
macht sich nicht in allen Sphären mit
gleicher Stärke geltend; er stuft sich je
nach Eigenart der Sphären ab. Wir haben
jetzt zu erkennen, dass die Sphäre
Überpersönlichen, das im Staat kulminiert,
+) Folge: der Staat (= Staatsverwaltung) erscheint dem
Individuum als ein Äusseres und Fremdes. Leviathan.
29
den Charakter des Versucherich- Verderblichen,
des auf Abwege Leitenden in höchstem Masse
trägt.
Es handelt sich um den Sachverhalt, den
das vulgäre Denken in der Formel „Politik ver-
dirbt den Charakter“ ausdrückt. Was ist mit
ihr gemeint? Einmal: in der Sphäre der
steigern
Politik ballen sich die Leidenschaften, die
edlen wie die gemeinen, zur Siedehitze empor,
weil der Staat die Instanz der letzten, weil
durch die Zwangsgewalt garantierten Ent-
scheidung ist. „Es geht ums Ganze“! Man
sehe als Beispiel nur einmal den Wahl-
kampf, erst recht den Krieg. Kampf um
die Macht! +) Und was bedeutet die Macht,
um die der Kampf geht, für den Menschen,
der nach ihr begehrt und der sie ja nach-
Macht wird Selbstzweck.
dem gewinnt? Einen beglückenden, be-
rauschenden Besitz. Machtrausch, Macht-
kitzel, Machtkoller. Wieder ist es die Verfü-
gung über die legitime Zwangsgewalt, die
die Unbedingtheit des Machtbesitzes und
des Machtgebrauchs garantiert. Ein Mensch
verfügt schrankenlos über Menschen! Macht-
„Dämonie“
schwindel, Selbstvergötterung, Lust der Men-
schenknechtung, Menschenvernichtung. Hier
zeigt sich die negative Seite der Ambivalenz
+) Versuchung zu skrupelloser Verwendung al-
ler Mittel entspricht der Hitze des Begehrens.
30
in furchtbarer Grösse. Und hier zeigt sich,
wie diese negative Entwicklung wieder
aus der Freiheit tief in die Unfreiheit zu-
rückführt. Dabei denke ich nicht nur an
die Unfreiheit der durch den Inhaber der
Macht Geknechteten. Ich denke auch
und vor allem an die Unfreiheit des der-
gestalt die Macht Ausübenden. Denn er
ist genau in dem Masse der Unfreie, wie
er zum Knecht der in ihm wühlenden
Leidenschaft, des Ehrgeizes, der Macht-
gier, der Verfolgungsmacht wird. +) Das Über-
persönlichste wird ihm zum Mittel der
Befriedigung des Niedrigst-Persönli-
chen. So gilt der zitierte Satz in der Ab-
wandlung: Politik ist geladen mit Ver-
suchungen, die den Charakter verderben
können. Sie ist dasjenige Überpersönliche,
mit dem der Mensch nicht eins werden
kann, ohne den verhängnisvollsten Mög-
lichkeiten des Abgleitens ausgesetzt zu
sein. Sie ist zugleich diejenige Sphäre, in
der dieses Abgleiten die riesenhaftesten
Zerstörungswirkungen nach sich zieht. Der
Mensch „in grosser Schrift“ (Platon)
So zeigt sich: einerseits ohne Verschulden,
andererseits mit Verschulden des Menschen
ist der Staat diejenige Form des Überper-
+) Der Riesenhaftigkeit des beherrschbaren „Appa-
rats“ entspricht die Heftigkeit des Machtrauschs
31
persönlichen, mit der der Mensch auf der
einen Seite sich einen muss, um „frei“ zu
sein, in der aber auf der anderen Seite die Selbst-
bedrohung der Freiheit die gefährlichste Form
annimmt. Gerade hier zeigt es sich, was es
heisst, Mensch sein. Der Mensch „in grosser
Schrift“. Wie recht hatten doch alle die Denker,
die dem Staat in Menschenleben und –ge-
schichte eine zentrale Stellung anwiesen.
Dabei werden wir durch die Einsicht in die
Dämonie des Politischen vor jeder vergöttli-
chung des Staates bewahrt.
Begriff der „Antinomie“ wird eingeführt.
Es gehört zum Wesen des „freien“ Menschen,
staatlich zu leben, zu wollen und zu han-
deln. Aber diese Betätigung samt den aus
ihr hervorgehenden Schöpfungen sind zugleich
die schwerste Selbstbedrohung der Freiheit.
Wie hat sich der Mensch zu einem sol-
chen antinomischen Sachverhalt zu stel-
len? Er hat ihn zunächst zu sehen, sich
von ihm wissende Rechenschaft zu geben. Dass
er ihm nicht wissenlos wie einem dunklen
ausgeliefert ist, bewiesen unsere
eigenen Darlegungen. Aber dies Wissen
darf nicht ein Zuschauen bleiben, das an
der bescherten Sache nichts ändert. Eine Anti-
32
nomie, die in ihrem Dass und ihrem Wie
durchschaut ist, kann zwar auf Grund dieses
Wissens nicht beseitigt werden, wohl aber
nimmt sie schon dadurch, dass sie als sol-
che gewusst wird, eine andere Gestalt an.
Einerseits nimmt ihr dies Wissen Vieles von
ihrer Schwere. Am schwersten drückt immer
das Unverstandene, das geistig nicht Bewäl-
tigte. Alle Trotzreaktionen bis hin zur nihi-
listischen Verzweiflung entzünden sich am
nicht Begriffenen. Andererseits eröffnet das
besagte Wissen die Möglichkeit, den anti-
nomischen Sachverhalt unter Aufsicht zu
halten, vor den in ihm enthaltenen Gefähr-
dungen auf der Hut zu sein, die ihm inne-
wohnenden Versuchungen zu sichten und
zu bekämpfen. Jene permanente Gewis-
senskritik, die zur Wirklichkeit des Staates hin-
zu gehört, muss vor allem Kritik am poli-
tischen Planen, Wollen und Handeln des
eigenen Selbst sein (Picard: „Hitler in
uns“) Selbstbeaufsichtigung, Selbstzüge-
lung, Selbstbehütung. Eine Vereinigung
von Darinstehen und Darüberstehen, Hin-
gabe in verantwortlichem Handeln und
Abstandhalten zwecks Selbstbewahrung.
Dies ist die als solche gewusste und kontrol-
33lierte Antinomie. In dieser Haltung rea-
lisiert sich dann die „Freiheit“ in der dieser
Sphäre angemessenen Gestalt: nicht als
Freiheit „vom“ Staat, ausserhalb des Staates,
sondern als Freiheit „im Staat“.
Wenn aber der Staat die Sphäre ist, in der
die Freiheit am stärksten bedroht ist („Poli-
tik verdirbt den Charakter“), so ist auch
die Freiheit, wenn sie sich innerhalb dieser
Sphäre gegenüber allen Bedrohungen
siegreich behauptet, eine der wertvollsten
Gestalten des sittlichen Lebens. Politik „ver-
dirbt“ nicht nur den Charakter, sie ist
auch eine unvergleichliche Erprobungs-
und Bewährungsstätte des Charakters. Je
grösser die Versuchung, destso verdienstli-
cher die Bewährung. Grossartigste Darstel-
lung ist der leitende Staatsmann, der in
Vollbesitz der Macht ist und doch durch
Selbstkontrolle seines politischen Willens
sich vor der Dämonie des Machtbesitzes
zu bewahren weiss. Weder unterliegt er
den Zwangsläufigkeiten des objektivierten poli-
tischen Systems noch erliegt er den Versu-
chungen des Machtkitzels. Nicht umsonst
ist diese Gestalt so selten im geschichtlich-
politischen Leben.
34
Dies das Gegenteil der Lehre, die die „Amo-
ralität“ des Politischen vertritt. Im Gegenteil:
die Zone der Politik ist die Zone der schwer-
sten moralischen Bedrohung, aber auch der
glorreichsten moralischen Bewährung. Gross-
artige Verwirklichung der „Freiheit“
Das Wissen um die besagte Antinomie
ermöglicht es dem Menschen, auch inner-
halb des totalitären Staates die innere Frei-
heit zu wahren, der seine äussere Freiheit
vollkommen beseitigt. Erst die innere Ka-
pitulation besiegelt die Unfreiheit end-
gültig. Hierin, nicht in der Härte des äusse-
ren Drucks, liegt die Gfährlichkeit der
totalitären Systeme, ihre entmenschlichende,
depersonalisierende Wirkung.
mit der der Mensch auf der
35
Von diesen allgemeinen Erwägungen her
bestimmt sich auch die Antwort auf die
heute so oft gestellte Frage, welche Stellung
der Christ gegenüber dem Staat einzuneh-
men habe. Auch die „Freiheit eines Chris-
tenmenschen“ ist nicht eine Freiheit „ausser-
halb“ oder „jenseits“ des Staates – unbeschadet
der Tatsache, dass Glaube und Hoffnung
des Christen ihren letzten Orientierungspunkt
jenseitsder zeitl.-geschichtl. Welt und so auch
des Staates haben. Auch diese freiheit hat sich
innerhalb des Staates als solche zu bewähren.
Das aber kann sie wiederum nurr dann,
wenn sie nicht im Namen des Transzenden-
ten dasjenige verneint oder missachtete,
was zum Wesen von Staat und Politik unab-
trennbar hinzugehört. Ungeachtet aller Span-
nungenzwischen Christlichkeit und Staat ge-
hört der Staat als solcher zu den Wirklichkei-
ten, die der christl. Mensch wie jeder als Teil
seiner Menschlichkeit anzuerkennen hat.
Alle „christliche“ Kritik am Staat ist nur dann
sinnvoll, ja gefordert, wenn sie nicht den
Staat zumutet, dasjenige an sich zu ver-
neinen, was ihn zum Staat macht. Eine
Kritik, die das vergisst, steht in einer Linie
mit der unfruchtbaren Nörgelei des sich „ab-
36
seits“ Stellenden. Wer prinzipiell im Staate nichts
Anderes sieht als den Ausdruck der Sünde, der
verkennt die spezifische „Menschlichkeit“, d.i.
Notwendigkeit und prinzipielle Bejahungs-
würdigkeit der politischen Funktion. Wer
dem Staat Handlungen zumutet, deren Kon-
sequenz die Selbstpreisgabe ist, der hilft
an seinem Teile ein unaufgebbares Stück
Menschentum vernichten – zum Nachteil
desjenigen Staates, der seiner Zumutung
nachgibt, zum Vorteil desjenigen, der sie
im Namen des politischen Willens abweist.
Es darf nicht heissen: fiat christianitas, per-
lat nundus. Die Welt will und soll ernst ge-
nommen sein. Und die „Welt“ konzentriert
sich in gewissem Sinne im Staat. |