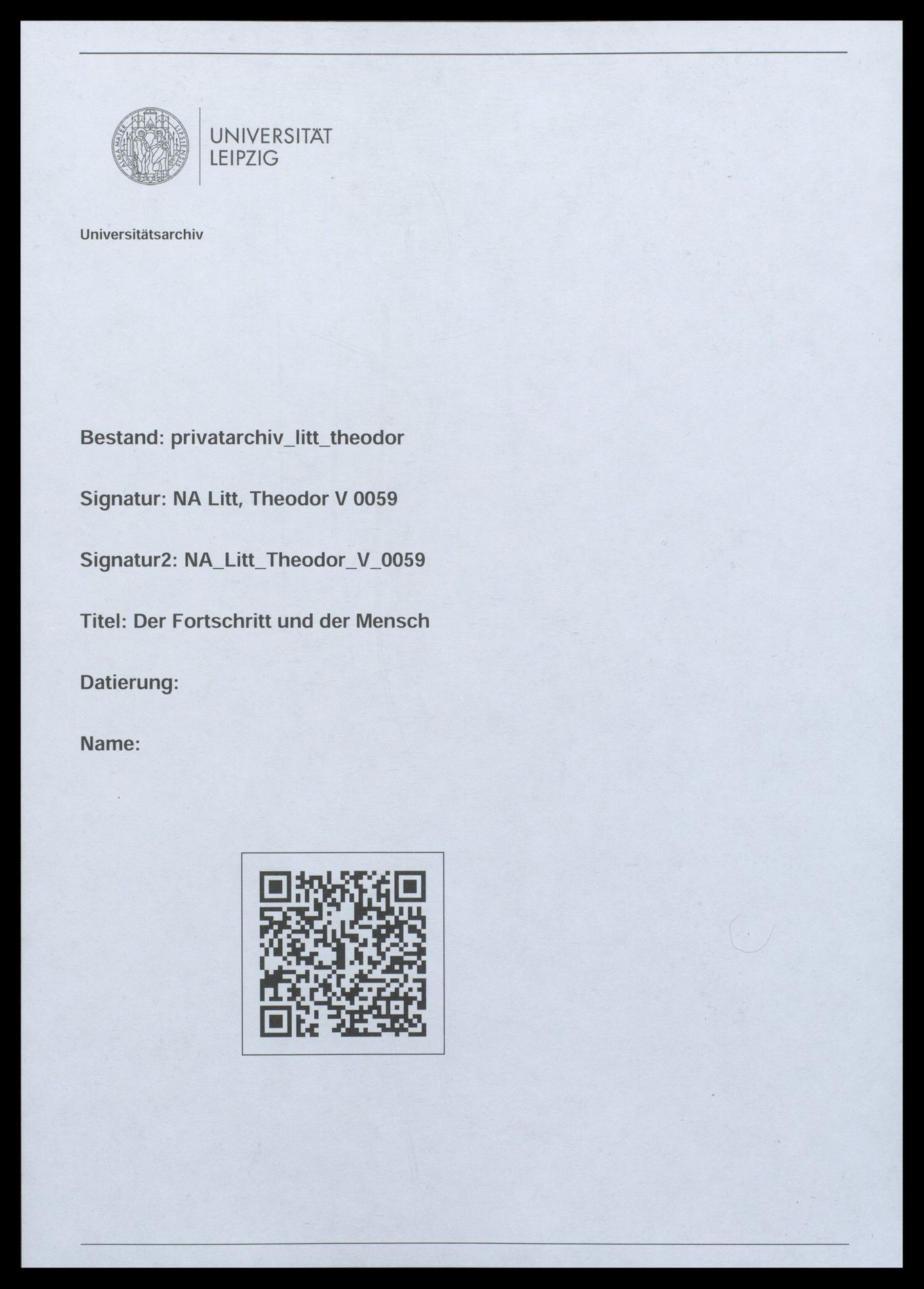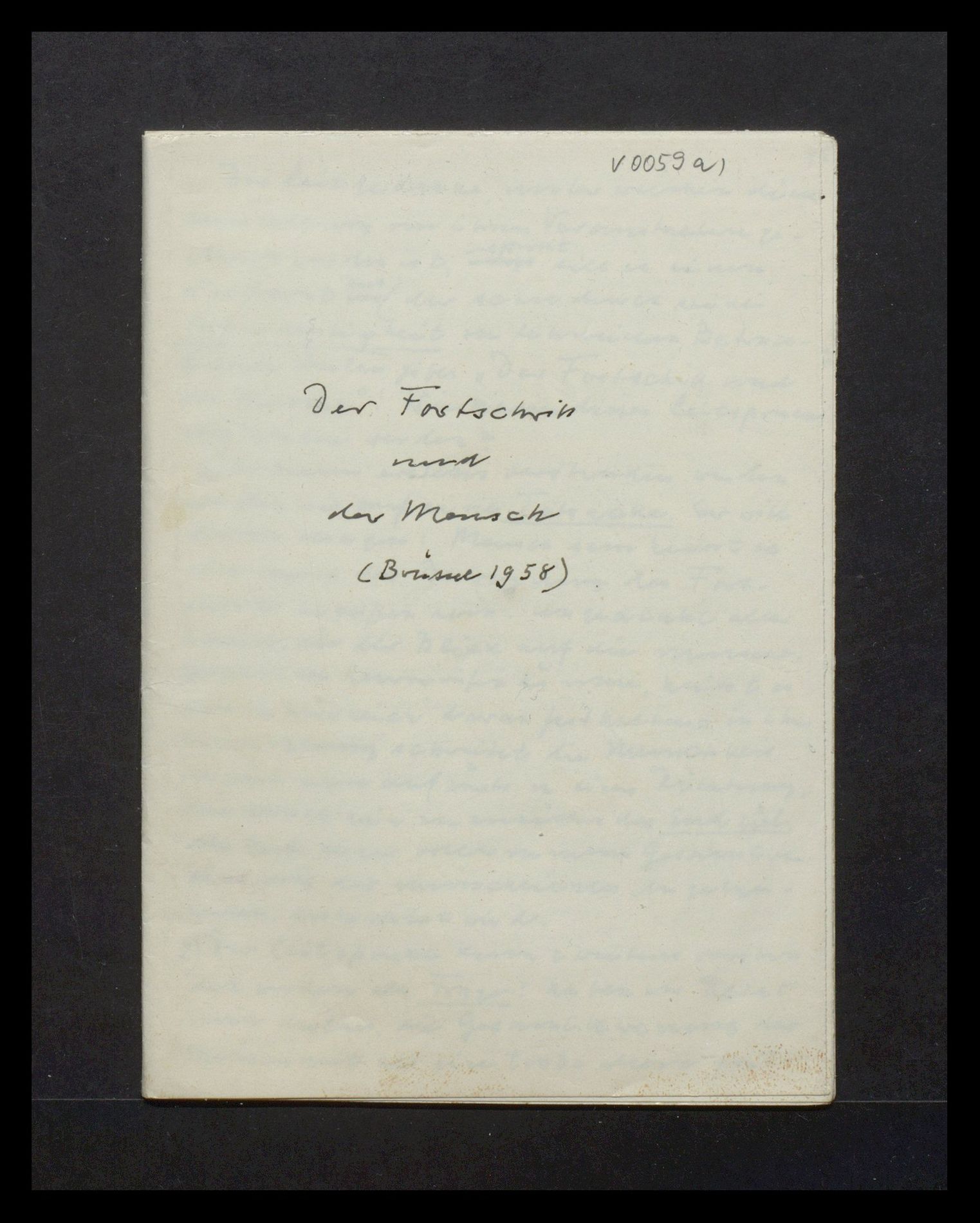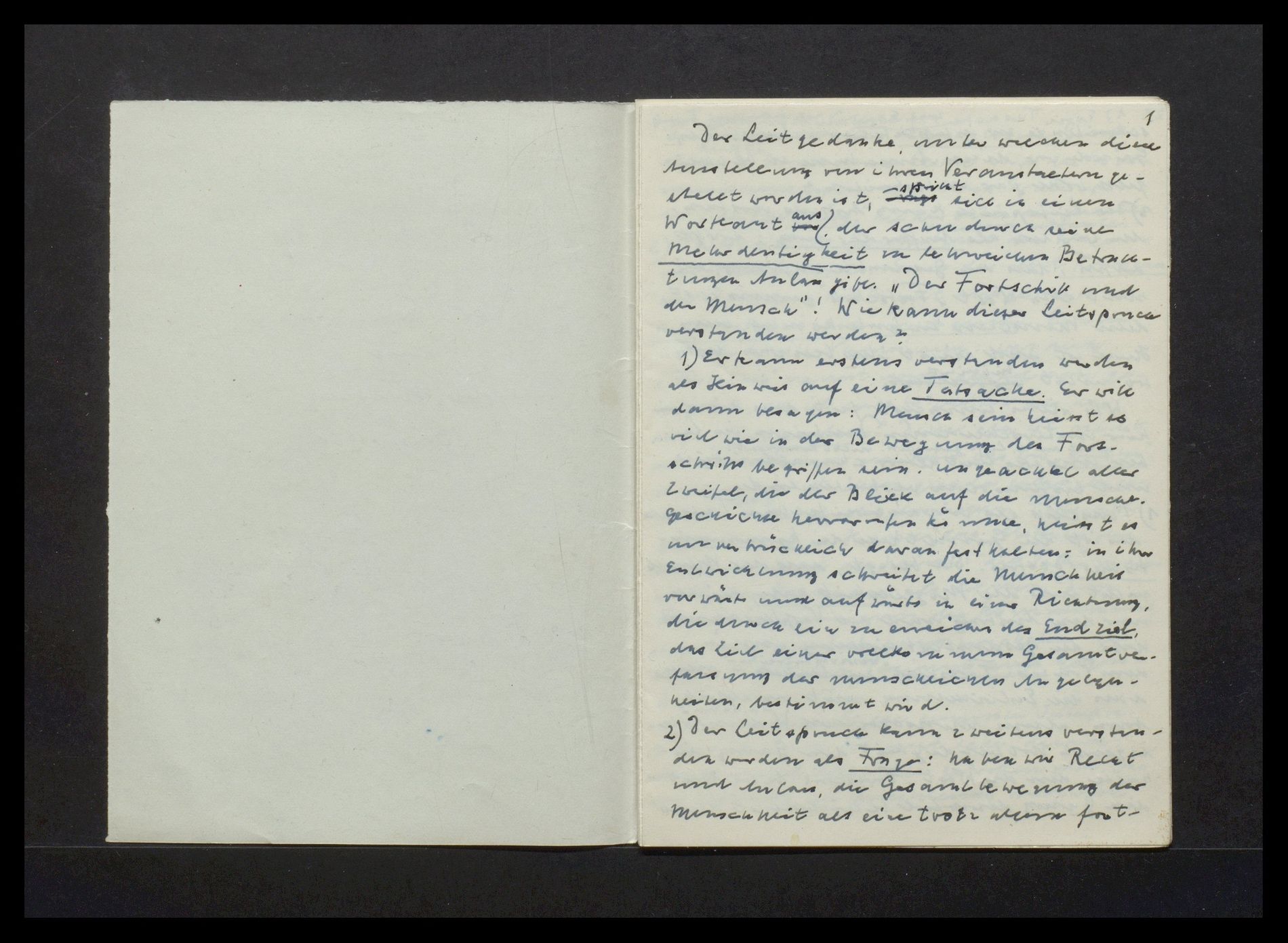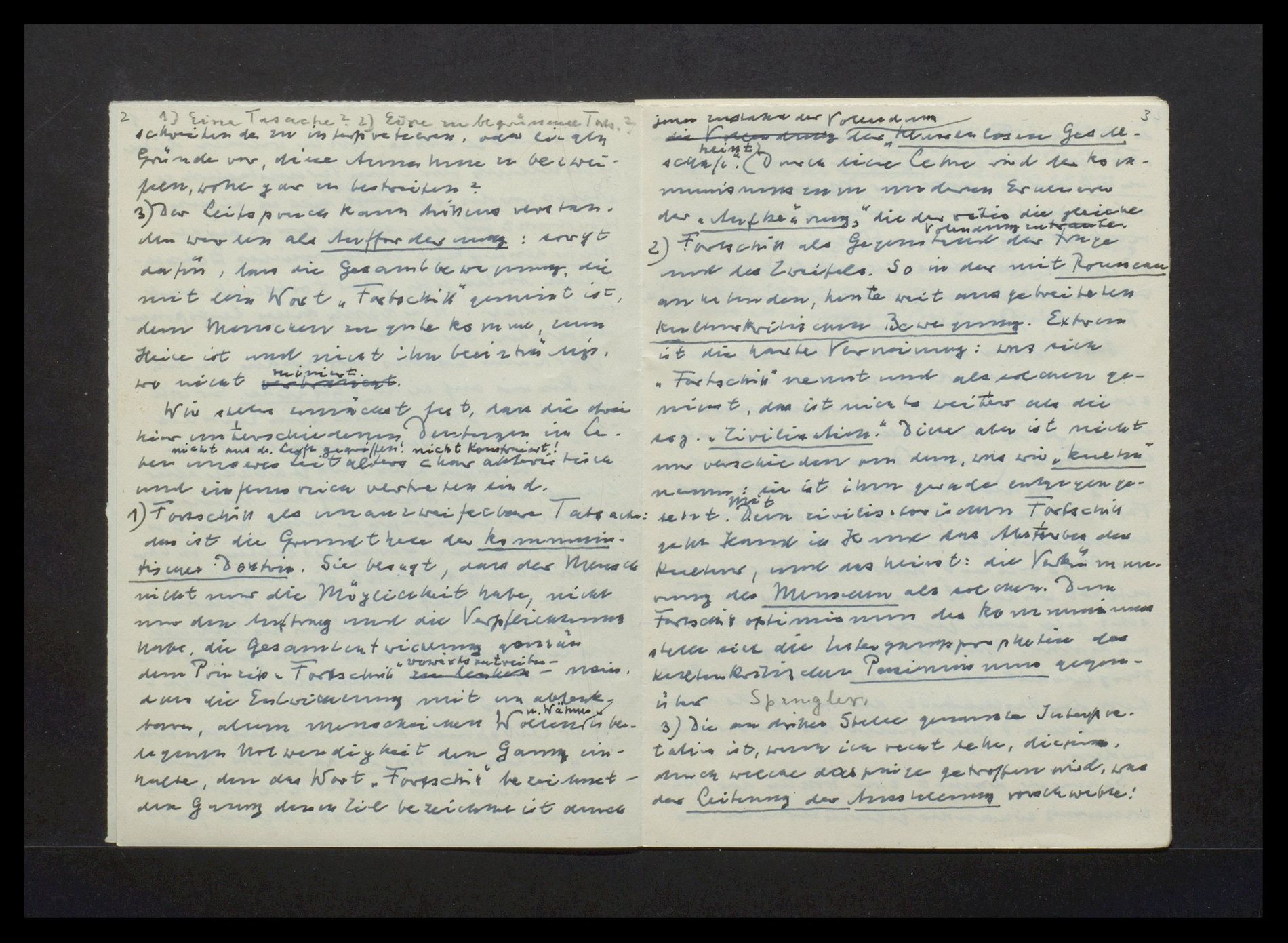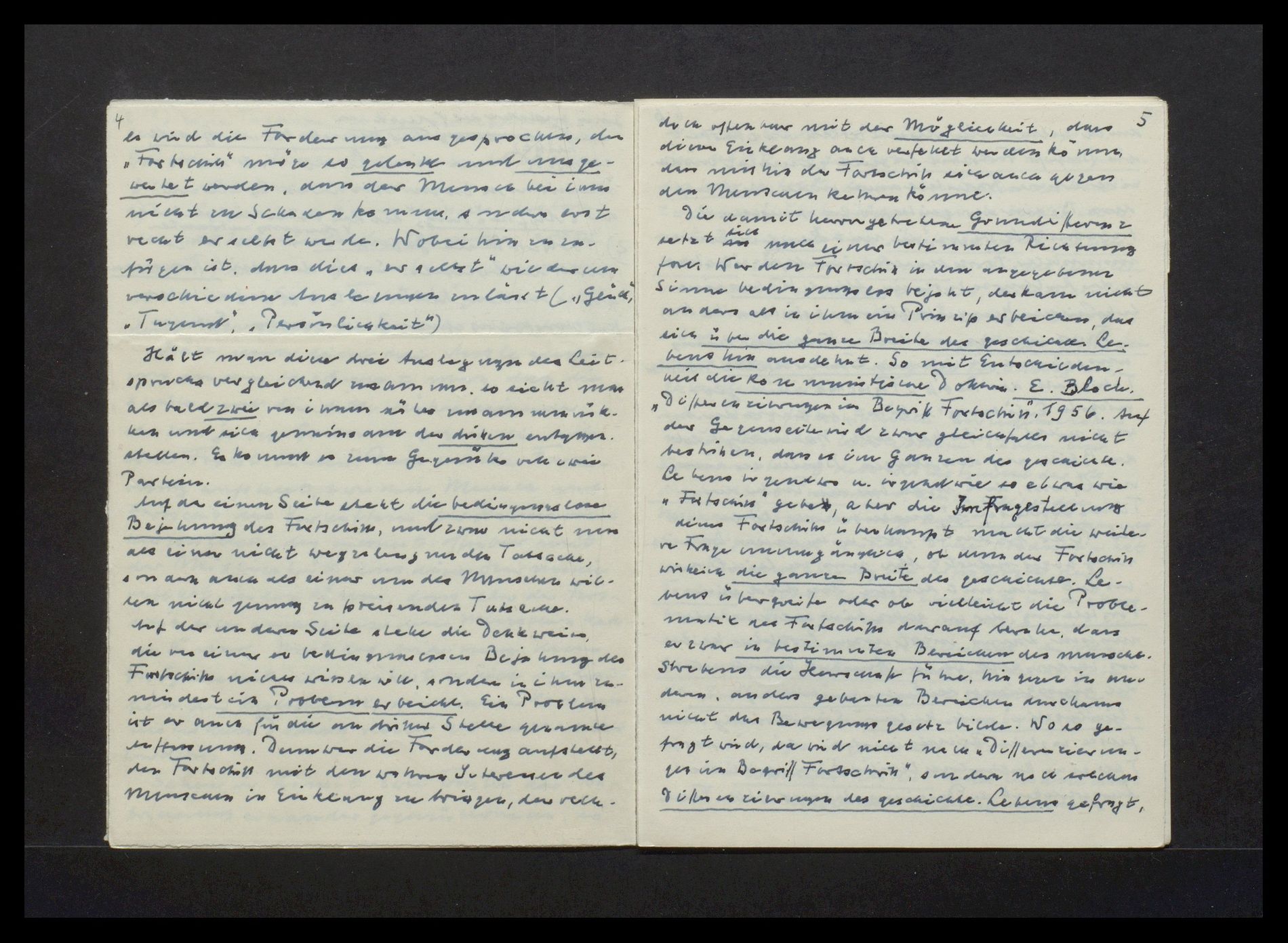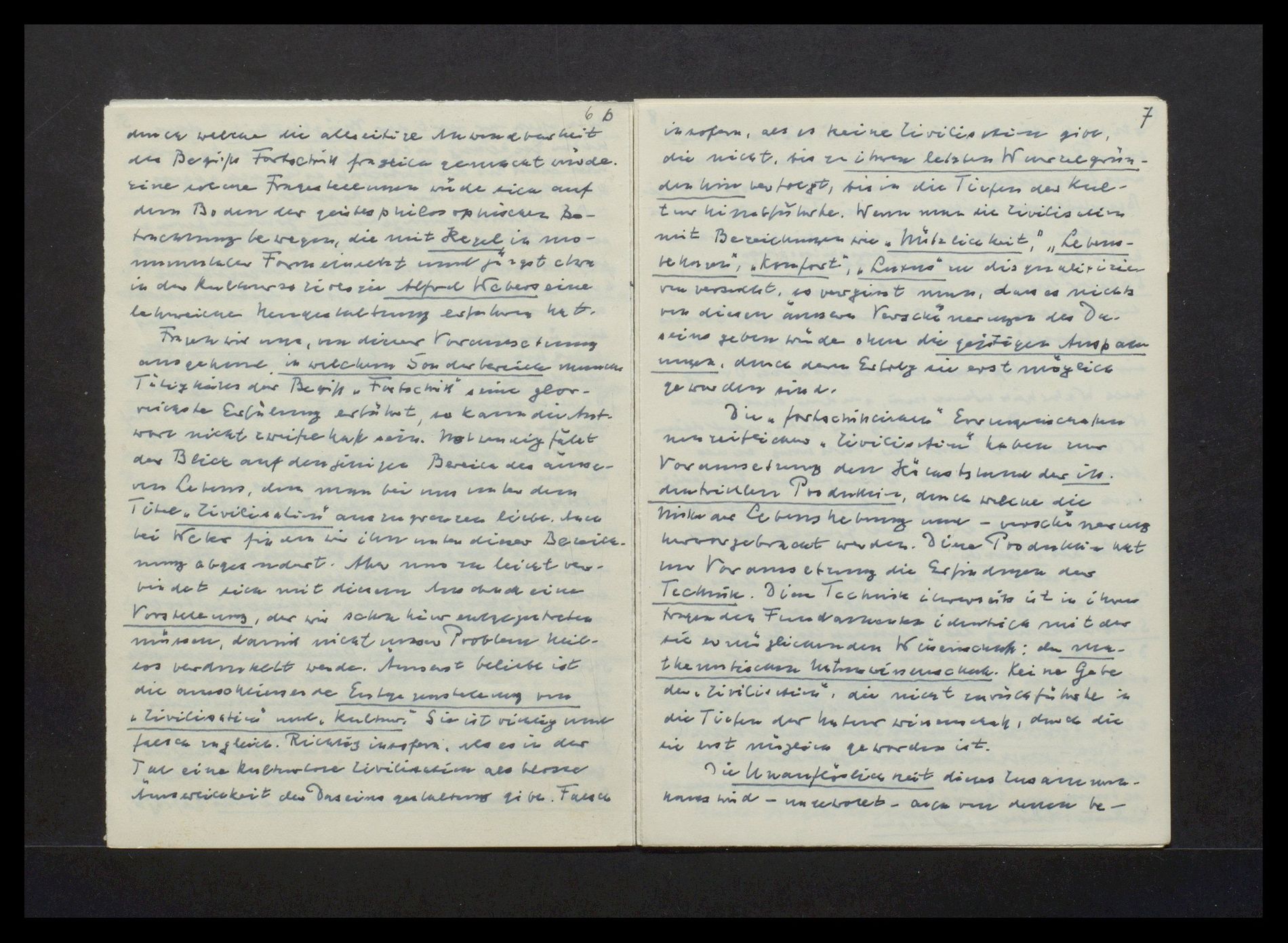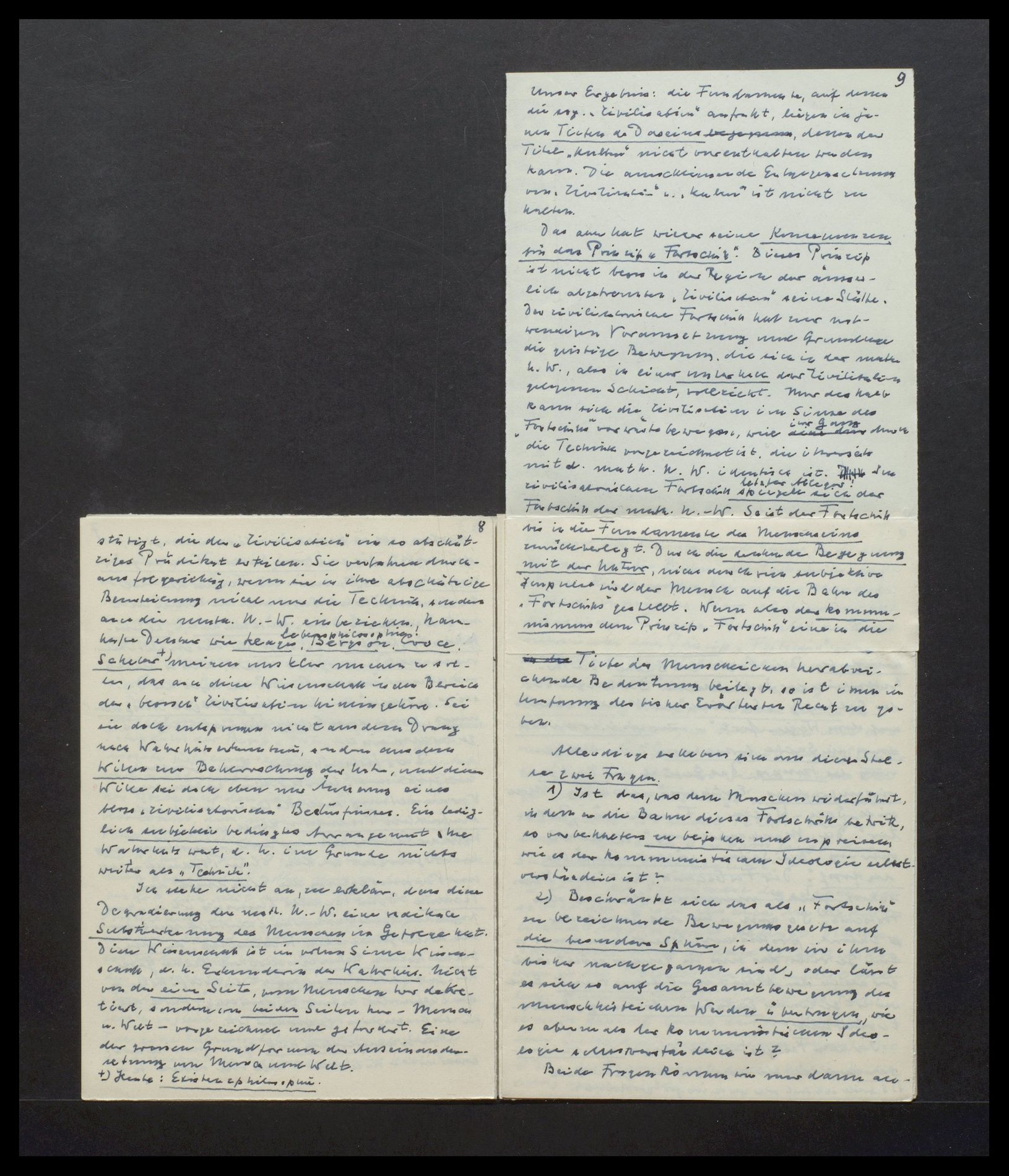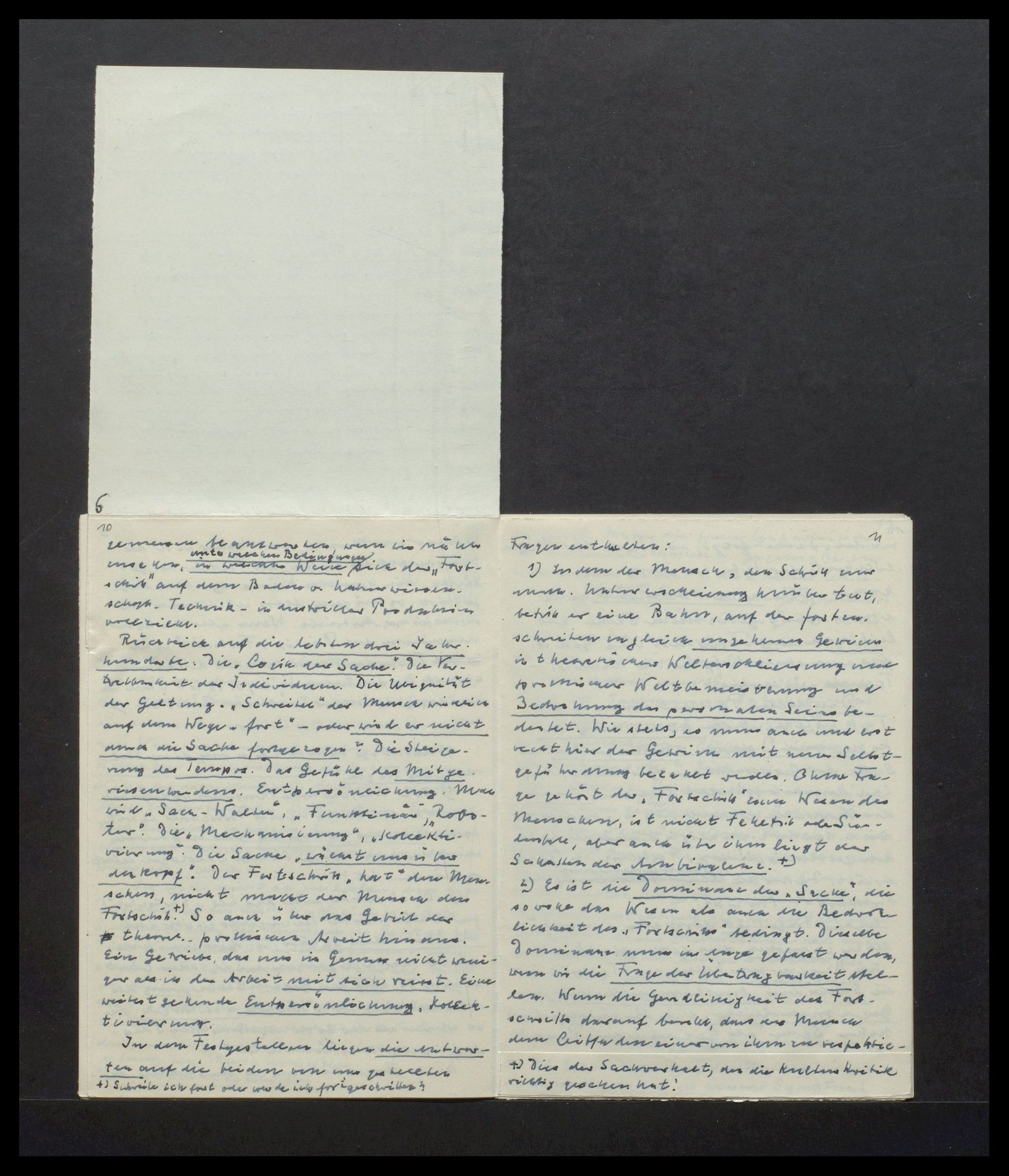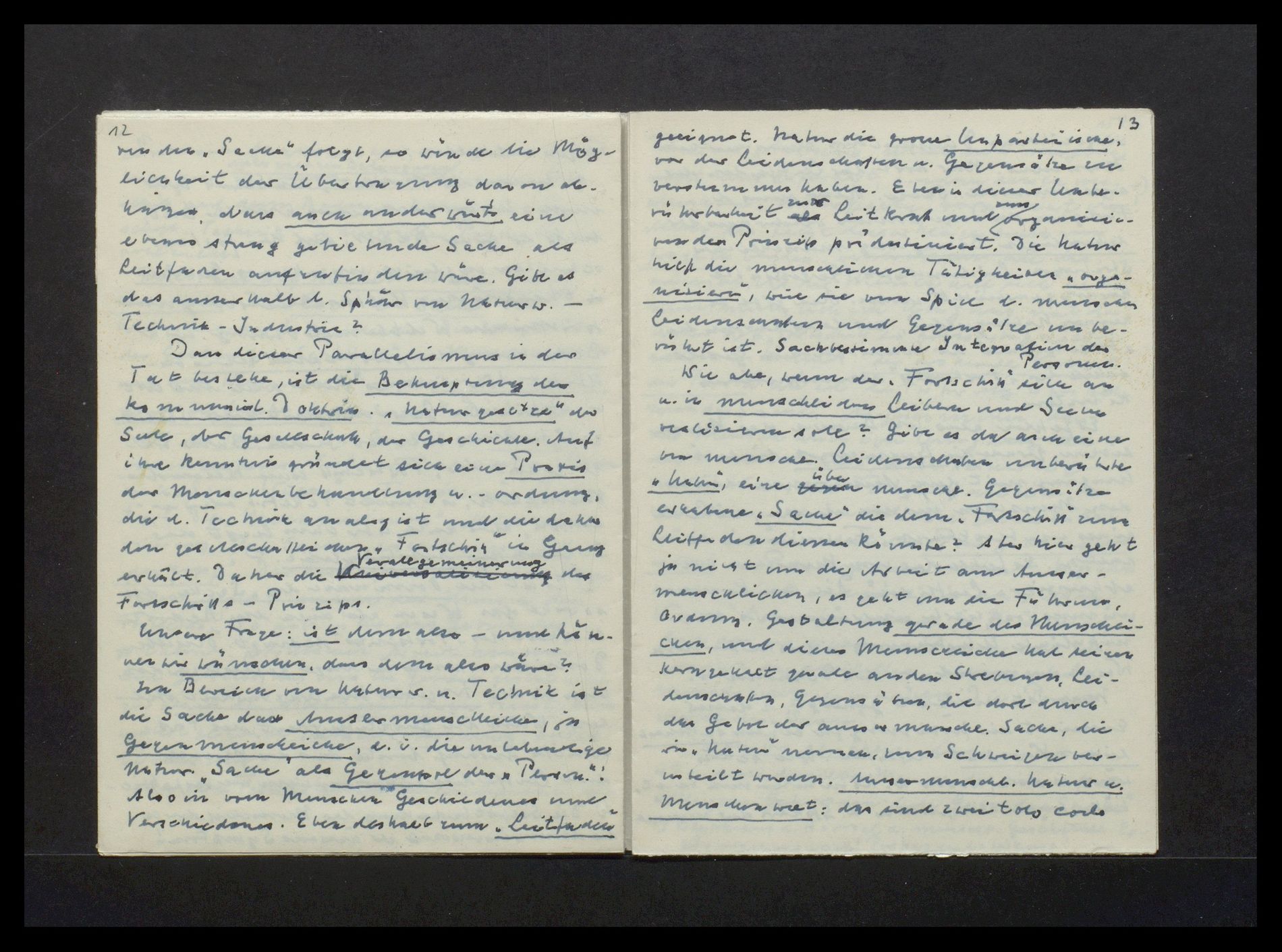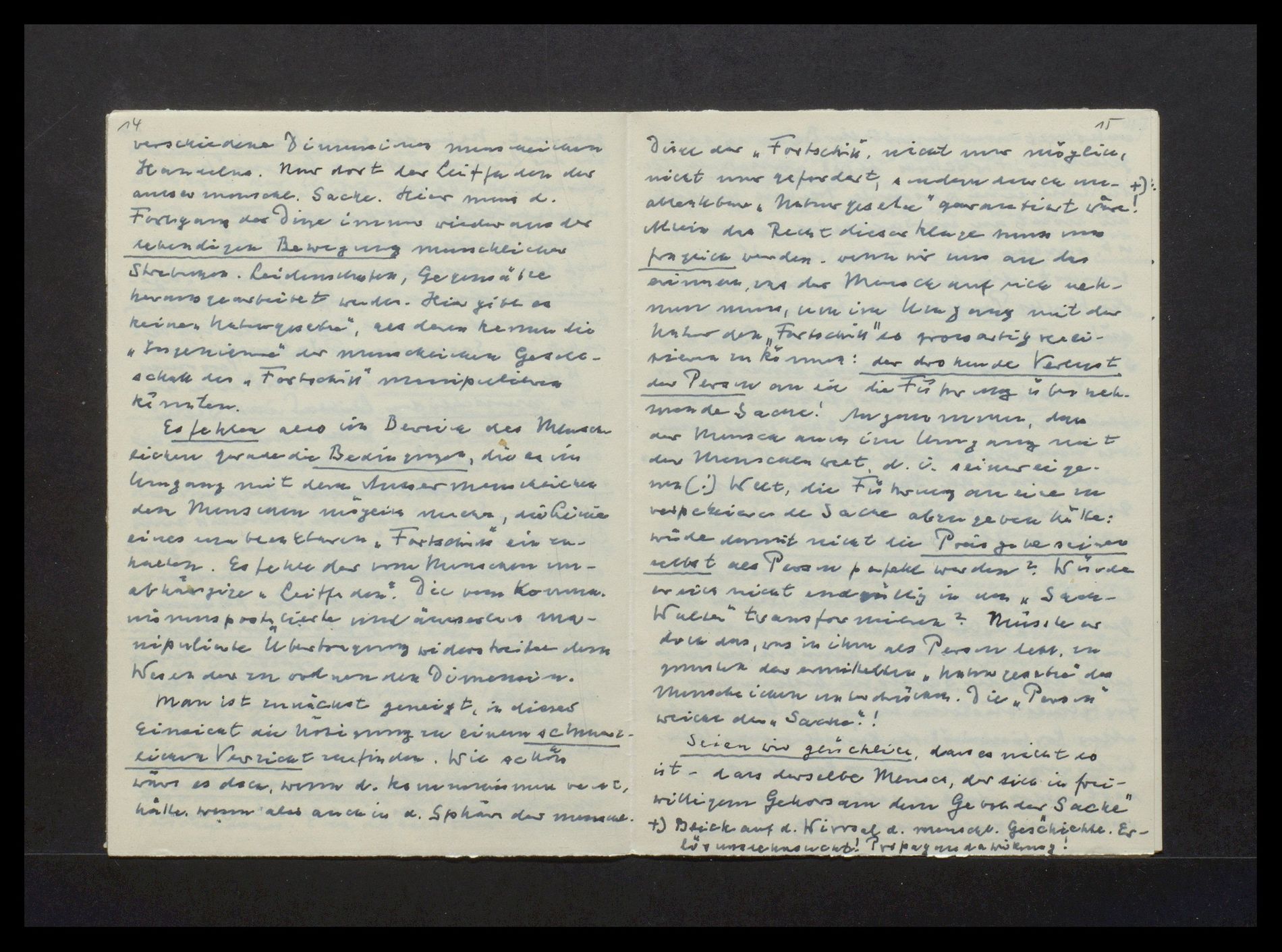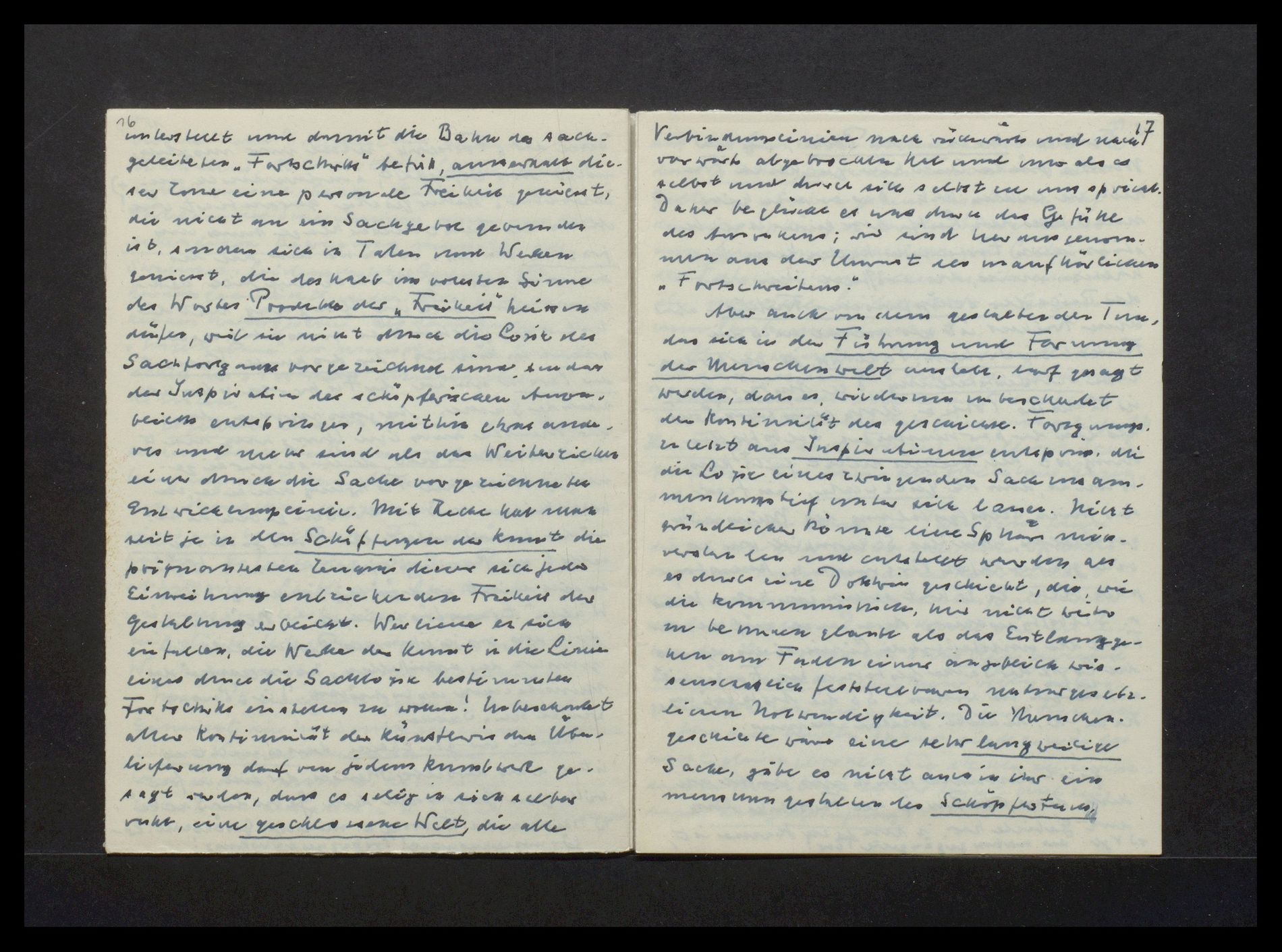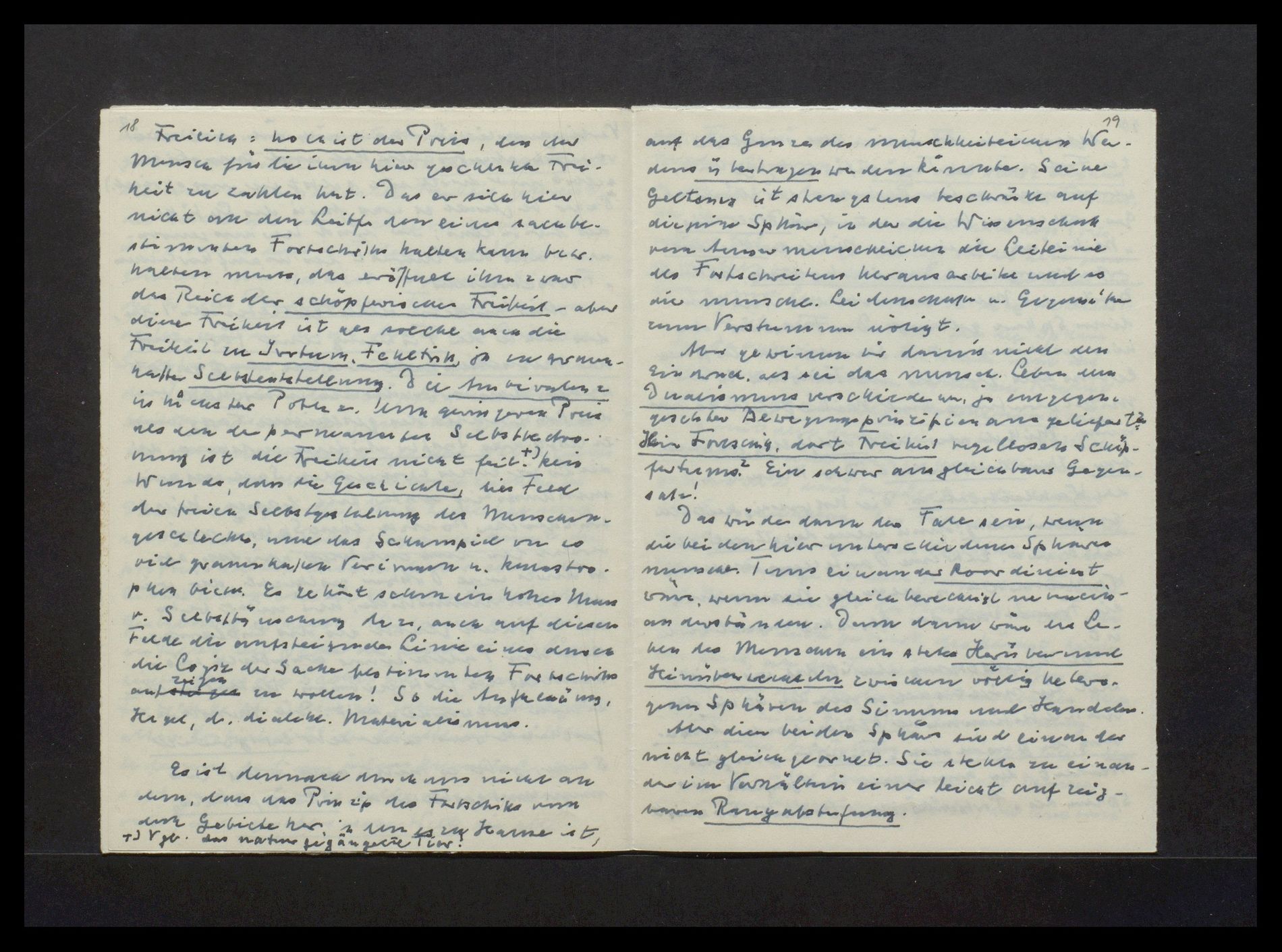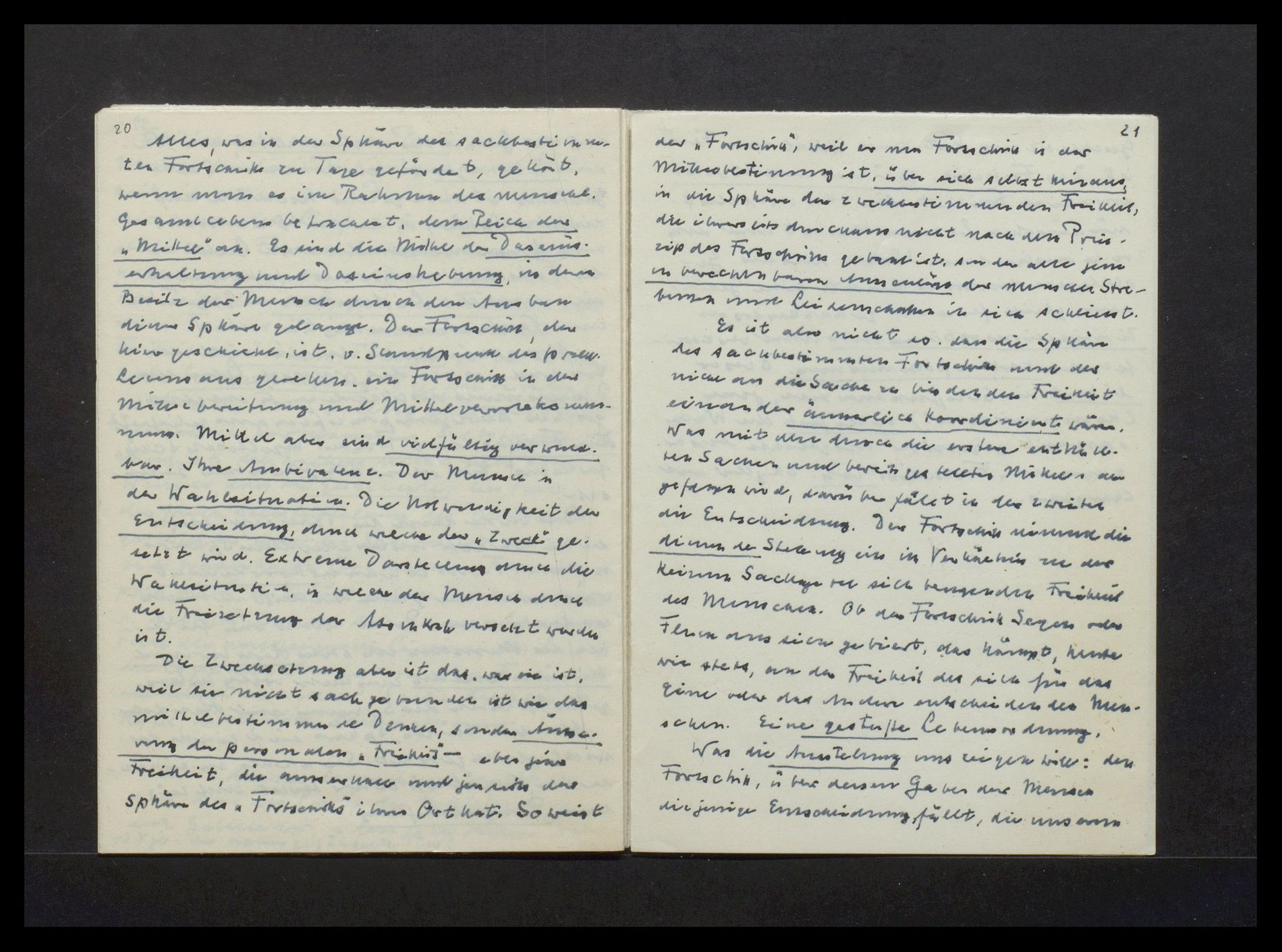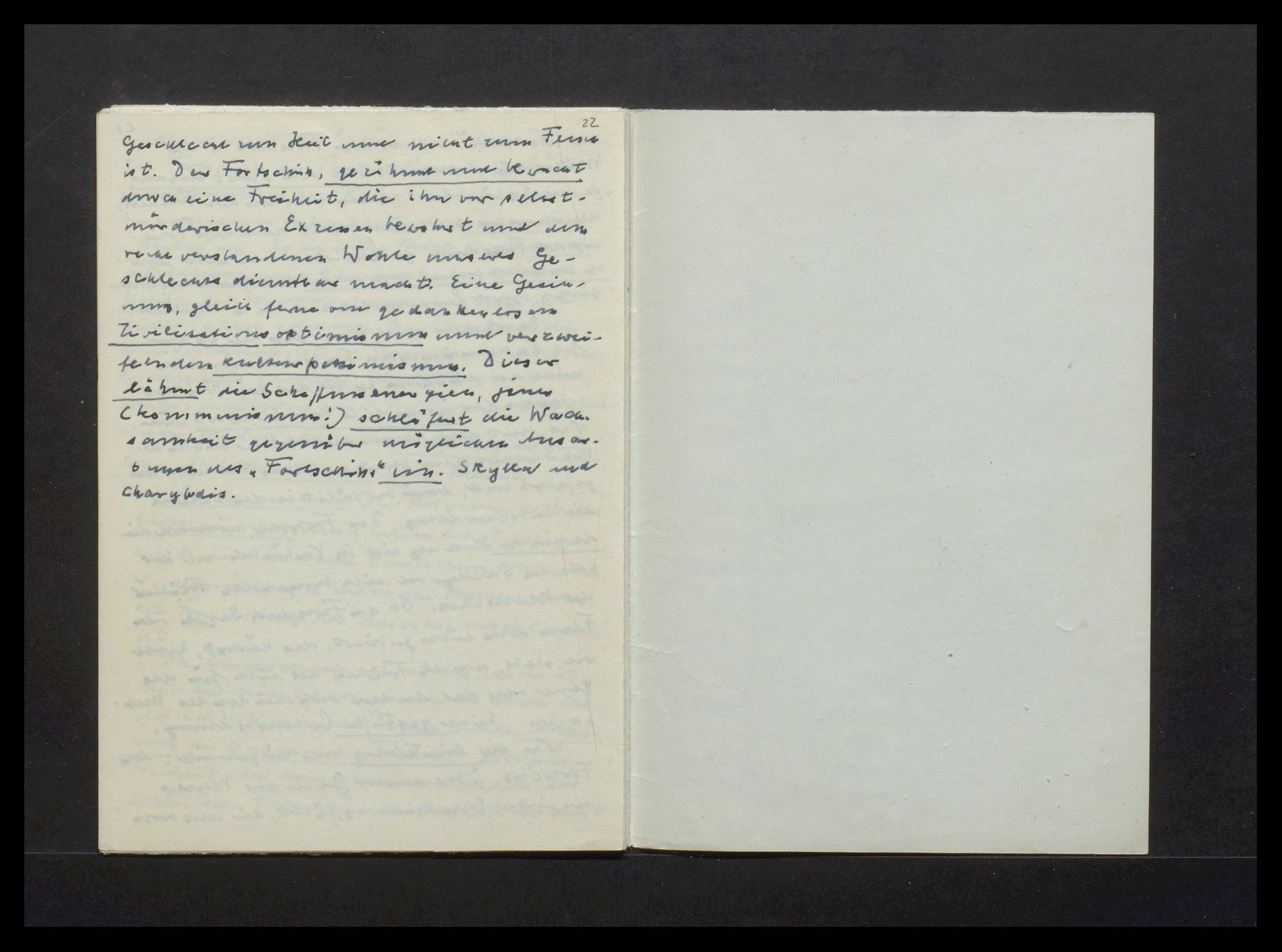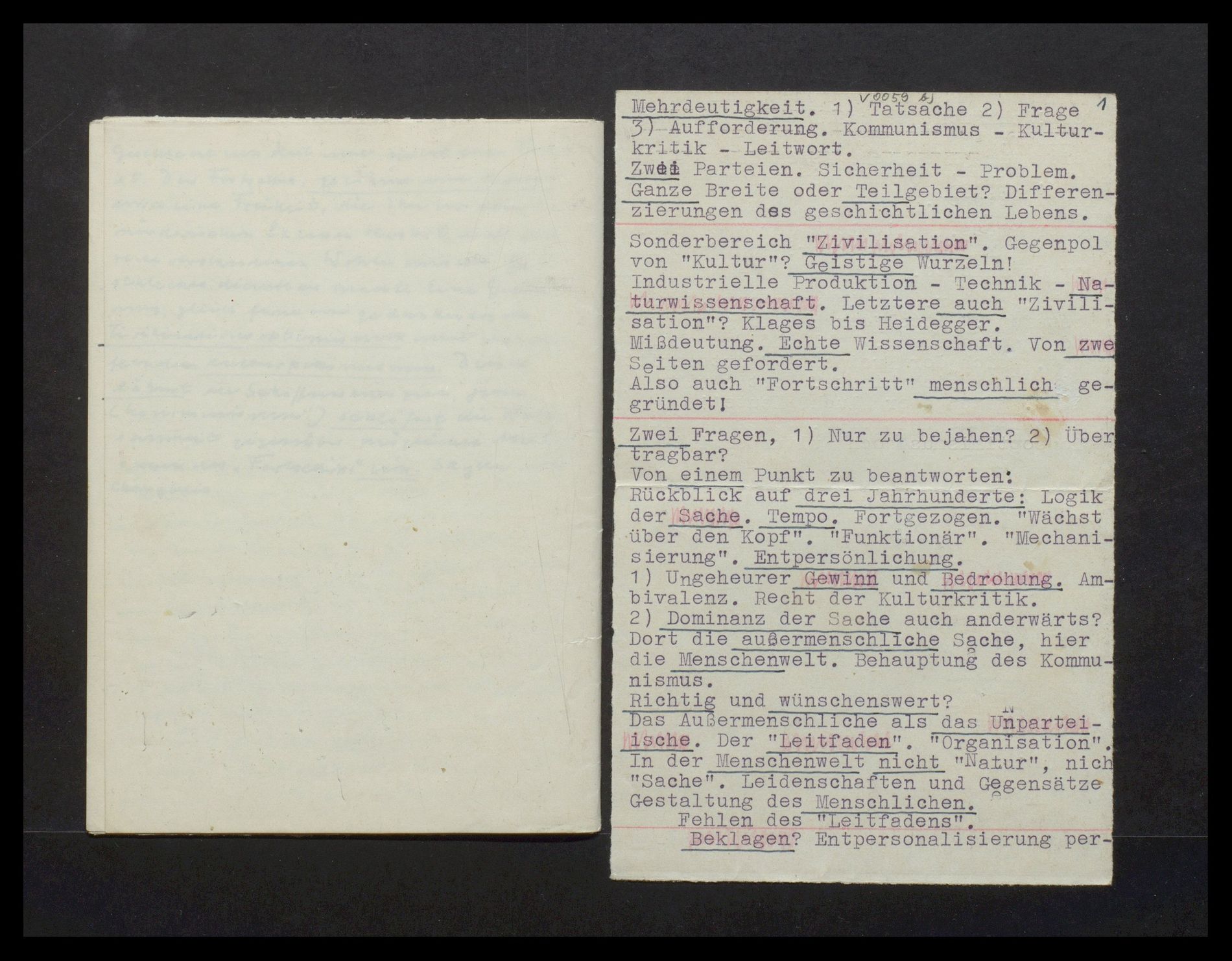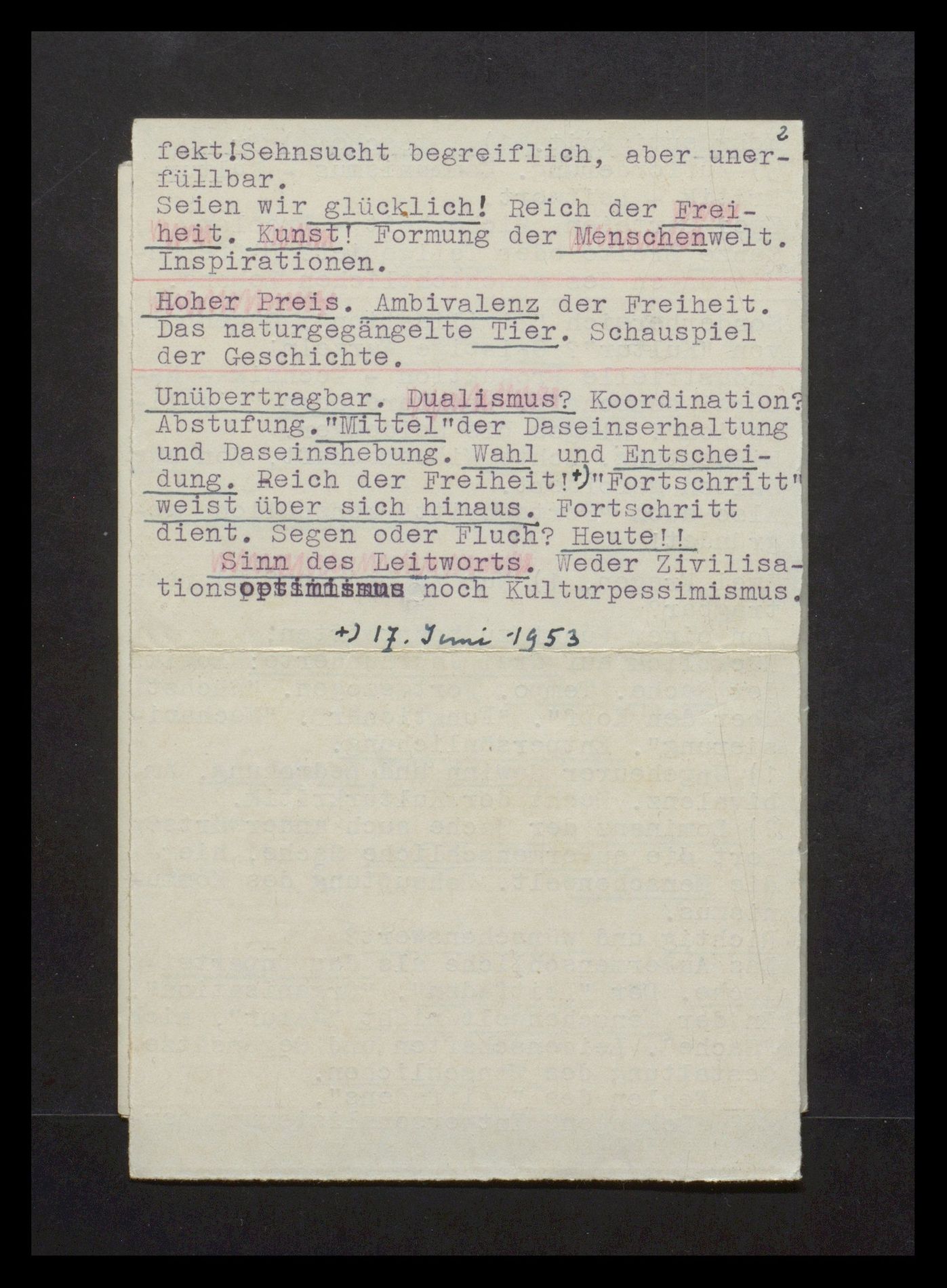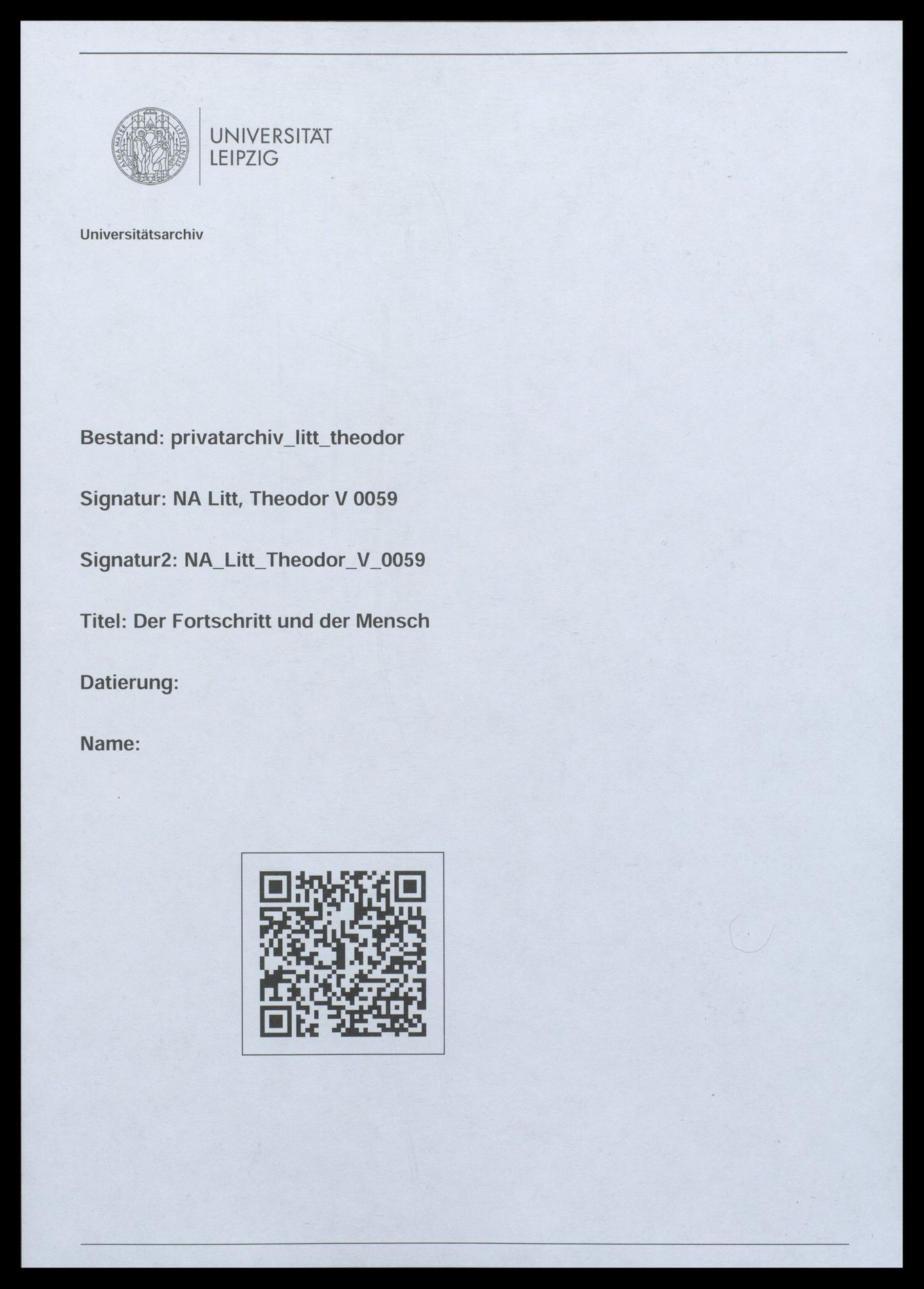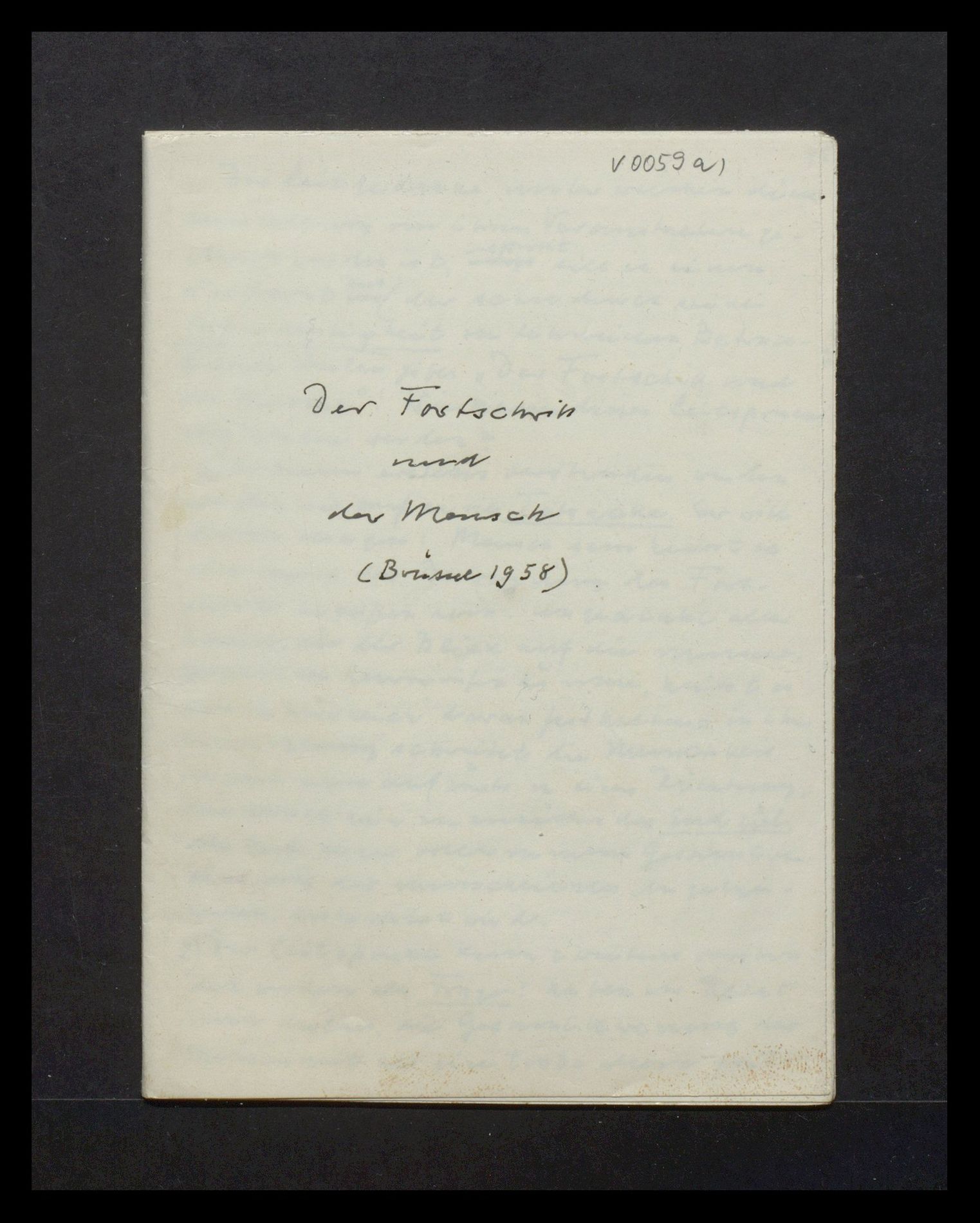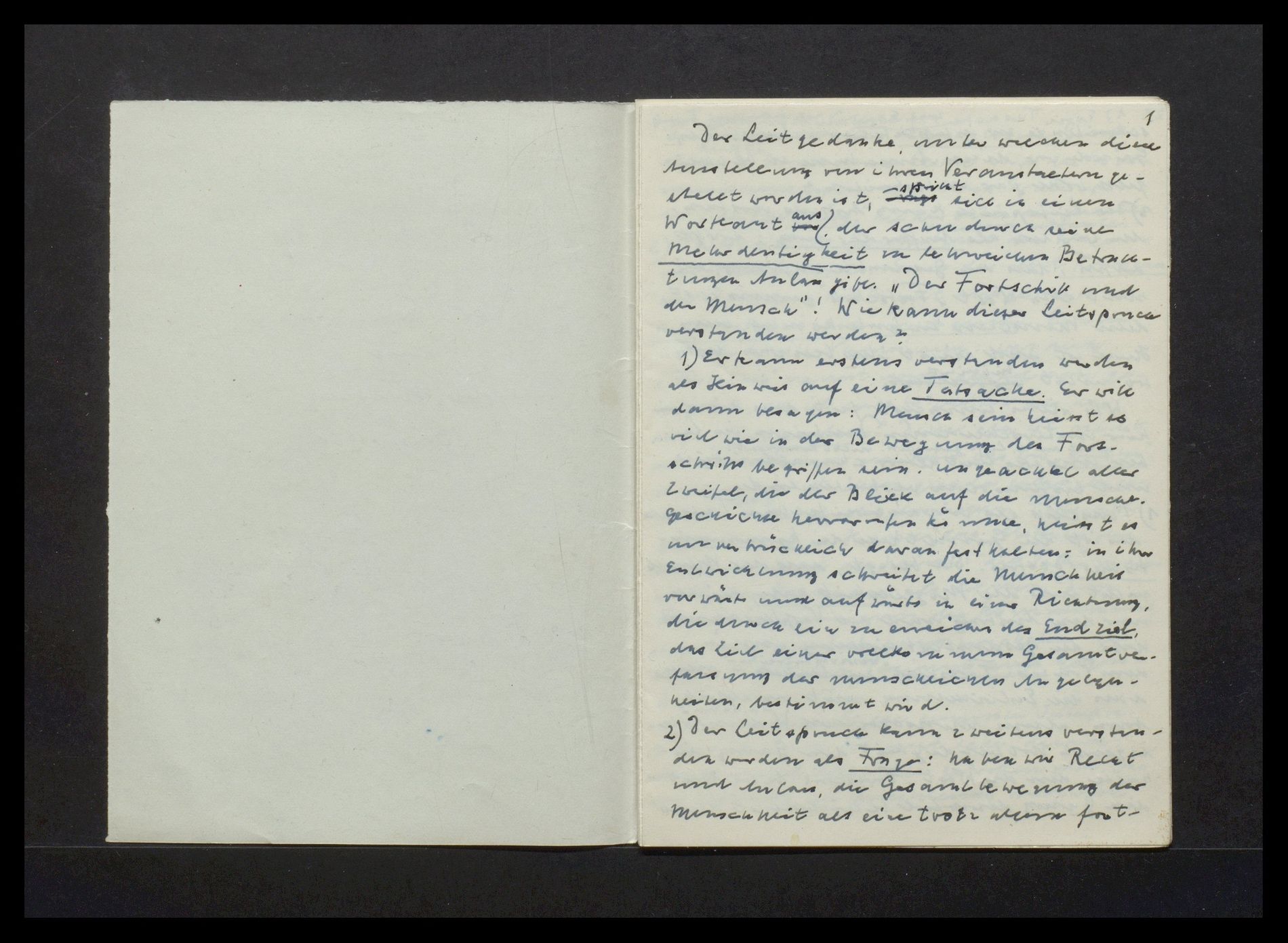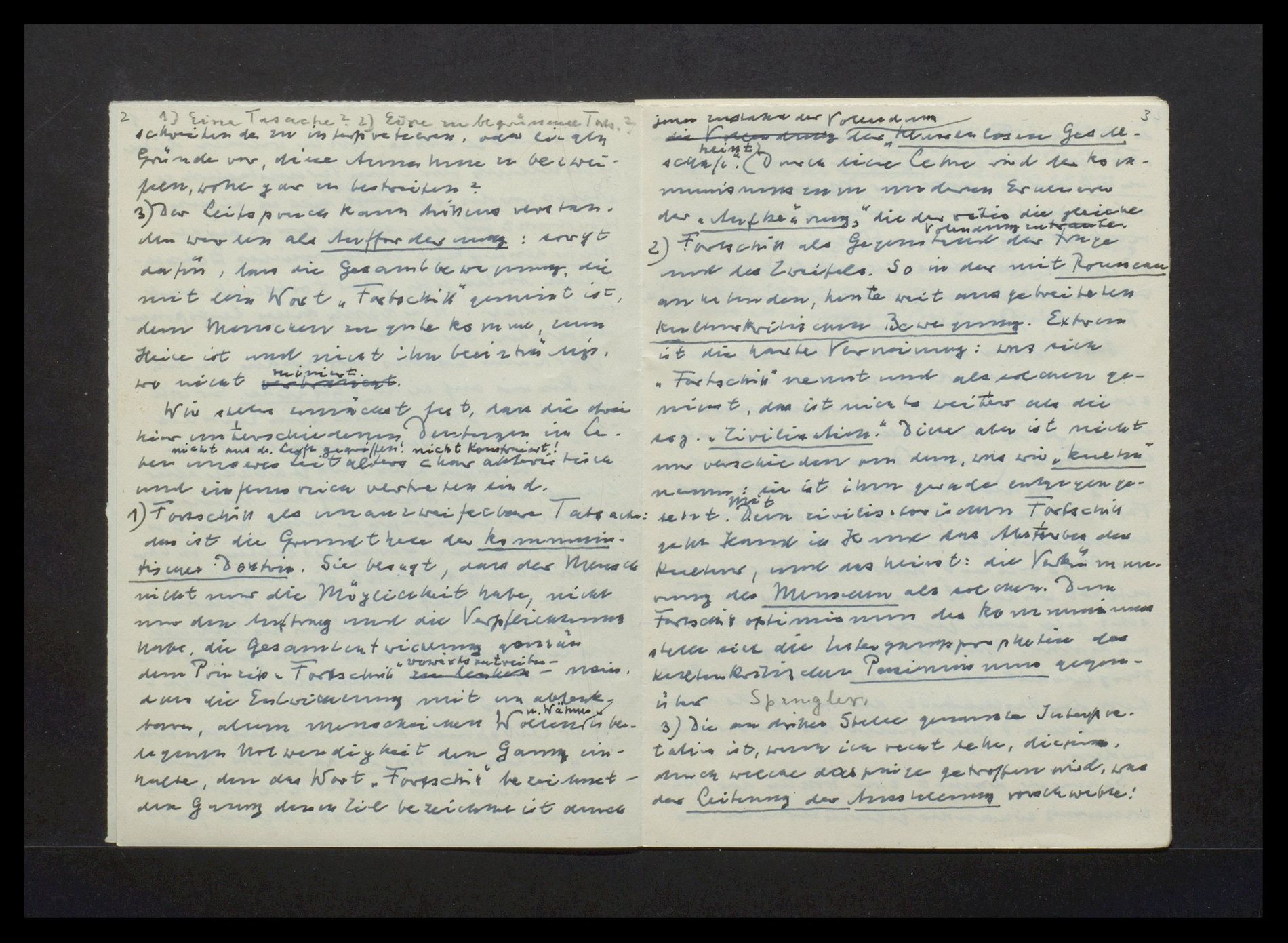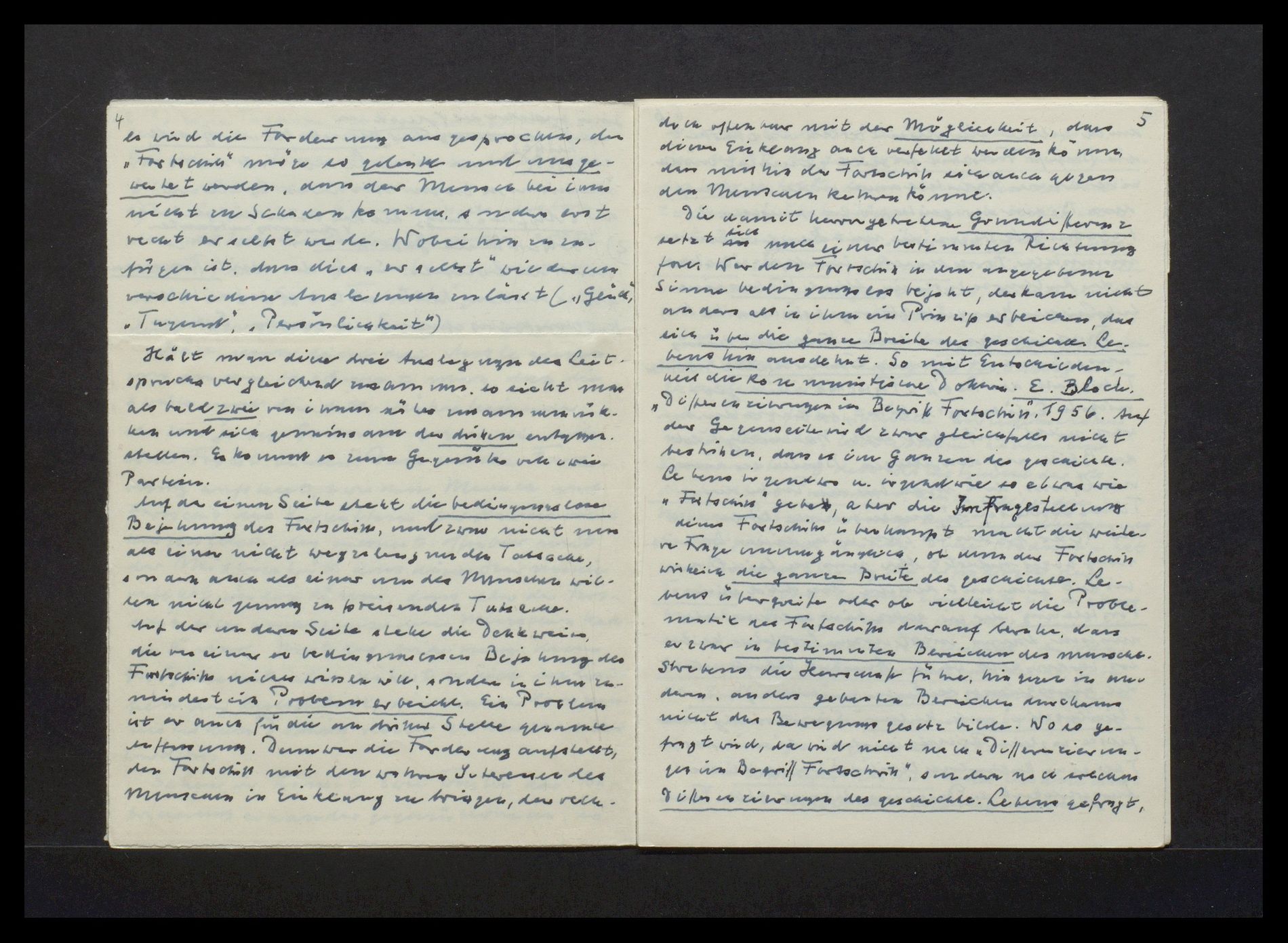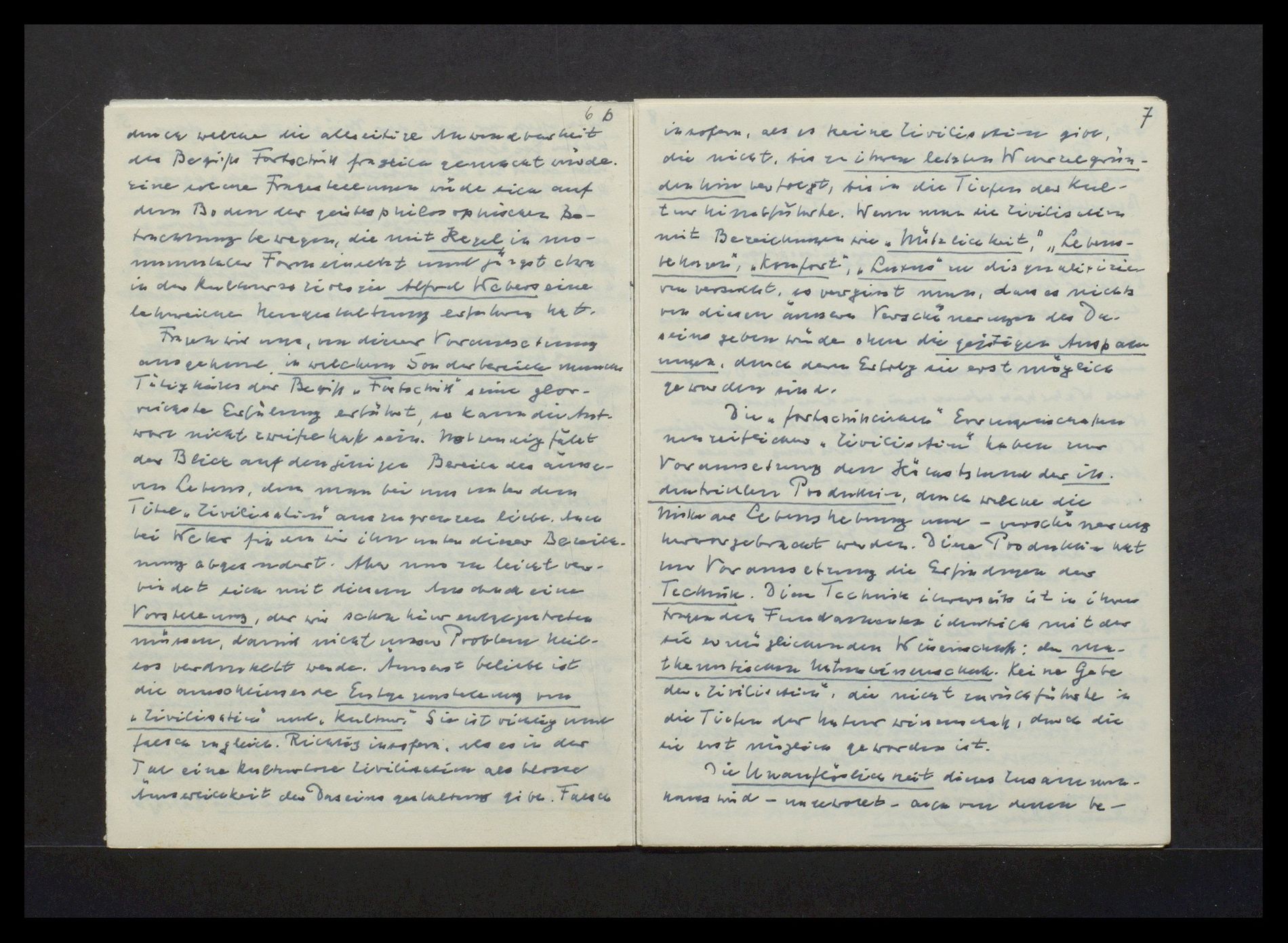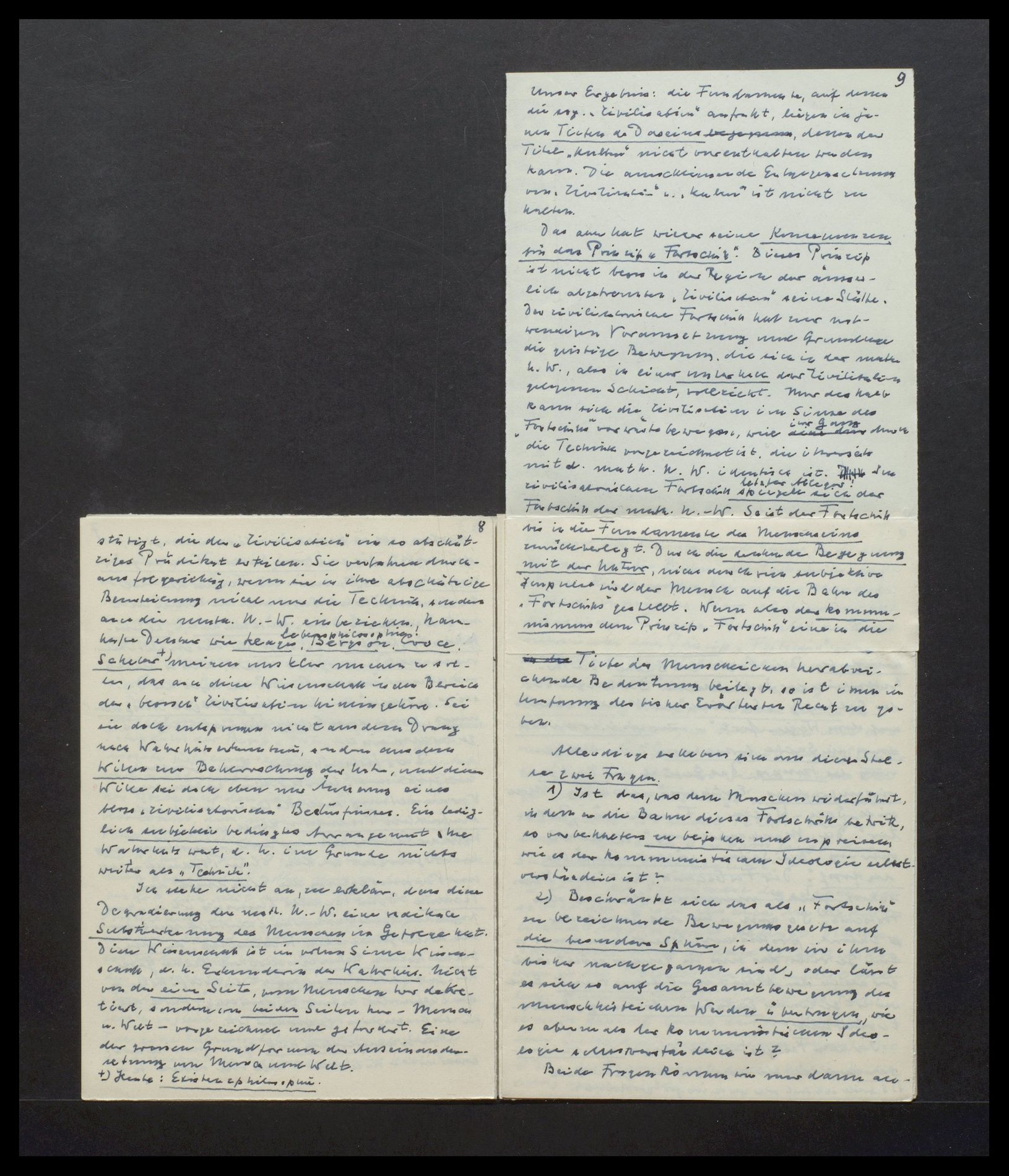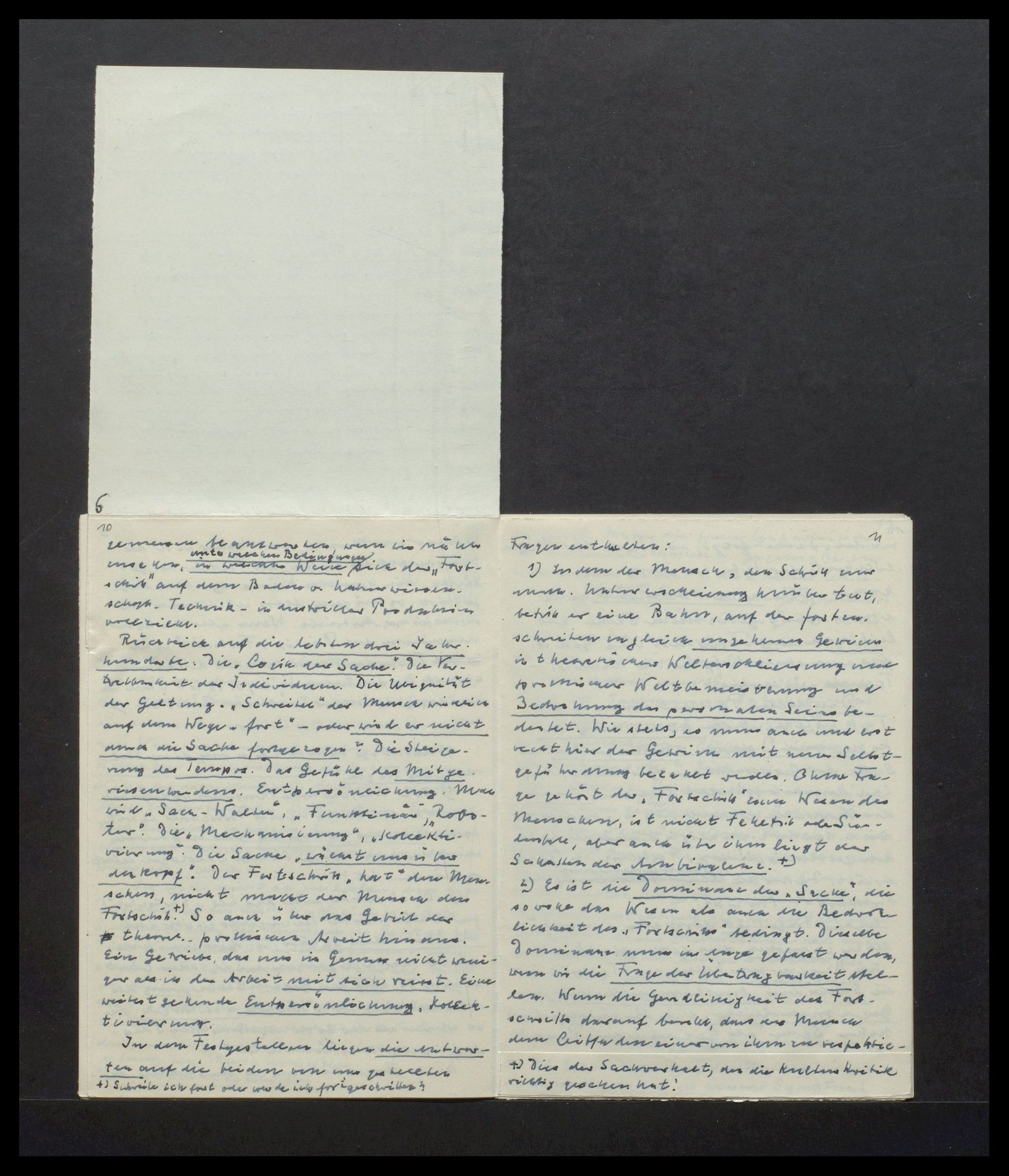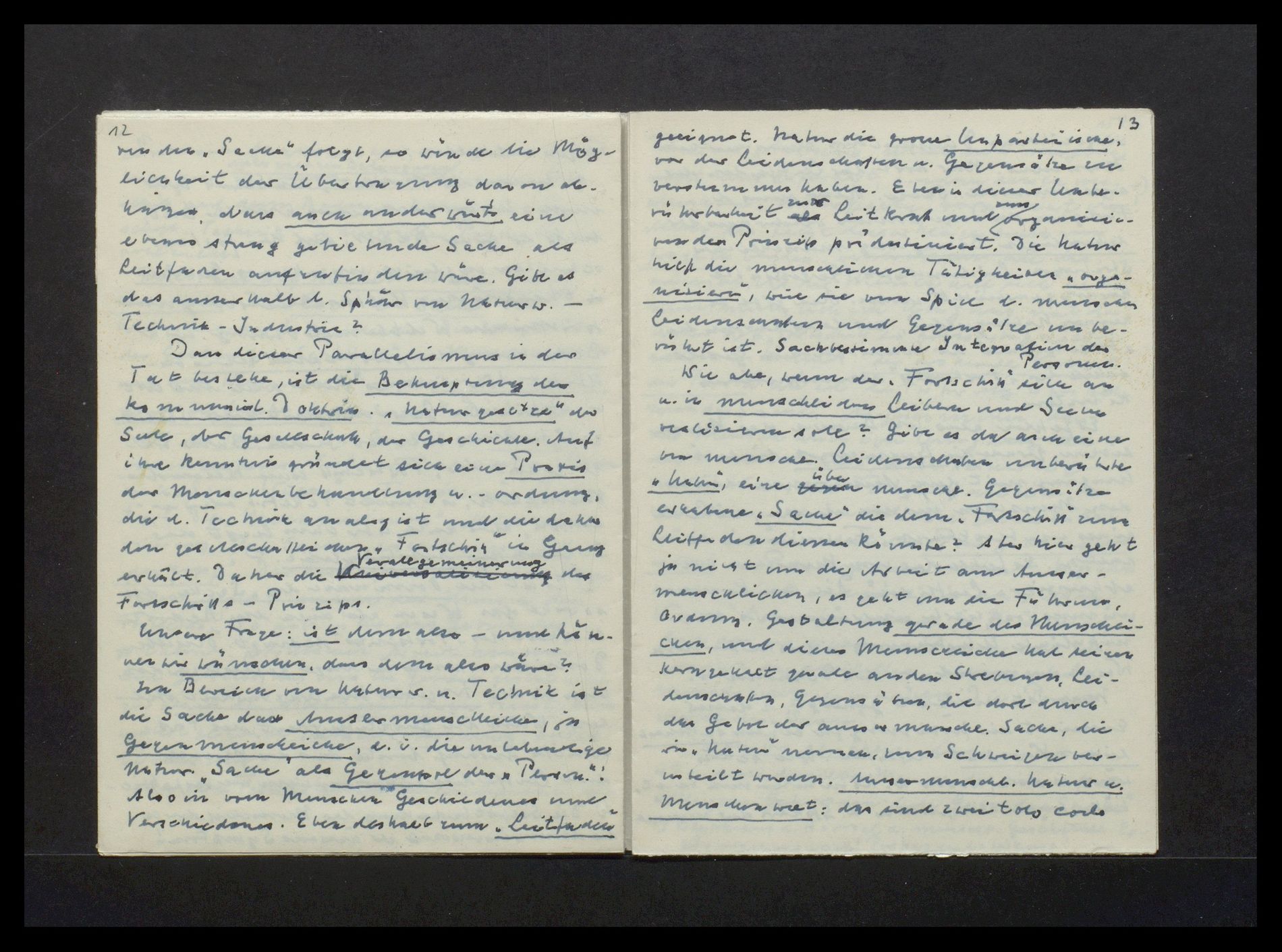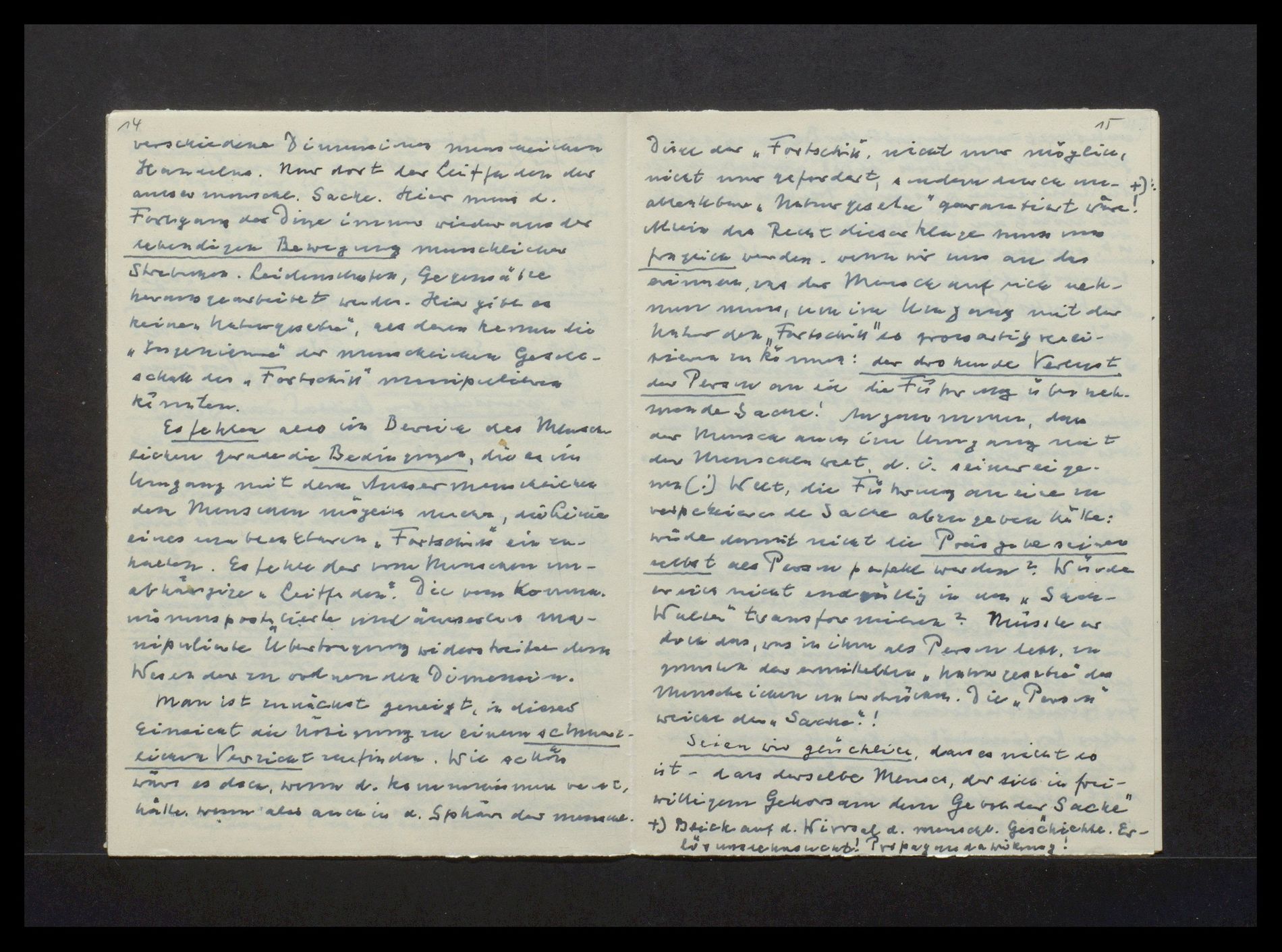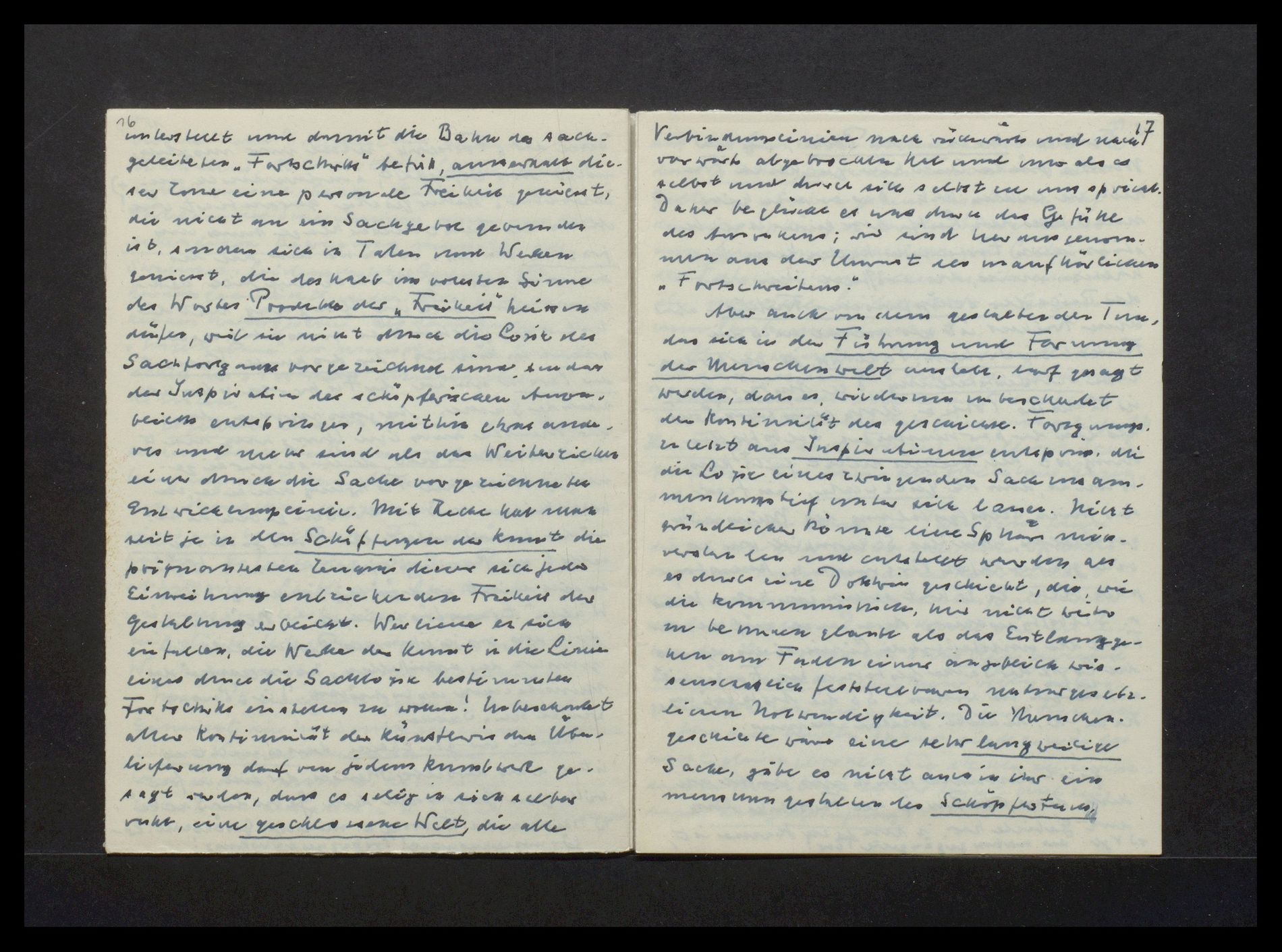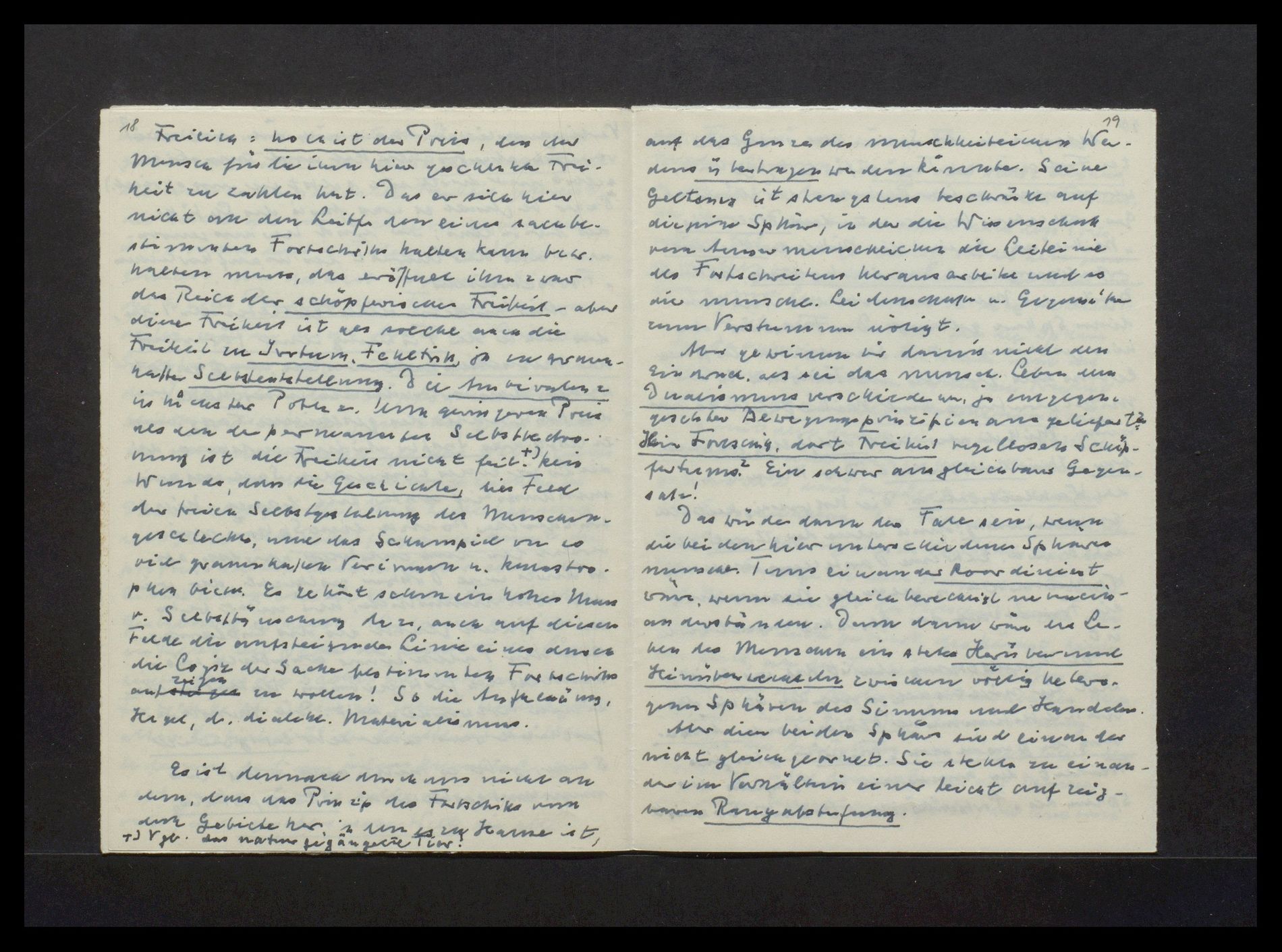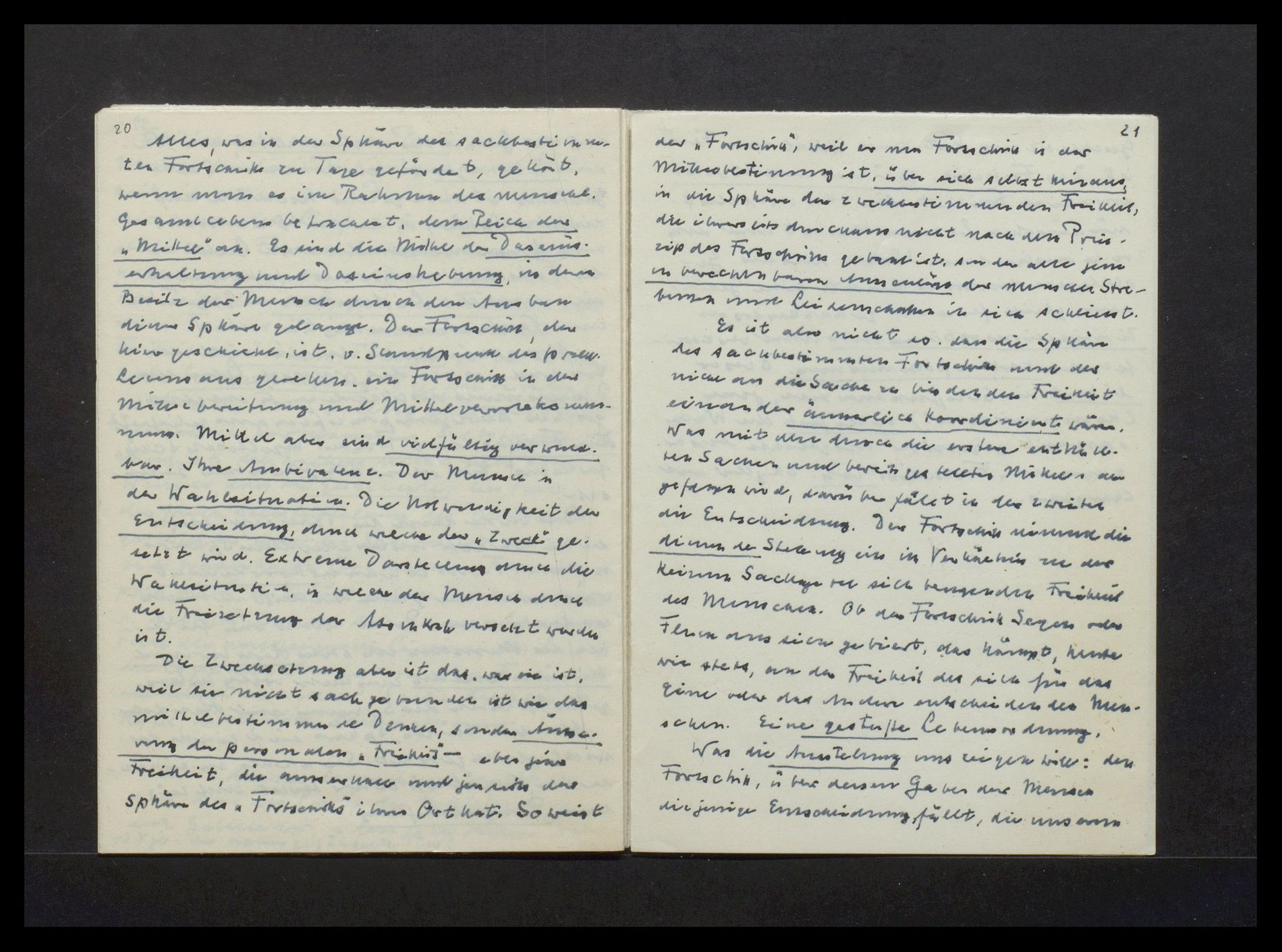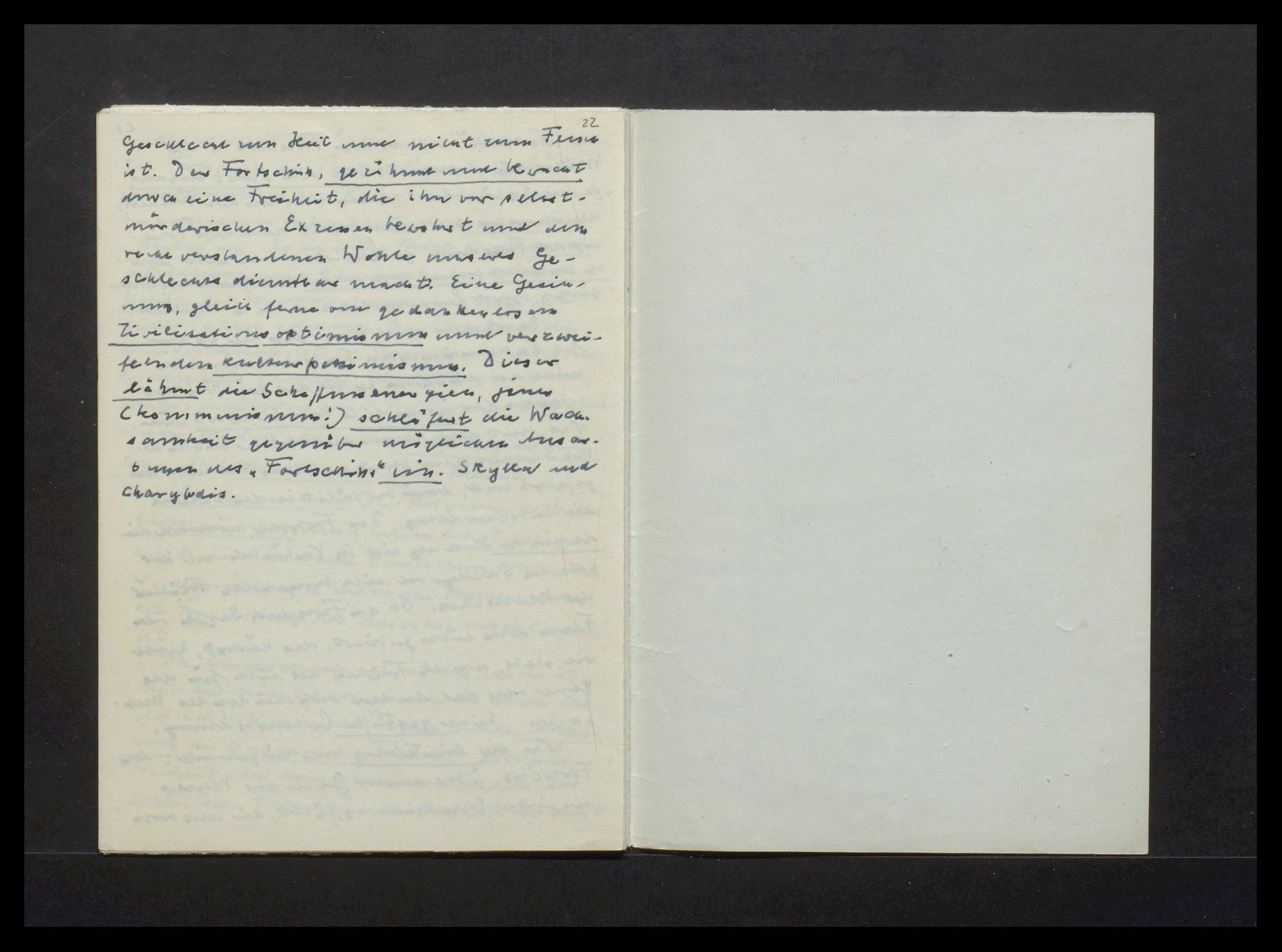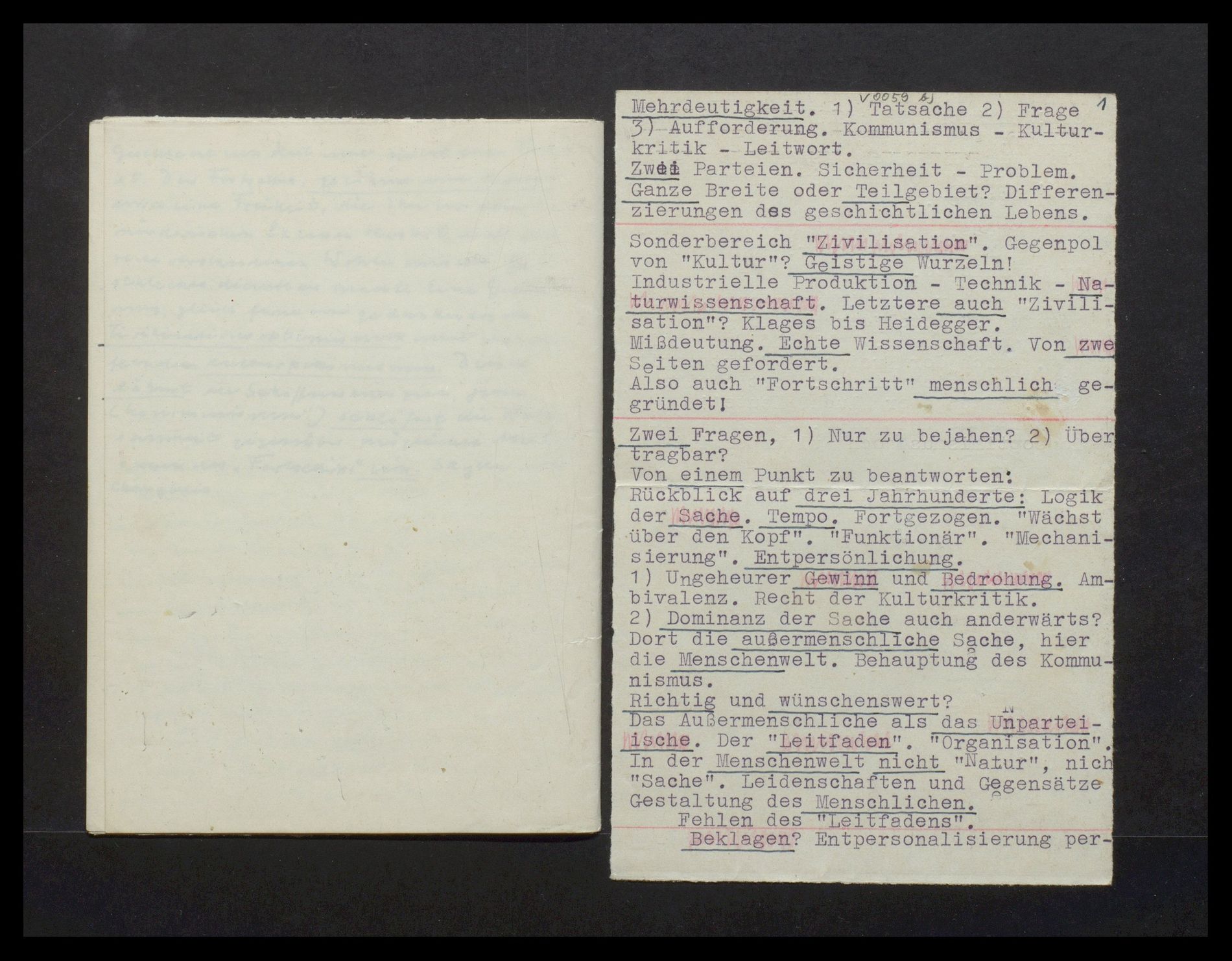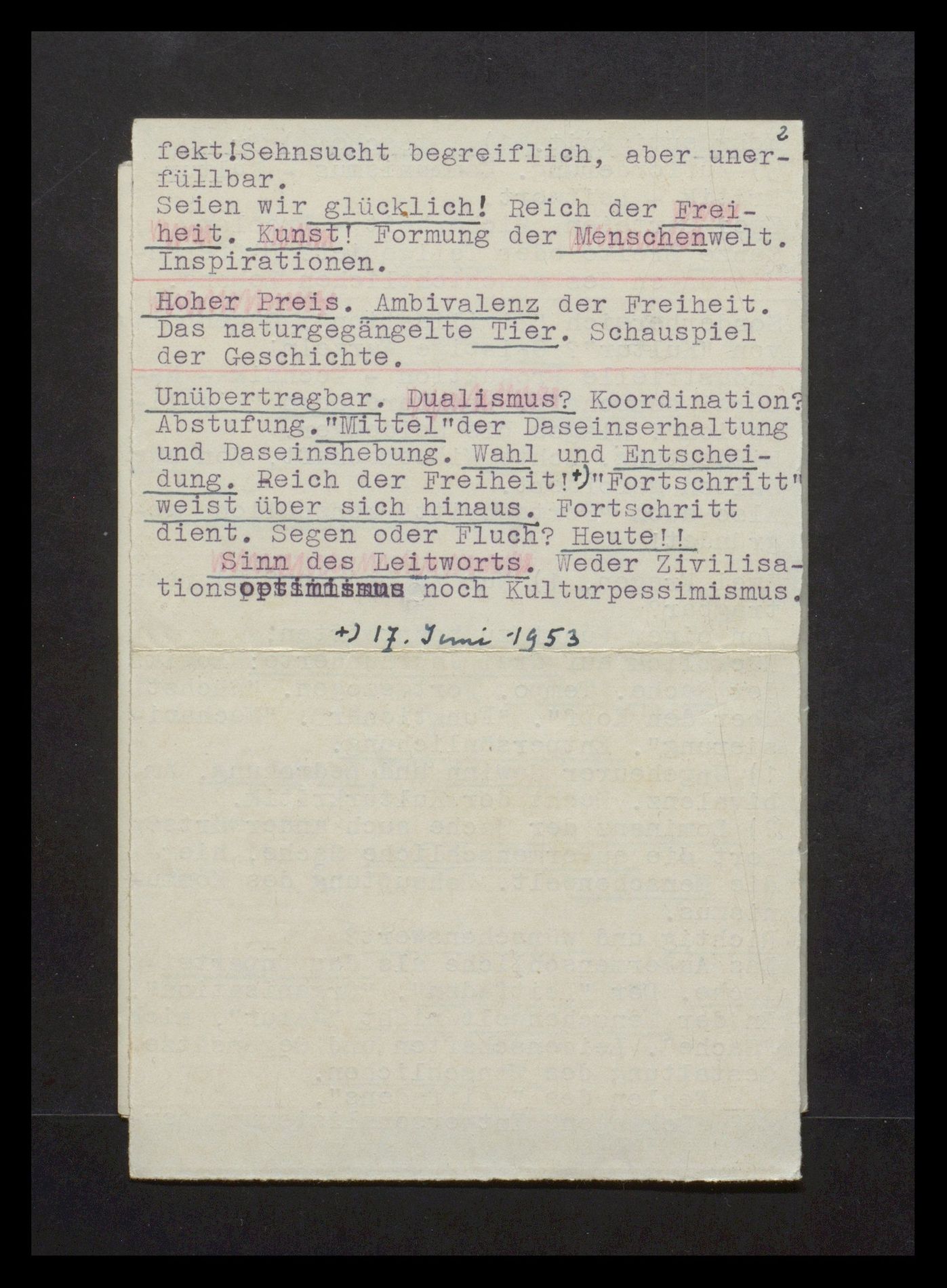| Bemerkungen | zu V 0059c - laut alter Findkartei lag Zeitungsausschnitt ursprünglich zwischen "Unsere Verantwortung für die Freiheit des Einzelnen" (1960) und "Der Fortschritt und der Mensch" (1958) und wurde letzterem Vortrag zugeordnet.; Dokumentenabschrift: V 0059a
(1958)
Titelblatt
Der Fortschritt und der Mensch
(Brüssel 1958)
1
Der Leitgedanke, unter welchen diese
Ausstellung von ihren Veranstaltern ge-
spricht
stellt worden ist, regt sich in einen
aus
Wortlaut vor, der schon durch seine
Mehrdeutigkeit zu lehrreichen Betrach-
tungen Anlass gibt. „Der Fortschritt und
der Mensch“! Wie kann dieser Leitspruch
verstanden werden?
1) Er kann erstens verstanden werden
als Hinweis auf eine Tatsache. Er will
dann besagen: Mensch sein heisst so
viel wie in der Bewegung des Fort-
schritts begriffen sein, ungeachtet aller
Zweifel, die der Blick auf die menschl.
Geschichte hervorrufen könnte, heisst es
unverbrüchlich daran festhalten: in ihrer
Entwicklung schreitet die Menschheit
vorwärts und aufwärts in einer Richtung,
die durch ein zu erreichendes Endziel,
das Ziel einer vollkommenen Gesamtver-
fassung der menschlichen Angelegen-
heiten, bestimmt wird.
2) Der Leitspruch kann zweitens verstan-
den werden als Frage: haben wir Recht
und Anlass, die Gesamtbewegung der
Menschheit als eine trotz allem fort-
2
1) Eine Tatsache? 2) Eine zu begründende Tats.?
schreitende zu interpretieren, oder liegen
Gründe vor, diese Annahme zu bezwei-
feln, wohl gar zu bestreiten?
3) Der Leitspruch kann drittens verstan-
den werden als Aufforderung: sorgt
dafür, dass die Gesamtbewegung, die
mit dem Wort „Fortschritt“ gemeint ist,
dem Menschen zu gute kommt, zum
Heile ist und nicht ihn beeinträchtigt,
ruiniert
wo nicht verbraucht.
Wir stellen zunächst fest, dass die drei
hier unterschiedenen Deutungen im Le-
nicht aus d. Luft gegriffen! nicht konstruiert!
ben unseres Zeitalters charakteristisch
und einflussreich vertreten sind.
1) Fortschritt als unanzweifelbare Tatsache
das ist die Grundthese der kommunis-
tischen Doktrin. Sie besagt, dass der Mensch
nicht nur die Möglichkeit habe, nicht
nur den Auftrag und die Verpflichtung
habe, die Gesamtentwicklung gemäss
vorwärts zu treiben
dem Prinzip „Fortschritt“ zu lenken - ,
dass die Entwicklung mit unablenk-
baren, allem menschlichen Wollen u. Wärme über-
legenen Notwendigkeit den Gang ein-
halte, den das Wort „Fortschritt“ bezeichnet –
den Gang dessen Ziel bezeichnet ist durch
3
jener Zustand der Vollendung
die Vollendung der „klassenlosen Gesell-
heisst
schaft. Durch seine Lehre wird der Kom-
minsimus zum modernen Erneuerer
der „Aufklärung“, die der ratio die gleiche
Vollendung zutraute.
2) Fortschritt als Gegensatz der Frage
und des Zweifels. So in der mit Rousseau
anhebenden, heute weit ausgebreiteten
kulturkritischen Bewegung. Extrem
ist die harte Verneinung: was sich
„Fortschritt“ nennt und als solchen , das ist nichts weiter als die
sog. „Zivilisation“. Diese aber ist nicht
nur verschieden von dem, was wir „Kultur“
nennen: sie ist ihm gerade entgegenge-
setzt. Mit dem zivilisatorischen Fortschritt
geht Hand in Hand das Absterben der
Kultur, und das heisst: die Verkümme-
rung des Menschen als solchen. Dem
Fortschrittsoptimismus des Kommunismus
stellt sich die Untergangsprophetin des
kulturkritischen Pessimismus gegen-
über Spengler
3) Die an dritter Stelle genannte Interpre-
tation ist, wenn ich recht sehe, diejenige,
durch welche dasjenige getroffen wird, was
der Leitung der Ausstellung vorschwebte:
4
es wird die Forderung ausgesprochen, der
„Fortschritt“ möge si gelenkt und ausge-
wertet werden, dass der Mensch bei ihm
nicht zu Schaden kommt, sondern erst
recht er selbst werde. Wobei hinzuzu-
fügen ist, dass dies „er selbst“ wiederum
verschiedene Auslegungen zulässt („Glück“,
„Tugend“, Persönlichkeit“)
Hält man diese drei Auslegungen des Leit-
spruchs vergleichend zusammen, so sieht man
als bald zwei von ihnen näher zusammenrük-
ken und sich gemeinsam der dritten entgegen-
stellen. Es kommt so zum Gegenüber von zwei
Parteien.
Auf der einen Seite steht die bedingungslose
Bejahung des Fortschritts, und zwar nicht nur
als einer nicht Tatsache.
Auf der anderen Seite steht die Denkweise,
die von einer so bedingungslosen Bejahung des
Fortschritts nichts wissen will, sondern in ihm zu-
mindest ein Problem erblickt. Ein Problem
ist er auch für die an dritter Stelle genannte
auffassung. Denn wer die Forderung aufstellt,
den Fortschritt mit den wahren Interessen des
Menschen in Einklang zu bringen, der rech-
5
doch offenbar mit der Möglichkeit, dass
dieser Einklang auch verfehlt werden könne,
dass mithin der Fortschritt sich auch gegen
den Menschen kehren könne.
Die damit hervorgetretene Grunddifferenz
setzt sich nach einer bestimmten Richtung
fort. Wer den Fortschritt in dem angegebenen
Sinne bedingungslos bejaht, der kann nicht
anders als in ihm ein Prinzip erblicken, das
sich über die ganze Breite des geschichtl. Le-
bens hin ausdehnt. So mit Entschieden-
heit die kommunistische Doktrin. E. Bloch
„Differenzierung im Begriff Fortschritt“, 1956. Auf
der Gegenseite wird zwar gleichfalls nicht
bestritten, dass es im Ganzen des geschichtl.
Lebens irgendwo u. irgendwie so etwas wie
„Fortschritt“ gebe, aber die Infragestellung
dieses Fortschritts überhaupt macht die weite-
re Frage unumgänglich, ob denn der Fortschritt
wirklich die ganze Breite des geschichtl. Le-
bens übergreife oder ob vielleicht die Proble-
matik des Fortschritts darauf beruhe, dass
er zwar in bestimmten Bereichen des menschl.
Strebens die Herrschaft führe, hingegen in an-
deren, anders gebauten Bereichen durchaus
nicht das Bewegungsgesetz bilde. Wo so ge-
fragt wird, da wird nicht nach „Differenzierun-
gen im Begriff Fortschritt“, sondern nach solchen
Differenzierungen des geschichtl. Lebens gefragt,
6
durch welche die allseitige Anwendbarkeit
des Begriffs Fortschritt fraglich gemacht würde.
Eine solche Fragestellung würde sich auf
dem Boden der geistesphilosophischen Be-
trachtung bewegen, die mit Hegel in mo-
numentaler Form einsetzt und jüngst etwa
in der Kultursoziologie Alfred Webers eine
lehrreiche Neugestaltung erfahren hat.
Fragen wir uns, von dieser Voraussetzung
ausgehend, in welchem Sonderbereiche manche
Tätigkeiten der Begriff „Fortschritt“ seine glor-
reichste Erfüllung erfährt, so kann die Ant-
wort nicht zweifelhaft sein. Notwendig fällt
der Blick auf denjenigen Bereich des äusse-
ren Lebens, dem man bei uns unter dem
Titel „Zivilisation“ auszugrenzen liebt. Auch
bei Weber finden wir ihn unter dieser Bezeich-
nung angesondert. Aber nur zu leicht ver-
bindet sich mit diesem Ausdruck eine
Vorstellung, der wirschon hier entgegentreten
müssen, damit nicht unser Problem heil
los verdunkelt werde. Äusserst beliebt ist
die ausschliessende Entgegenstellung von
„Zivilisation“ und „Kultur“. Sie ist richtig und
falsch zugleich. Richtig insofern, als es in der
Tat eine kulturlose Zivilisation als blosse
Äusserlichkeit der Daseinsgestaltung gibt. Falsch
7
insofern, als es keine Zivilisation gibt,
die nicht, bis zu ihren letzten Wurzelgrün-
den hin verfolgt, bis in die Tiefen der Kul-
tur hinabführte. Wenn man die Zivilisation
mit Bezeichnungen wie „Nützlichkeit“, „Lebens-
behagen“, „Komfort“, „Luxus“ zu disqualifizieren
versucht, so vergisst man, dass es nichts
von diesen äusseren Verschönerungen des Da-
seins geben würde ohne die geistigen Anspan-
nungen, durch deren Erfolg sie erst möglich
geworden sind.
Die „fortschrittlichen“ Errungenschaften
neuzeitlicher „Zivilisation“ haben zur
Voraussetzung den Höchststand der in-
dustriellen Produktion, durch welche die
Mittel der Lebenshebung und –verschönerung
hervorgebracht werden. Diese Produktion hat
zur Voraussetzung die Erfindungen der
Technik. Diese Technik ihrerseits ist in ihren
tragenden Fundamenten identisch mit der
sie ermöglichenden Wissenschaft: der ma-
thematischen Naturwissenschaft. Keine Gabe
der „Zivilisation“, die nicht zurückführte in
die Tiefen der Naturwissenschaft, durch die
sie erst möglich geworden ist.
Die Unauflösslichkeit dieses Zusammen-
hangs wird – ungewollt – auch von denen be-
8
stätigt, die der „Zivilisation“ ein so abschät-
ziges Prädikat erteilen. Sie verfahren durch-
aus folgerichtig, wenn sie in ihre abschätzige
Beurteilung nicht nur die Technik, sondern
auch die math. N.-W. einbeziehen. Nam-
Lebensphilosophie!
hafte Denker wie Klages, Bergson, Croce,
Scheler +) meinen uns klar machen zu sol-
len, das auch diese Wissenschaft in den Bereich
der „blossen“ Zivilisation hineingehöre. Sei
sie doch entsprungen nicht aus dem Drang
nach Wahrheitserkenntnis, sondern aus dem
Willen zur Beherrschung der Natur, und dieser
Wille sei doch eben nur ÄUsserung eines
bloss „zivilisatorischen“ Bedürfnisses. Ein ledig-
lich subjektiv bedingtes Arragement ohne
Wahrheitswert, d. h. im Grunde nichts
weiter als „Technik“.
Ich stehe nicht an, zuerklären, dass diese
Degradierung den math. N.-W. eine radikale
Selbsterkennung des Menschen im Gefolge hat.
Diese Wissenschaft ist im vollen Sinne Wissen-
schaft, d.h. Erkunderin der Wahrheit. Nicht
von der einen Seite, vom Menschen her dekre-
tiert, sondern von beiden Seiten her – Mensch
u. Welt – vorgezeichnet und gefordert. Eine
der grossen Grundformen der Auseinander-
setzungen von Mensch und Welt.
+) Heute: Existenzphilosophie.
9
Unser Ergebnis: die Fundamente, auf denen
die sog. „Zivilisation“ , liegen in je-
nen Tiefen des Daseins begegnen, denen der
Titel „Kultur“ nicht vorenthalten werden
kann. Die ausschliessende Entgegensetzung
von „Zivilisation“ u. „Kultur“ ist nicht zu
halten.
Das alles hat wieder seine Konsequenzen
für das Prinzip „Fortschritt“. Dieses Prinzip
ist nicht bloss in der Region der äusser-
lich abgetrennten „Zivilisation“ seine Stätte.
Der zivilisatorische Fortschritt hat zur not-
wendigen Voraussetzung und Grundlage
die geistige Bewegung, die sich in der math.
N.W., also in einer unterhalb der Zivilisation
gelegenen Schicht, vollzieht. Nur deshalb
kann sich die Zivilisation im Sinne des
ihr Gang
„Fortschritts“ vorwärtsbewegen, weil diese dur durch
die Technik vorgezeichnet ist, die ihrerseits
mit d. math. N.-W. identisch ist. xxx Im
letzter Ableger!
zivilisatorischen Fortschritt spiegelt sich der
Fortschritt der math. N.-W. So ist der Fortschritt
bis in die Fundamente des Menschseins
zurückverlegt. Durch die denkende Begegnung
mit der Natur, nicht durch rein subjektive
Impulse wird der Mensch auf die Bahn des
„Fortschritts“ gestellt. Wenn also der Kommu-
nsmus dem Prinzip „Fortschritt“ eine in die
in die Tiefe des Menschlichen herabrei-
chende Bedeutung beilegt, so ist ihnen im
Umfang des bisher Erörterten Recht zu ge-
ben.
Allerdings erheben sich an dieser Stel-
le zwei Fragen.
1) Ist das, was dem Menschen widerfährt,
in dem er die Bahn diseses Fortschritts betritt,
so vorbehaltlos zu bejahen und zu preisen,
wie es der kommunistischen Ideologie selbst-
verständlich ist?
2) Beschränkt sich das als „Fortschritt“
zu bezeichnende Bewegungsgesetz auf
die besondere Sphäre, in dem wir ihm
bisher nachgegangen sind, oder lässt
es sich so auf die Gesamtbewegung des
menschheitlichen Werden übertragen, wie
es der kommunistischen Ideo-
logie selbstverständlich ist?
Beide Fragen können wir nur dann an-
10
gemessen beantworten, wenn wir näher
zusehen, in welcher Weise unter welchen Bedingungen sich der „Fort-
schritt“ auf dem Boden v. Naturwissen-
schaft – Technik – industrieller Produktion
vollzieht.
Rückblick auf die letzten drei Jahr-
hunderte. Die „Logik der Sache“. Die Ver-
tretbarkeit der Individuen. Die Ubiquität
der Geltung. „Schreitet“ der Mensch wirklich
auf dem Wege „fort“ – oder wird er nicht
durch die Sache fortgezogen? Die Steige-
rung des Tempos. Das Gefühl des Mitge-
rissenwerdens. Entpersönlichung. Man
wird „Sach-Walten“, „Funktionär“, „Robo-
ter“. Die „Mechanisierung“, „Kollekti-
vierung“. Die Sache „wächst uns über
den Kopf“. Der Fortschritt „Hat“ den Men-
schen, nicht macht der Mensch den
Fortschritt. +) So auch über das Gebiet der
theoret.-praktischen Arbeit hinaus.
Ein Getriebe, das uns im Genuss nicht weni-
ger als in der Arbeit mit sich reisst. Eine
weitestgehende Entpersönlichung, Kollek-
tivierung.
In dem Festgestellten liegen die Antwor-
ten auf die beiden von uns gestellten
+) Schreite ich fort oder werde ich fortgeschritten?
11
Fragen enthalten:
1) In dem der Mensch, den Schritt zur
math. Naturerscheinung hinüber tut,
betritt er eine Bahn, auf der fortzu-
schreiten zugleich ungeheuren Gewinn
in theoretischer Welterschliessung und
praktischer Weltbemeisterung und
Bedrohung des personalen Seins be-
deutet. Wie stets, so muss auch und erst
recht hier der Gewinn mit neuer Selbst-
gefährdung bezahlt werden. Ohne Fra-
ge gehört der „Fortschritt“ zum Wesen des
Menschen, ist nicht Fehltritt oder Sün-
denfall, aber auch über ihm liegt der
Schatten der Ambivalenz. +)
2) Es ist die Dominanz der „Sache“, die
sowohl das Wesen als auch die Bedroh-
lichkeit des „Fortschritts“ bedingt. Dieselbe
Dominanz muss ins Auge gefasst werden,
wenn wir die Frage der Übertragbarkeit stel-
len. Wenn die Geradlinigkeit des Fort-
schritts darauf beruht, dass der Mensch
dem Leitfaden einer von ihm zu resfaktie-
+) Dies der Sachverhalt, den die Kulturkritik
richtig gesehen hat!
12
renden „Sache“ folgt, so würde die Mög-
lichkeit der Übertragung davon ab-
hängen, dass auch anderwärts eine
ebenso streng gebietende Sache als
Leitfaden aufzufinden wäre. Gibt es
das ausserhalb d. Sphäre von Naturw. –
Technik – Industrie?
Dass dieser Parallelismus in der
Tat bestehe, ist die Behauptung der
kommunist. Doktrin. „Naturgesetze“ der
Seele, der Gesellschaft, der Geschichte. Auf
ihre Kenntnis gründet sich eine Praxis
der Menschenbehandlung u. –ordnung,
die d. technik analog ist und die daher
den gesellschaftlichen „Fortschritt“ in Gang
Verallgemeinerung
erhält. Daher die Universalisierung des
Fortschritts-Prinzips.
Unsere Frage: ist dem also – und kön-
nen wir wünschen, dass dem also wäre?
Im Bereich von Natur u. Technik ist
die Sache das Aussermenschliche, ja
Gegenmenschliche, d.i. die unlebendige
Natur. „Sache“ als Gegenpol der „Person“!
Also im vom Menschen Geschiedenes und
Verschiedenes. Eben deshalb zum „Leitfaden“
13
geeignet. Natur die grosse Unparteiische,
vor der Leidenschaften u. Gegensätze zu
verstummen haben. Eben in dieser Unbe-
zu der
rührbarkeit als Leitkraft und zum organisie-
renden Prinzip prädestiniert. Die Natur
hilft die menschlichen Tätigkeiten „orga-
nisieren“, weil sie vom Spiel d. menschl.
Leidenschaften und Gegensätze unbe-
rührt ist. Sachbestimmende Interpretation der
Personen.
Wie alle, wenn der „Fortschritt“ sich an
u. in menschlichen Leibern und Seelen
realisieren soll? Gibt es da auch eine
von menschl. Leidenschaften unberührte
über
„Natur“, eine gegen menschl. Gegensätze
erhabene „Sache“ die dem „Fortschritt“ zum
Leitfaden dienen könnte? Aber hier geht
ja nicht um die Arbeit am Ausser-
menschlichen, es geht um die Führung,
Ordnung, Gestaltung gerade des Menschli-
chen, und dieses Menschliche hat seinen
Kerngehalt gerade an den Strebungen, Lei-
denschaften, Gegensätzen, die dort durch
das Gebot der aussermenschl. Sache, die
wir „Natur“ nennen, zum Schweigen ver-
urteilt wurden. Aussermenschl. Natur u.
Menschenwelt: das sind zwei
14
verschiedene Dimensionen menschlichen
Handelns. Nur dort der Leitfaden der
aussermenschl. Sache. Hier muss d.
Fortgang der Dinge immer wieder aus der
lebendigen Bewegung menschlicher
Strebungen, Leidenschaften, Gegensätze
herausgearbeitet werden. Hier gibt es
keine „Naturgesetze“, die
„Ingenieure“ der menschlichen Gesell-
schaft den „Fortschritt“ manipulieren
könnten.
Es fehlen also im Bereich des Mensch-
lichen gerade die Bedingungen, die es im
Umgang mit dem Aussermenschlichen
den Menschen möglich machen, die Linie
eines <....klaren> „Fortschritts“ einzu-
halten. Es fehlt der vom Menschen un-
abhängige „Leitfaden“. Die vom Kommu-
nismus postulierte und äusserlich ma-
nipulierte Übertragung widerstreitendem
Wesen der zu ordnenden Dimension.
Man ist zunächst geneigt, in dieser
Einsicht die Nötigung zu einem schmerz-
lichen Verzicht zu finden. Wie schön
wäre es doch, wenn d. Kommunismus recht
hätte, wenn also auch in d. Sphäre der menschl.
15
Dinge der „Fortschritt“, nicht nur möglich,
nicht nur gefordert, sondern durch un-
ablenkbare „Naturgesetze“ garantiert wäre! +)
Allein das Recht dieser Klage muss uns
fraglich werden, wenn wir uns an das
erinnern, was der Mensch auf sich neh-
men muss, um im Umgang mit der
Natur den „Fortschritt“ so grossartig reali-
sieren zu können: der drohende Verlust
der Person an die die Führung überneh-
mende Sache! Angenommen, dass
der Mensch auch im Umgang mit
der Menschenwelt, d. i. seiner eige-
nen (!) Welt, die Führung an eine zu
respektierende Sache abzugeben hätte:
würde damit nicht die Preisgabe seiner
selbst als Person perfekt werden? Würde
er sich nicht endgültig in den „Sach-
Walter“ transformieren? Müsste er
doch das, was in ihm als Person lebt, zu
gunsten der ermittelten „Naturgesetze“ das
Menschliche unterdrücken. Die „Person“
weicht der „Sache“!
Seien wir glücklich, dass es nicht so
ist – das derselbe Mensch, der sich in frei-
willigem Gehorsam dem Gebot der „Sache“
+) Blick auf d. Wirrsal d. menschl. Geschichte. Er-
lösungssehnsucht! Propagandawirkung!
16
unterstellt und damit die Bahn des sach-
geleiteten „Fortschritt“ betritt, ausserhalb die-
ser Zone eine personale Freiheit geniesst,
die nicht an ein Sachgebot gebunden
ist, sondern sich in Taten und Werken
geniesst, die deshalb im vollsten Sinne
des Wortes Produkt der „Freiheit“ heissen
dürfen, weil sie nicht durch die Logik des
Sachfortgangs vorgezeichnet sind, sondern
der Inspiration der schöpferischen Augen-
blicke entspringen, mithin etwas ande-
res und mehr sind als das Weiterziehen
einer durch die Sache vorgezeichneten
Entwicklungslinie. Mit Recht hat man
seit je in den Schöpfungen der Kunst die
prägnantesten Zeugnisse dieser sich jeder
Einreihung entziehenden Freiheit der
Gestaltung erblickt. Wer liesse es sich
einfallen, die Werke der Kunst in die Linie
eines durch die Sachlogik bestimmten
Fortschritts einstellen zu wollen! Unbeschadet
aller Kontinuität der künstlerischen Über-
lieferung darf von jedem Kunstwerk ge-
sagt werden, dass es selig in sich selber
ruht, eine geschlossene Welt, die alle
17
Verbindungslinien nach rückwärts und nach
vorwärts abgebrochen hat und nur als es
selbst und durch sich selbst zu uns spricht.
Daher beglückt es uns durch das Gefühl
des Ausruhens; wir sind herausgenom-
men aus der des unaufhörlichen
„Fortschreitens“.
Aber auch von dem gestaltenden Tun,
das sich in der Führung und Formung
der Menschenwelt auslebt, darf gesagt
werden, dass es widerum unbeschadet
der Kontinuität des geschichtl. Fortgangs,
zuletzt aus Inspiration entspringt, die
die Logik eines zwingenden Sachzusam-
menhangs tief unter sich lassen. Nicht
gründlicher könnte eine Sphäre miss-
verstanden und entstellt werden als
es durch eine Doktrin geschieht, die, wie
die kommunistische, hier nicht weiter
zu behandeln glaubt als das Entlangge-
hen am Faden einer angeblich wis-
senschaftlich feststellbaren naturgesetz-
lichen Notwendigkeit. Die Menschen-
geschichte wäre eine sehr langweilige
Sache, gäbe es nicht auch in ihr ein
menschengestaltendes Schöpfertum.
18
Freilich: hoch ist der Preis, den der
Mensch für die ihm hier geschenkte Frei-
heit zu zahlen hat. Das er sich hier
nicht an den Leitfaden eines sachbe-
stimmten Fortschritts halten kann bzw.
halten muss, das eröffnet ihm zwar
das Reich der schöpferischen Freiheit – aber
diese Freiheit ist als solche auch die
Freiheit zu Irrtum. Fehltritt, ja zu grauen-
hafte Selbstentstellung. Die Ambivalenz
in höchster Potenz. Zum geringeren Preis
als den der permanenten Selbstbedro-
hung ist die Freiheit nicht feil. +) Kein
Wunder, dass die Geschichte, dies Feld
der freien Selbstgestaltung des Menschen-
geschlechts, und das Schauspiel von so
viel grauenhaften Verirrungen u. Katastro-
phen bietet. Es gehört schon ein hohes Mass
v. Selbsttäuschung dazu, auch auf diesem
Felde die aufsteigende Linie eines durch
die Logik der Sache bestimmten Fortschritts
aufzeigen zu wollen! So die Aufklärung,
Hegel, d. dialekt. Materialismus.
Es ist demnach nicht an
dem, dass das Prinzip des Fortschritts von
dem Gebiete her, in dem es zu Hause ist,
+) Vgl. das naturgegängelte Tier!
19
auf das Ganze des menschheitlichen Wer-
dens übertragen werden könnte. Seine
Geltung ist strengstens beschränkt auf
diejenige Sphäre, in der die Wissenschaft
vom Aussermenschlichen die Leitlinie
des Fortschreitens herausarbeitet und so
die menschl. Leidenschaften u. Gegensätze
zum Verstummen nötigt.
Aber gewinnen wir damit nicht den
Eindruck, als sei das menschl. Leben dem
Dualismus verschiedener, ja entgegen-
gesetzter Bewegungsprinzipien ausgeliefert?
Hier Fortschritt, dort Freiheit regellosen Schöp-
fertums? Ein schwer ausgleichbarer Gegen-
satz!
Das würde dann der Fall sein, wenn
die bei den hier unterschiedenen Sphären
menschl. Tuns einander koordiniert
wäre, wenn sie gleichberechtigt nebenein-
anderständen. Denn dann wäre das Le-
ben des Menschen ein stets Herüber und
Hinüberwechseln zwischen völlig hetero-
genen Sphären des und Handelns.
Aber diese beiden Sphären sind einander
nicht gleichgeordnet. Sie stehen zu einan-
derim Verhältnis einer leicht aufzeig-
baren Rangabstufung.
20
Alles, was in der Sphäre des sachbestimm-
ten Fortschritts zu Tage gefördert, gehört
wenn man es im Rahmen des menschl.
Gesamtlebens betrachtet, dem Reich der
„Mittel“ an. Es sind die Mittel der Daseins-
erhaltung und Daseinshebung, in deren
Besitz der Mensch durch den Ausbau
dieser Sphäre gelangt. Der Fortschritt, der
hier geschieht, ist v. Standpunkt des prakt.
Lebens aus gesehen, ein Fortschritt in der
Mittelbereitung und Mittelvervollkomm-
nung. Mittel aber sind vielfältig verwend-
bar. Ihre Ambivalenz. Der Mensch in
der Wahlsituation. Die Notwendigkeit der
Entscheidung, durch welche der „Zweck“ ge-
setzt wird. Extreme Darstellung durch die
Wahlsituation, in welche der Mensch durch
die Freisetzung der Atomkraft versetzt worden
ist.
Die Zwecksetzung aber ist das, was sie ist,
weil sie nicht sachgebunden ist wie das
mittelbestimmende Denken, sondern Äusse-
rung der personalen „Freiheit“ – eben jener
Freiheit, die ausserhalb und jenseits der
Sphäre des „Fortschritts“ ihren Ort hat. So weist
21
der „Fortschritt“, weil er nur Fortschritt in der
Mittelbestimmung ist, über sich selbst hinaus,
in die Sphäre der zweckbestimmenden Freiheit,
die ihrerseits durchaus nicht nach dem Prin-
zip des Fortschritts gebaut ist, sondern alle jene
zu berechenbaren des menschl. Stre-
bungen und Leidenschaften in sich schliesst.
Es ist also nicht so, dass die Sphäre
des sachbestimmten Fortschritts und der
nicht an die Sache zu bindenden Freiheit
einander äusserlich koordiniert wären.
Was mit den durch die ersten enthüll-
ten Sachen und bereits gestellten Mittel an-
gefangen wird, darüber fällt in der zweiten
die Entscheidung. Der Fortschritt nimmt die
dienende Stellung ein im Verhältnis zu der
sich Freiheit
des Menschen. Ob der Fortschritt Segen oder
Fluch aus sich gebiert, das hängt, heute
wie stets, an der Freiheit des sich für das
Eine oder das Andere entscheidenden Men-
schen. Eine gestufte Lebensordnung.
Was die Ausstellung uns zeigen will: den
Fortschritt, über dessen Gaben der Mensch
diejenige Entscheidung fällt, die unserem
22
Geschlecht zum Heil und nicht zum Fluch
ist. Der Fortschritt, gezähmt und bewacht
durch eine Freiheit, die ihn vor selbst-
mörderischen Exzessen bewahrt und dem
recht verstandenen Wohle unseres Ge-
schlechts dienstbar macht. Eine Gesin-
nung, gleich ferne von gedankenlosem
Zivilisationsoptimismus und verzwei-
felndem Kulturpessimismus. Dieser
lähmt die Schaffensenergien, jener
(Kommunismus!) schläfert die Wach-
samkeit gegenüber möglichen Ausar-
tungen des „Fortschritts“ ein. Skylla und
Charybdis. |