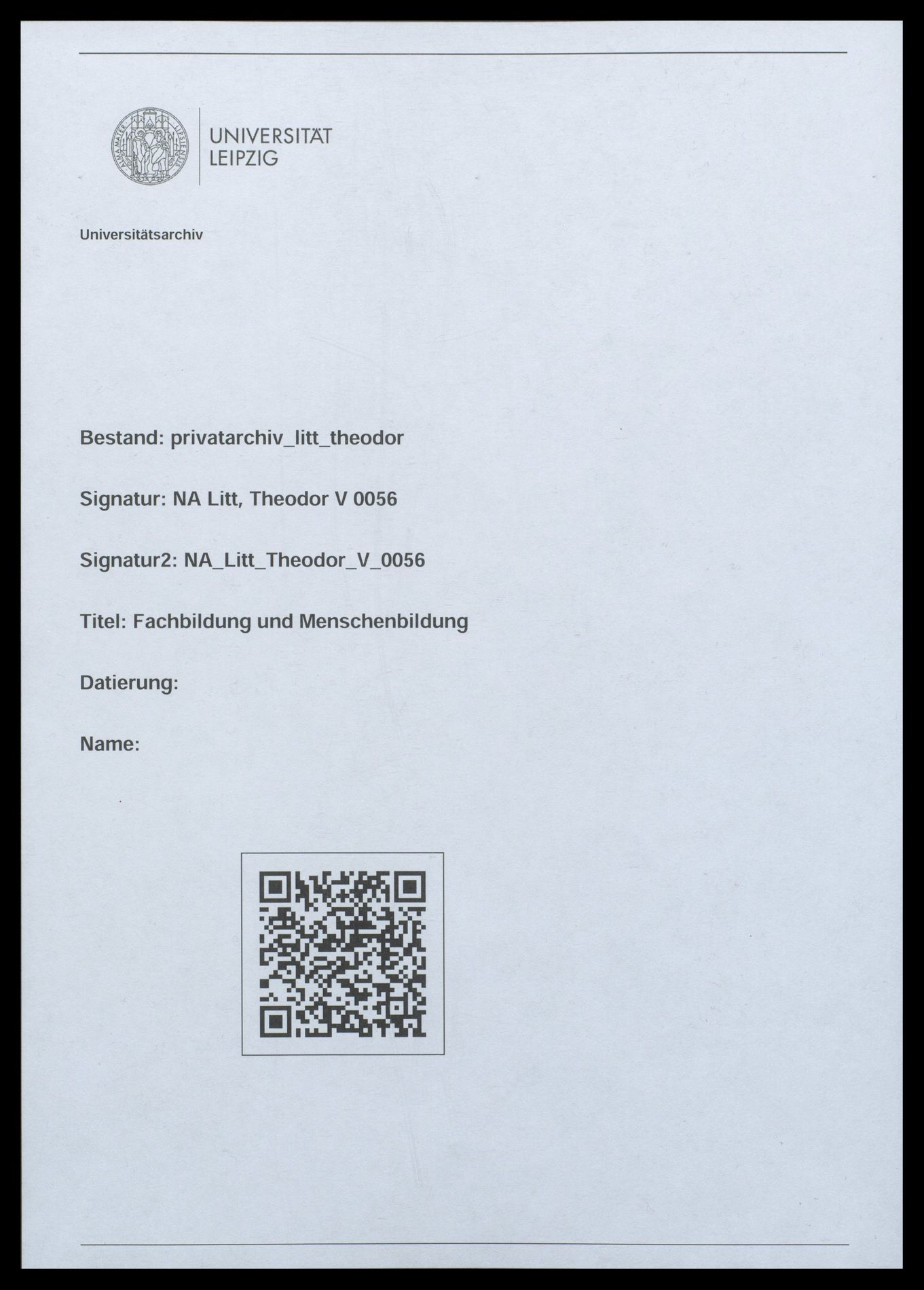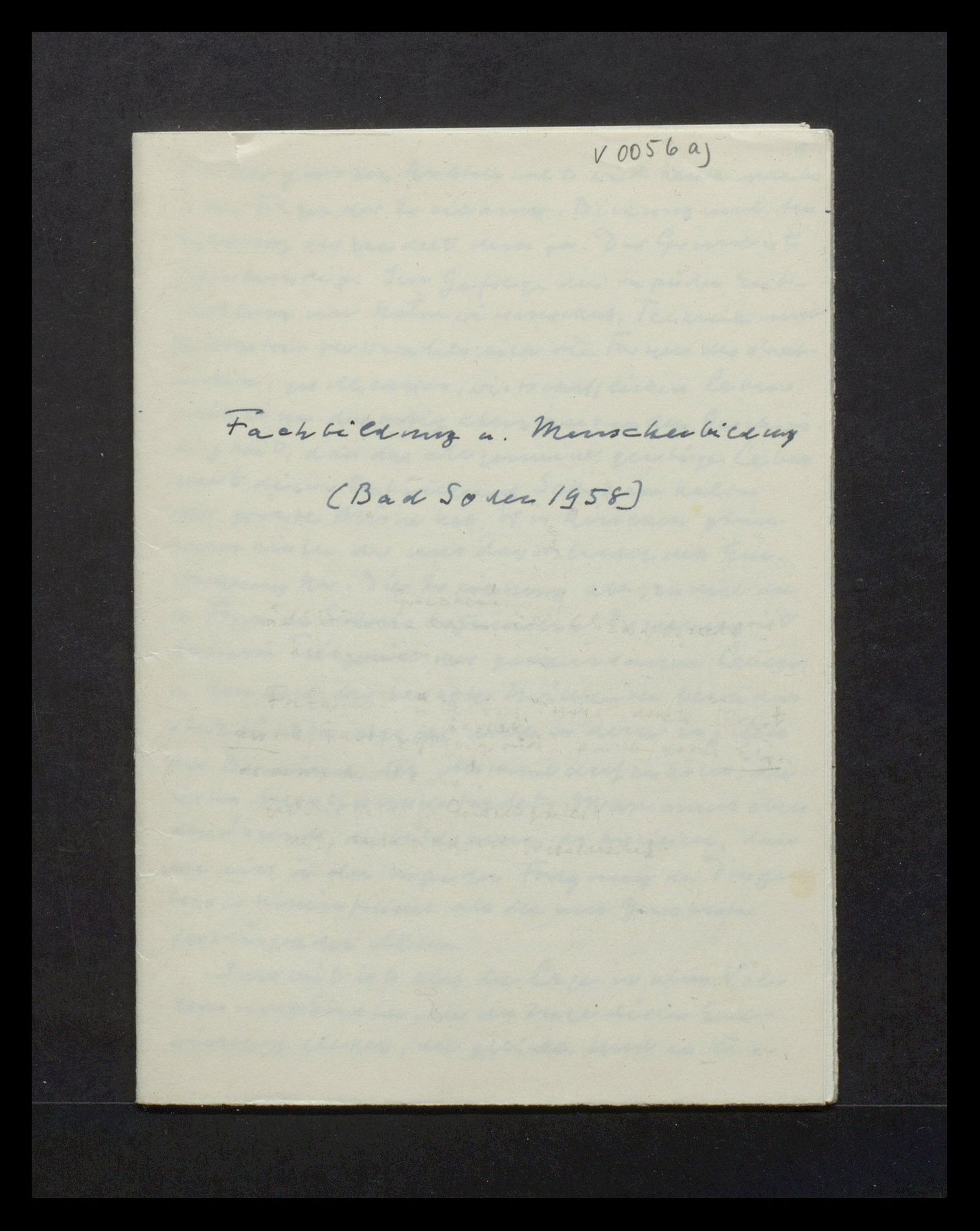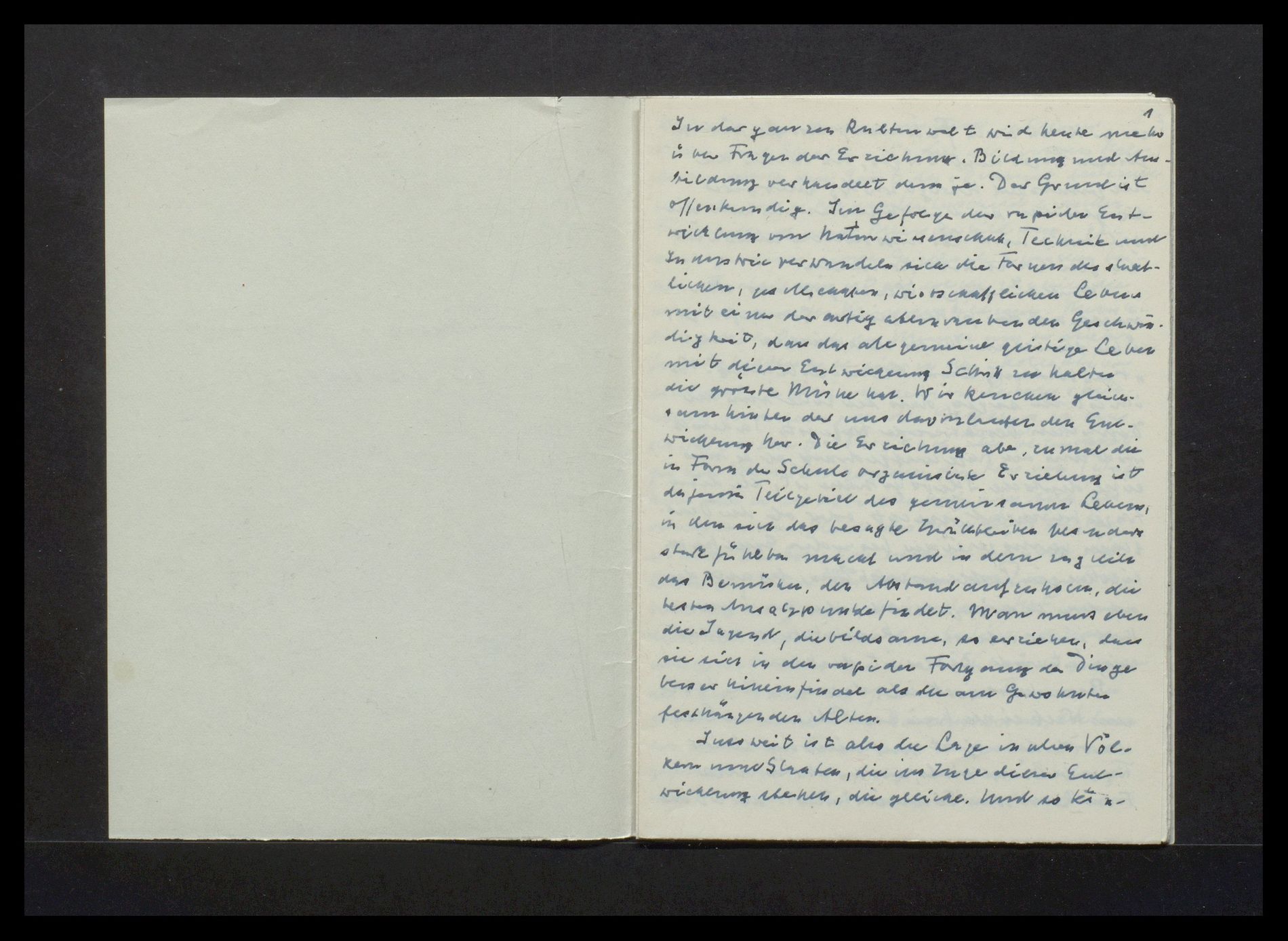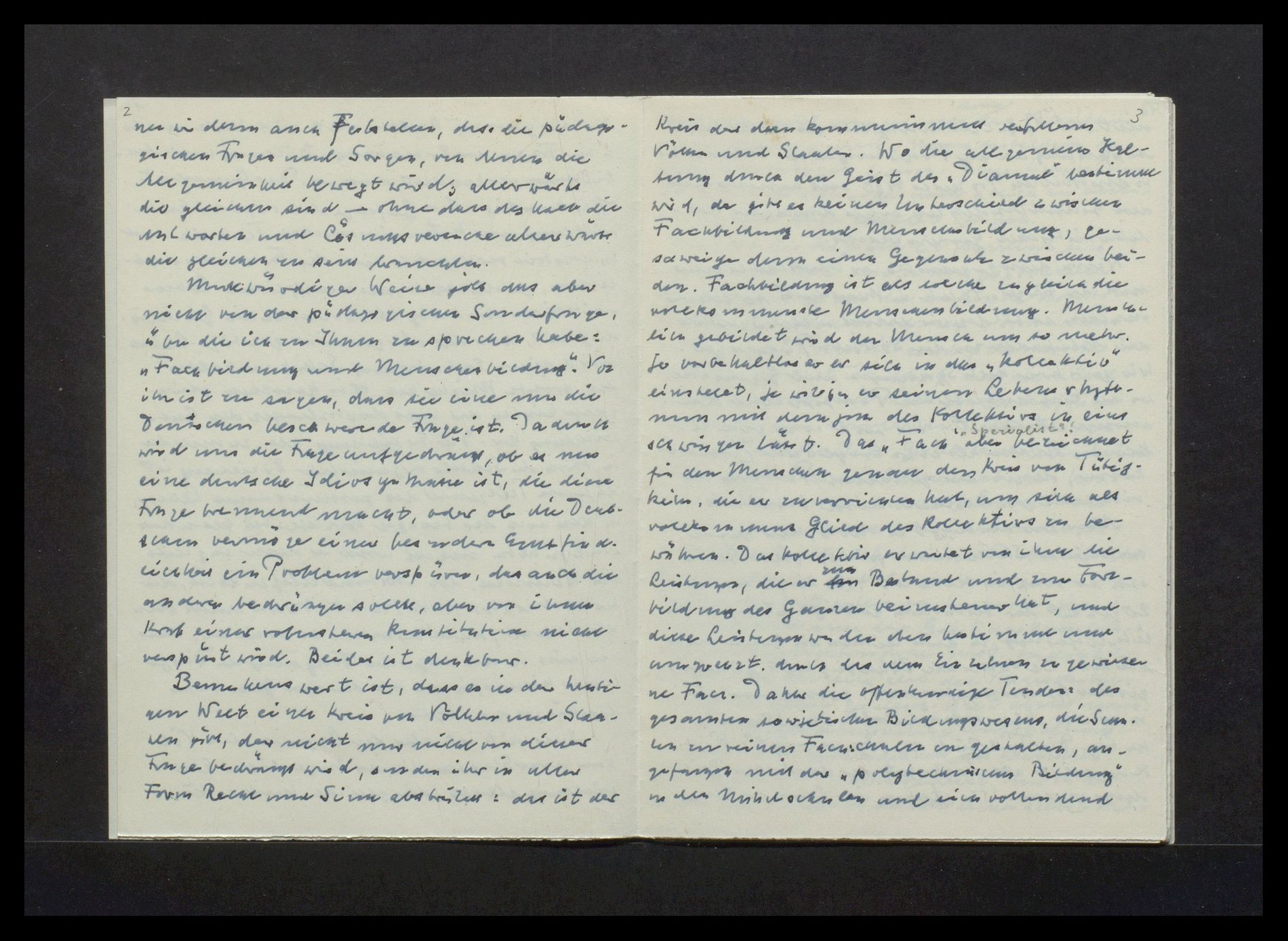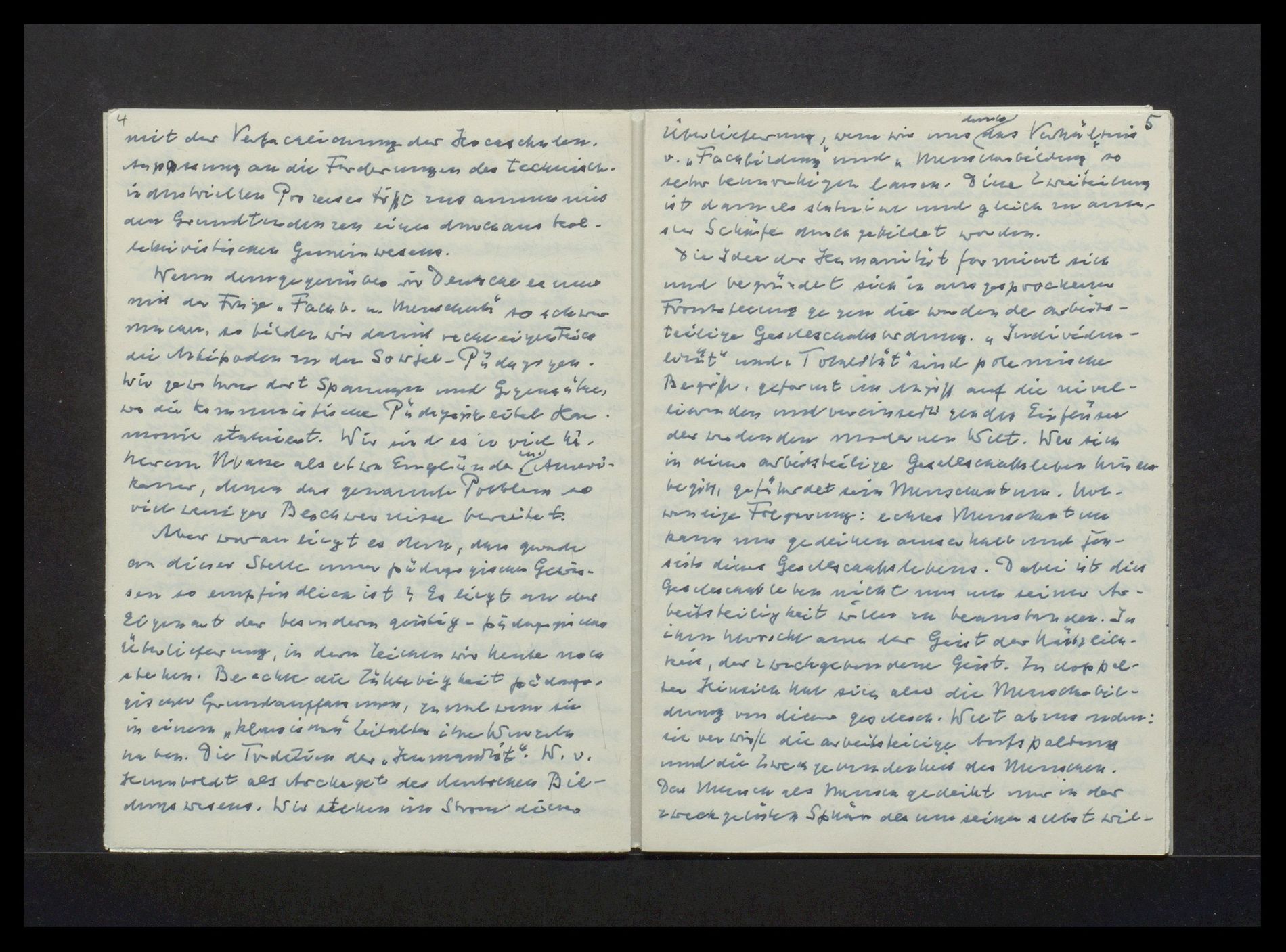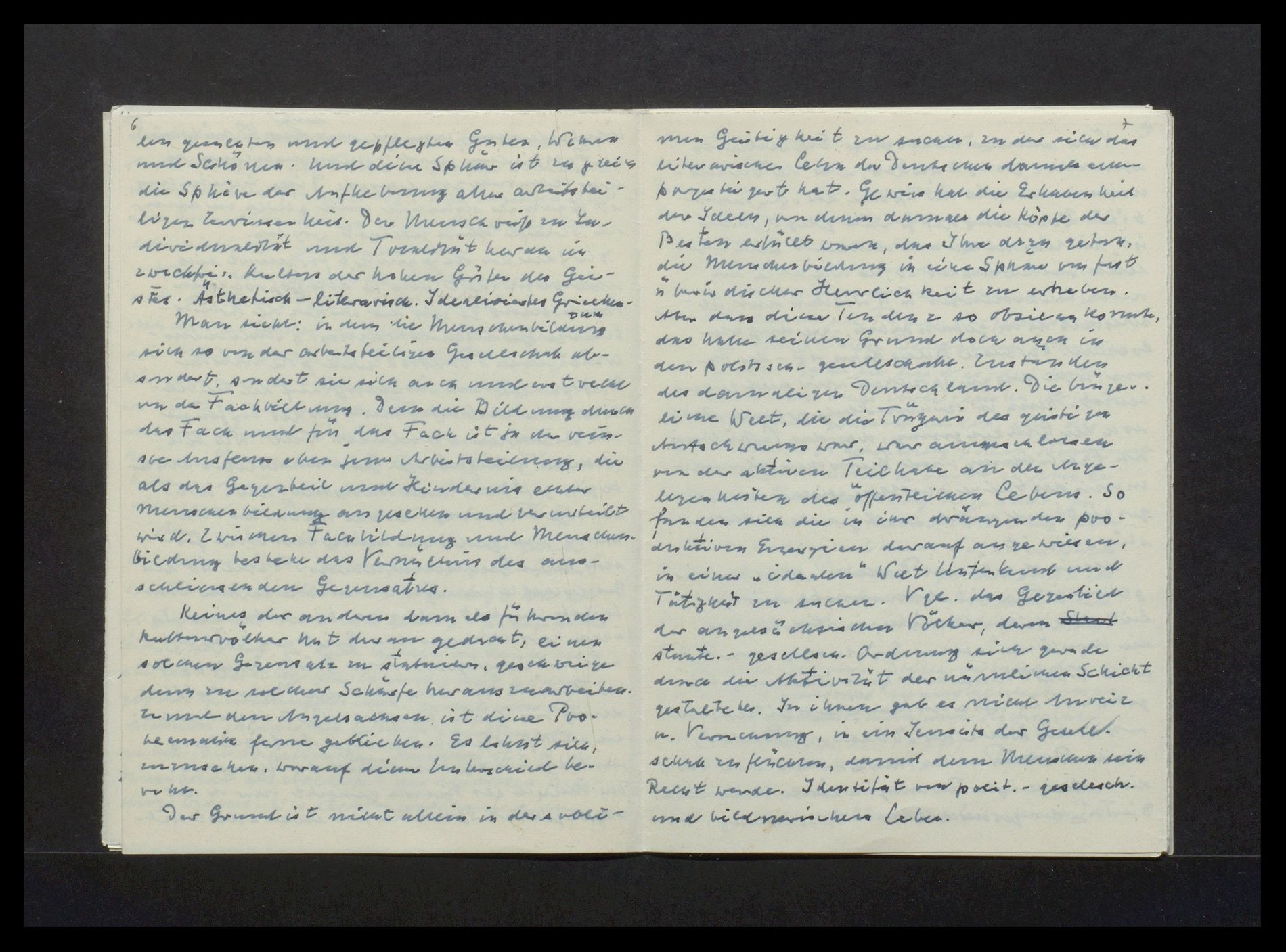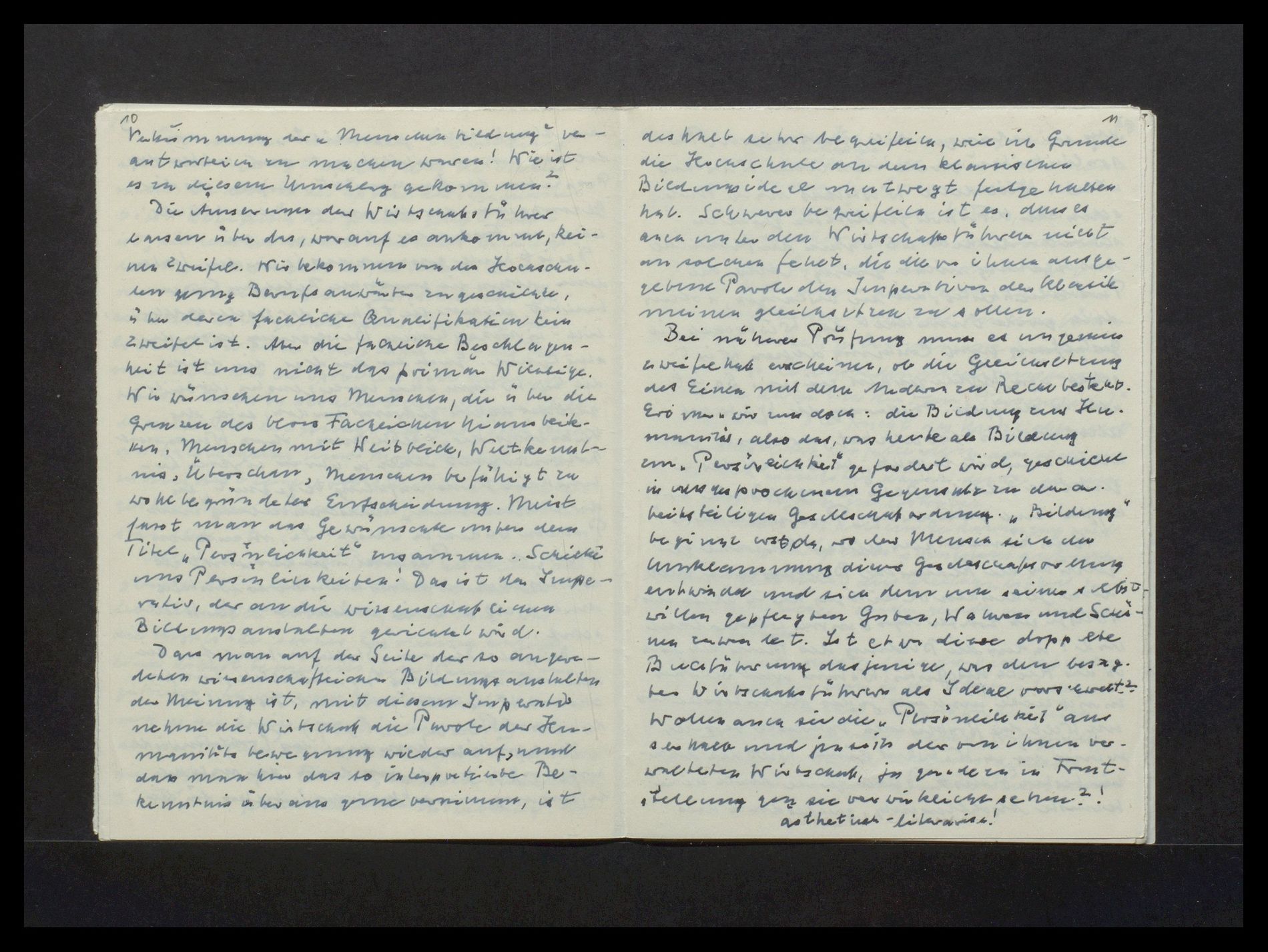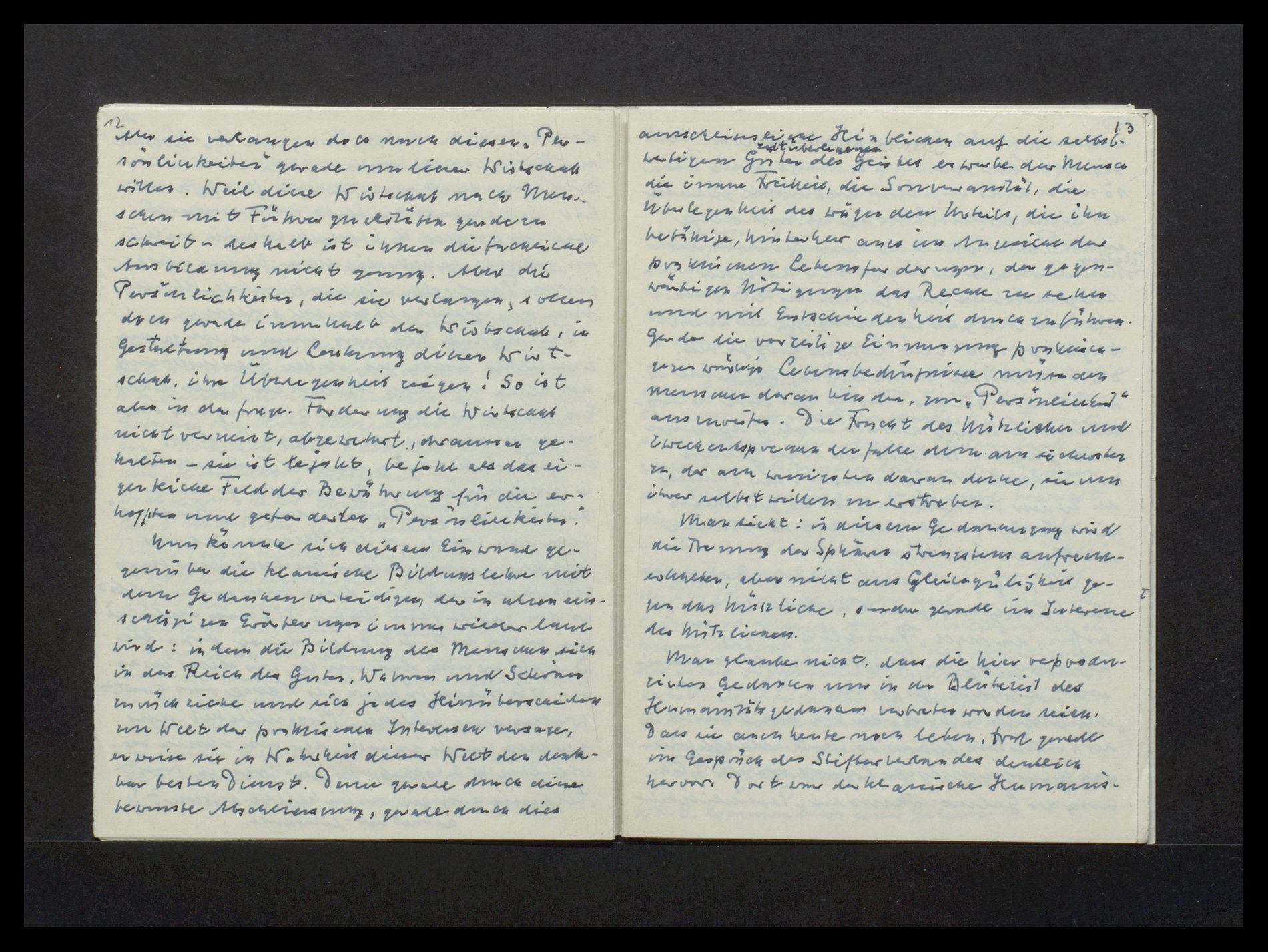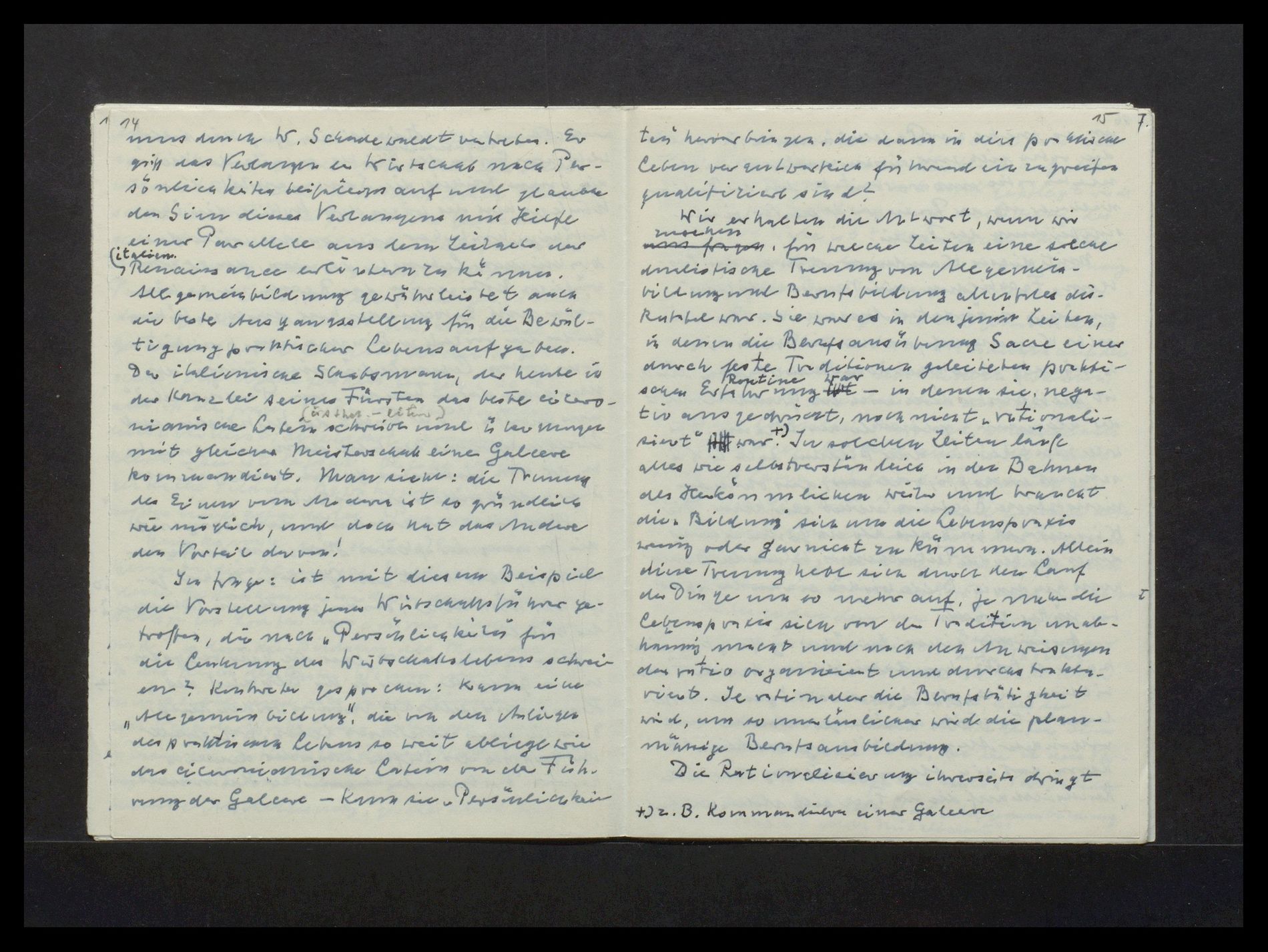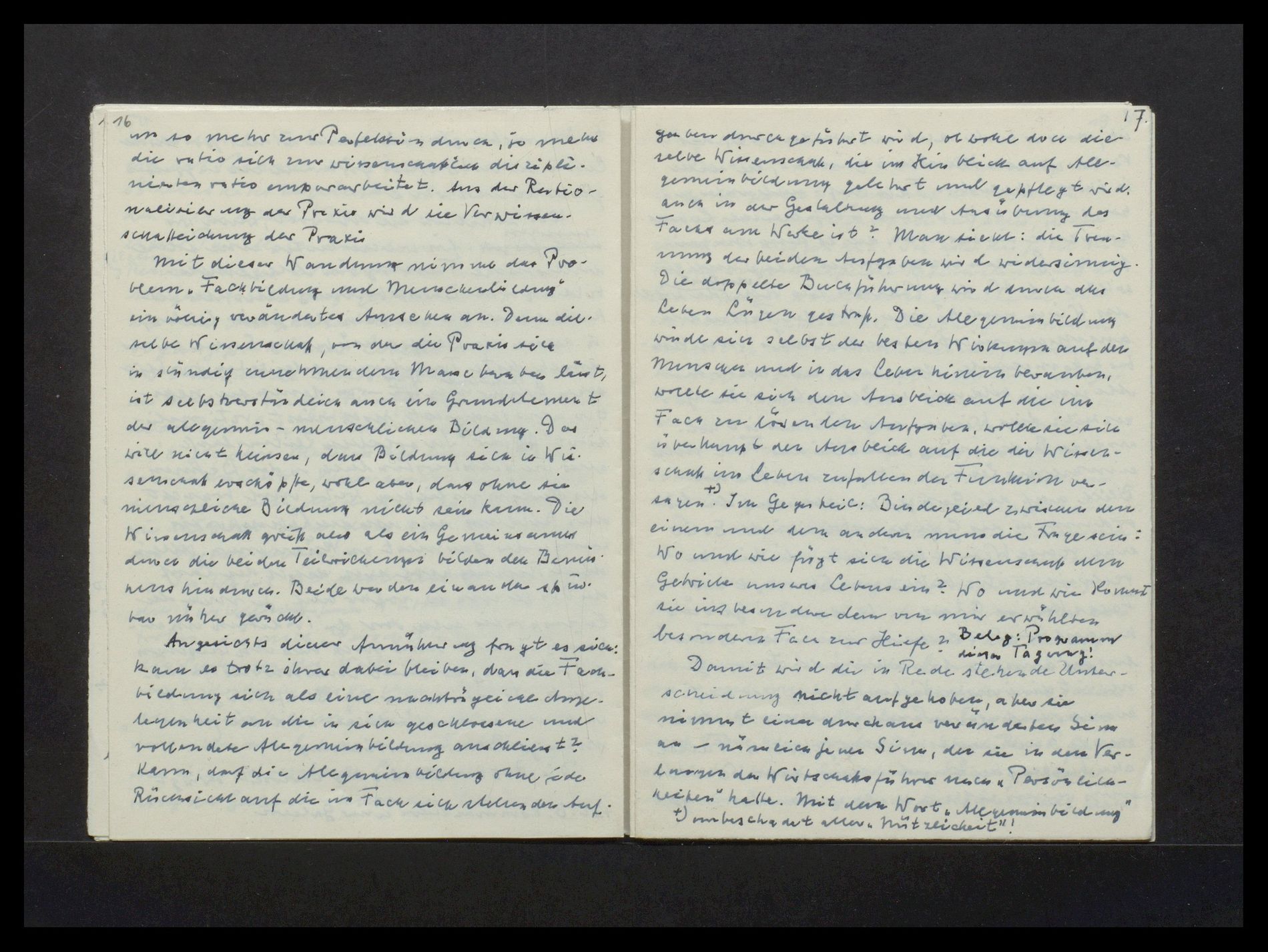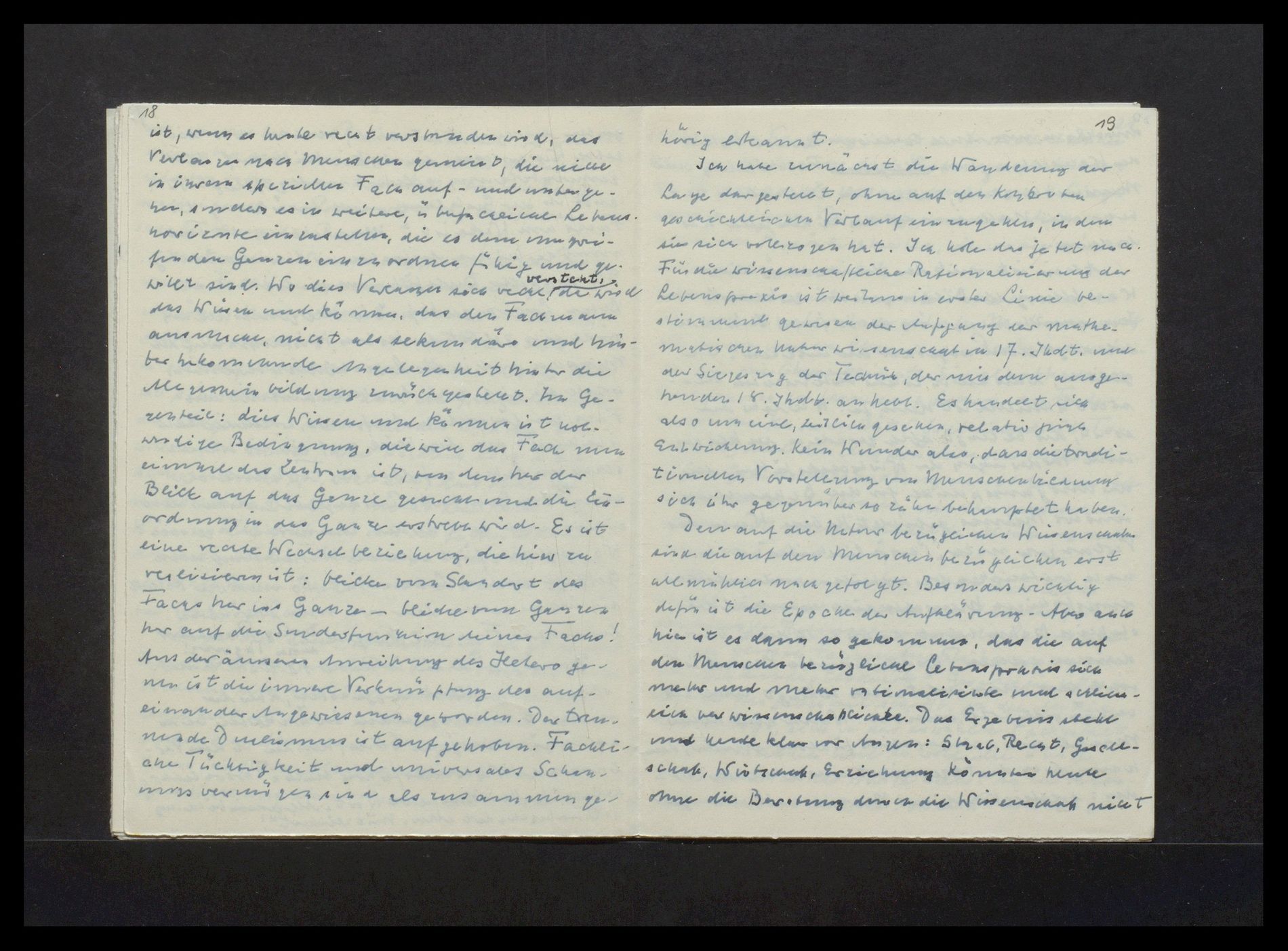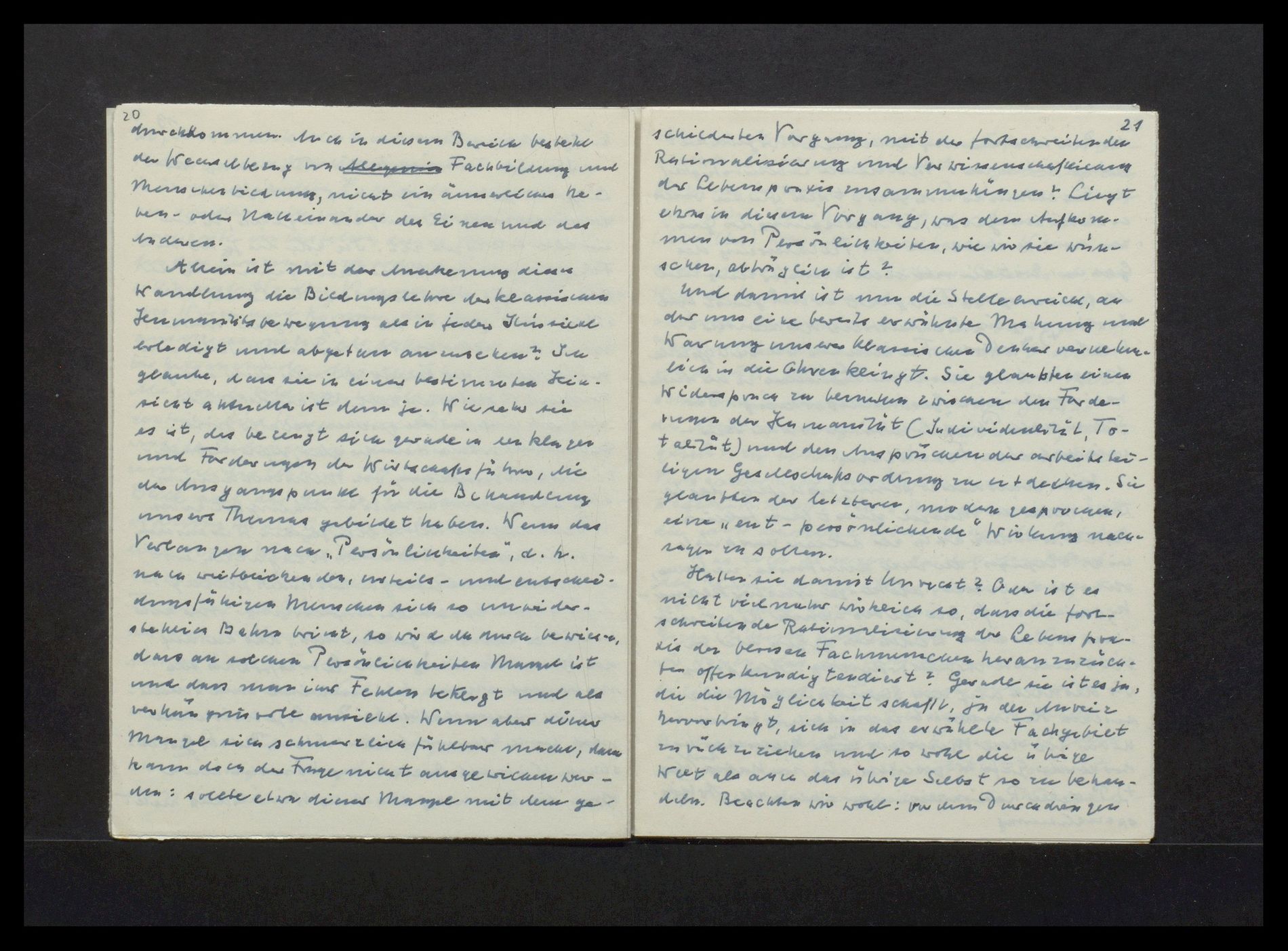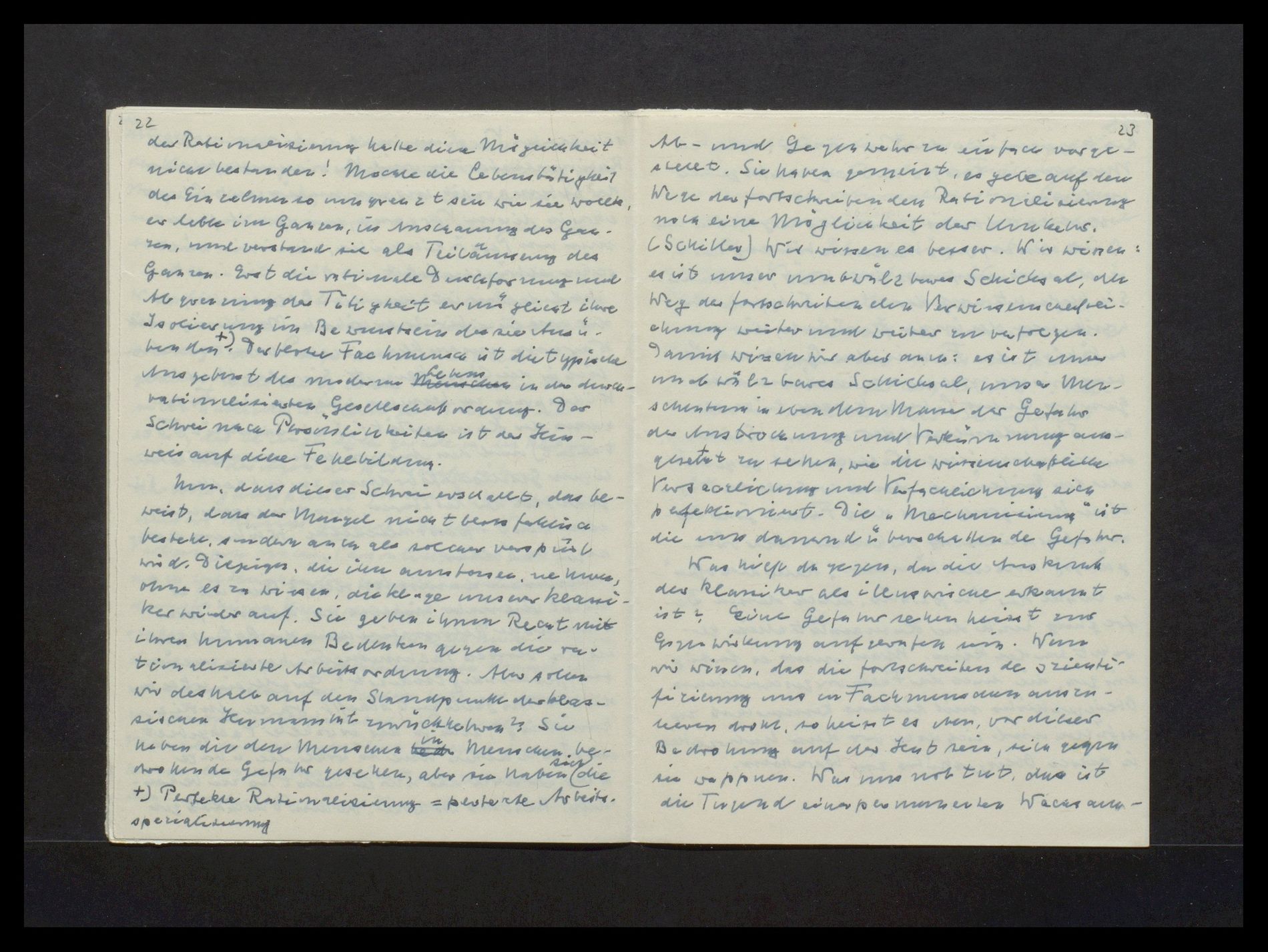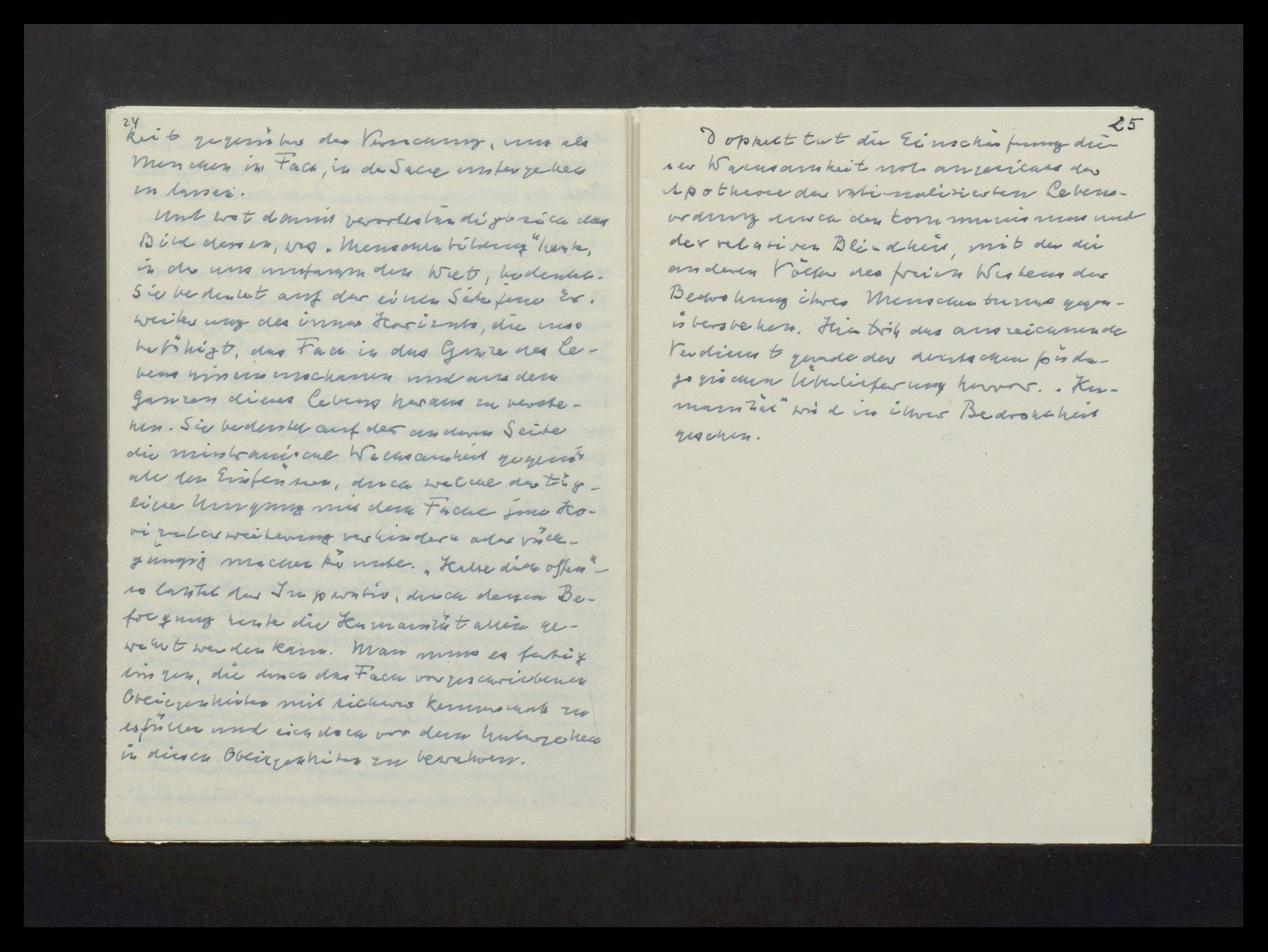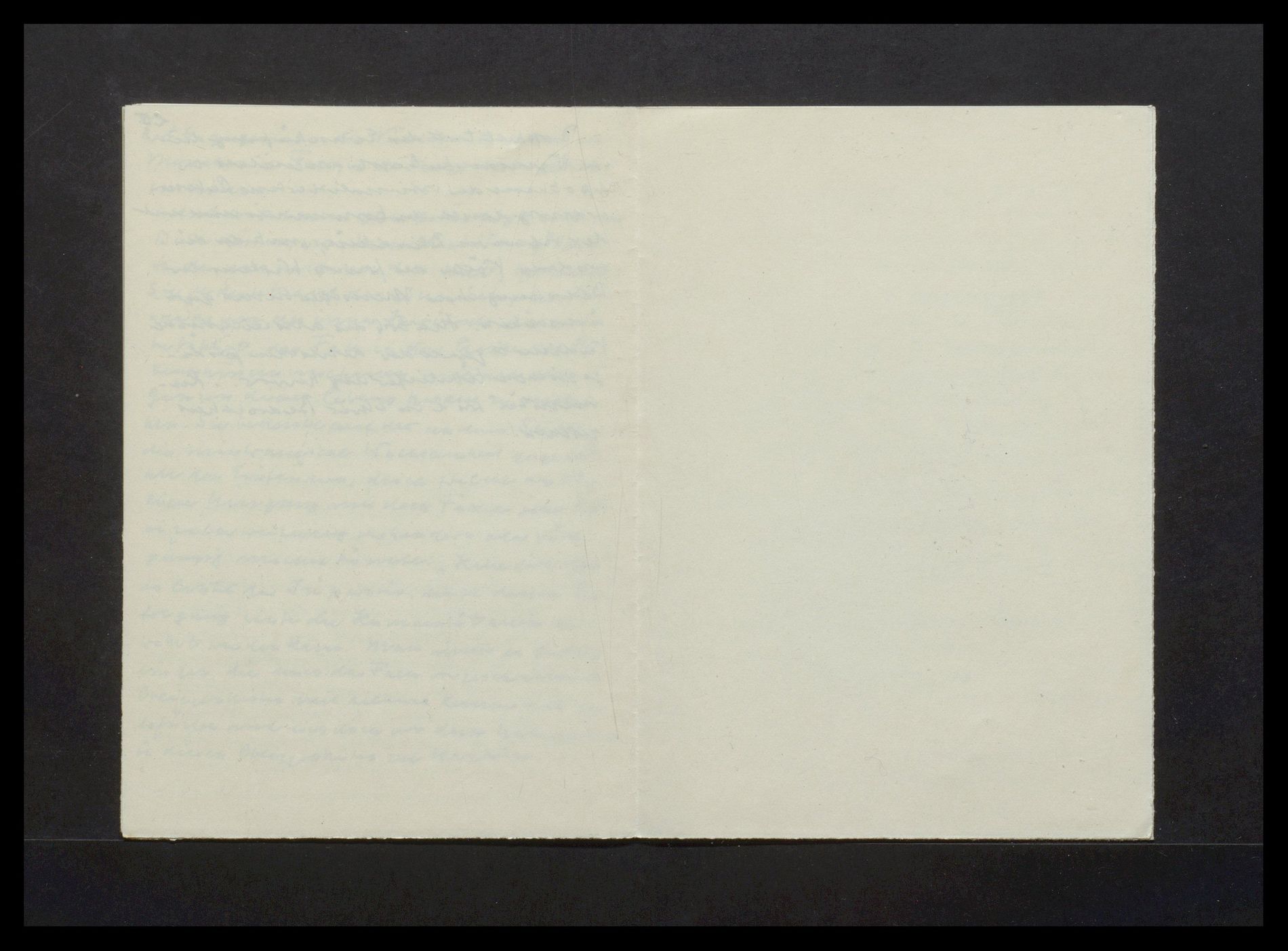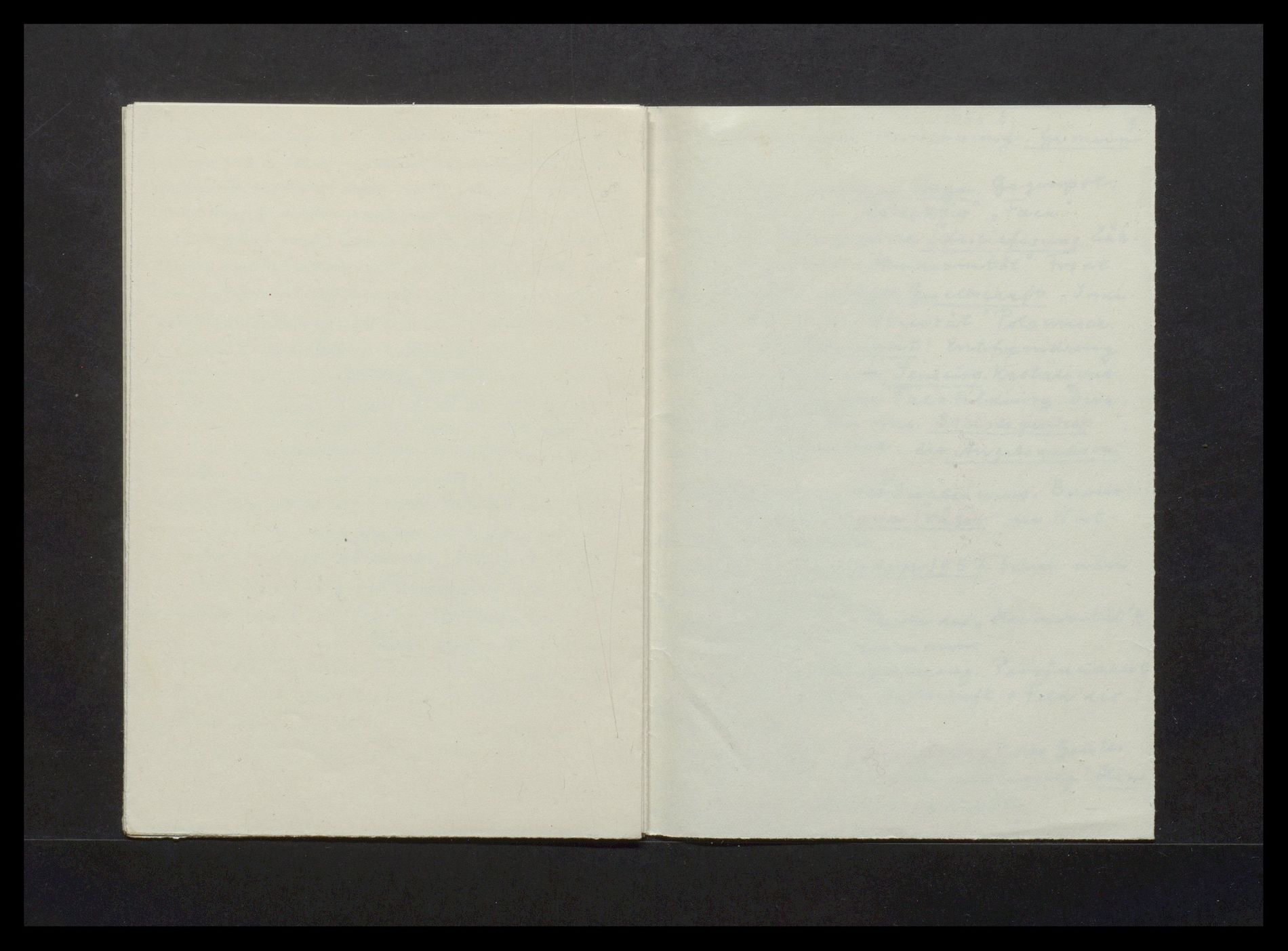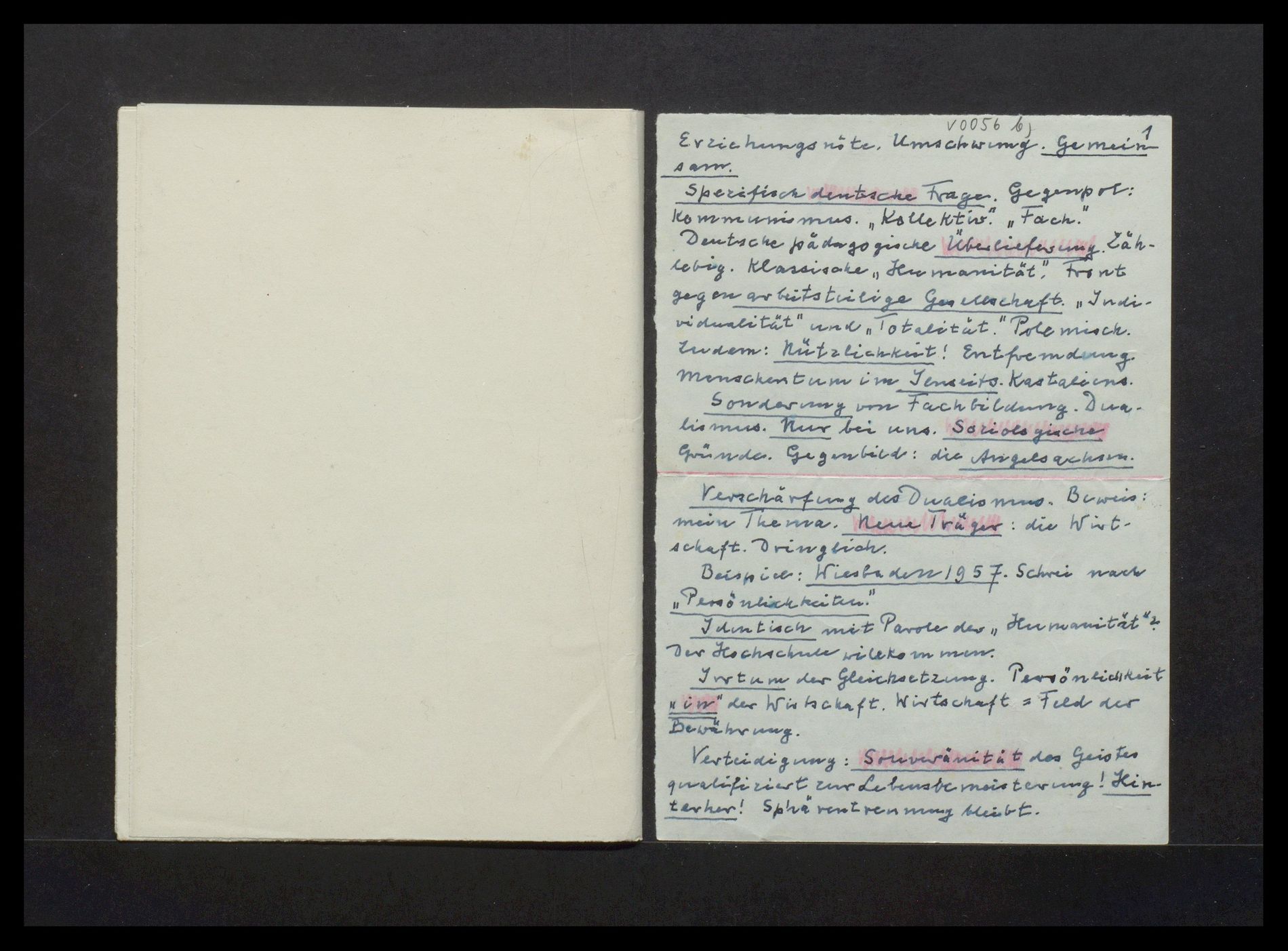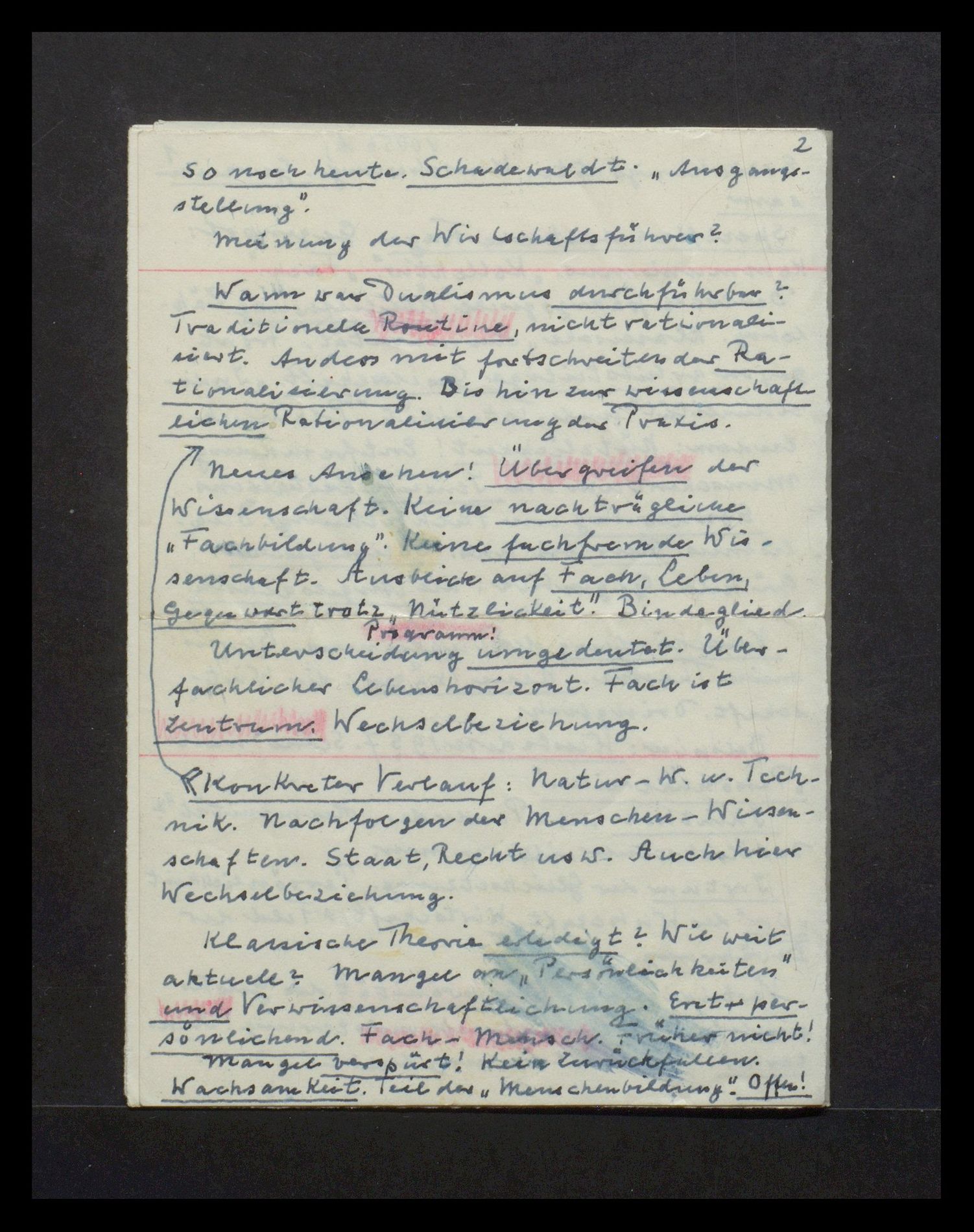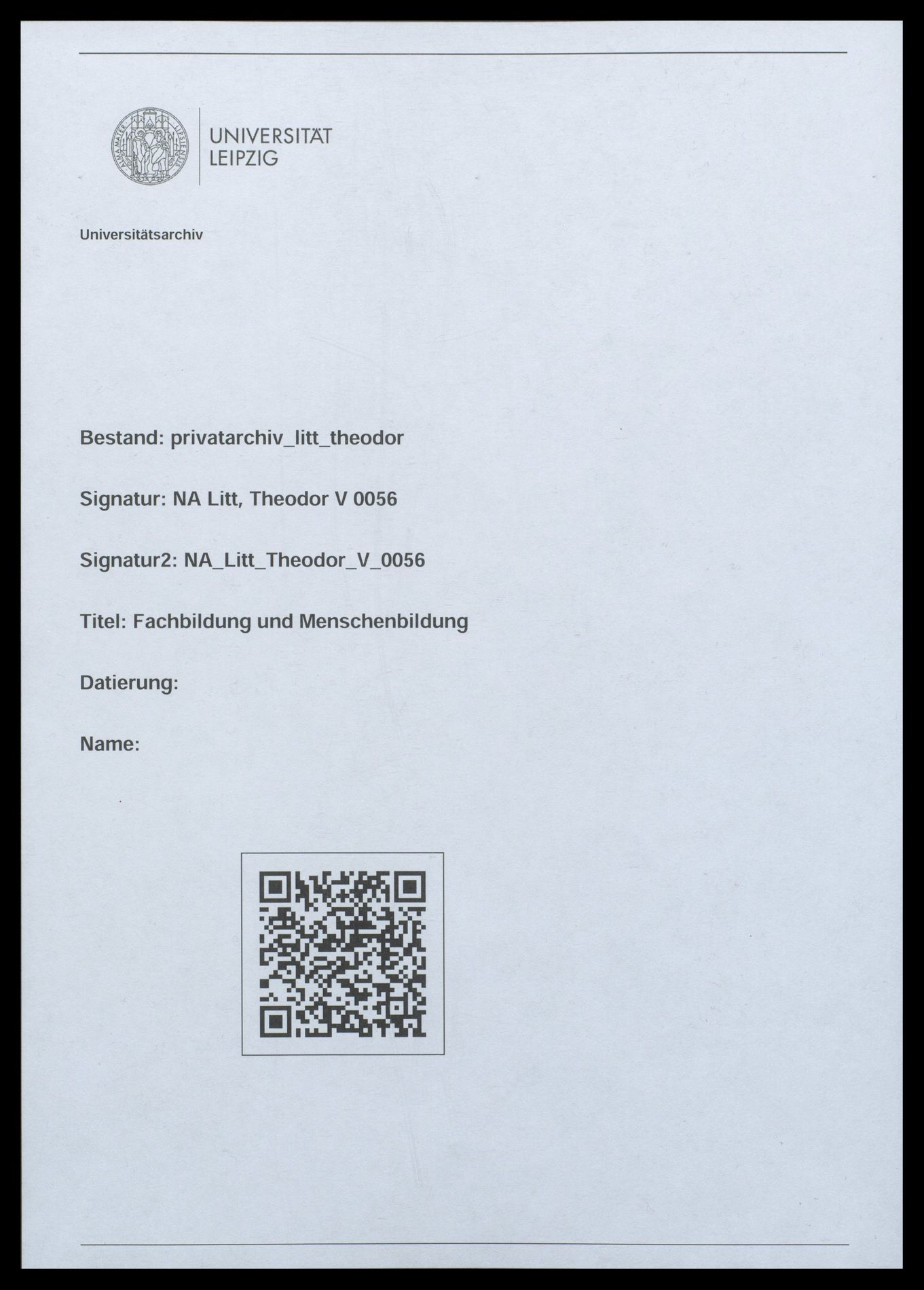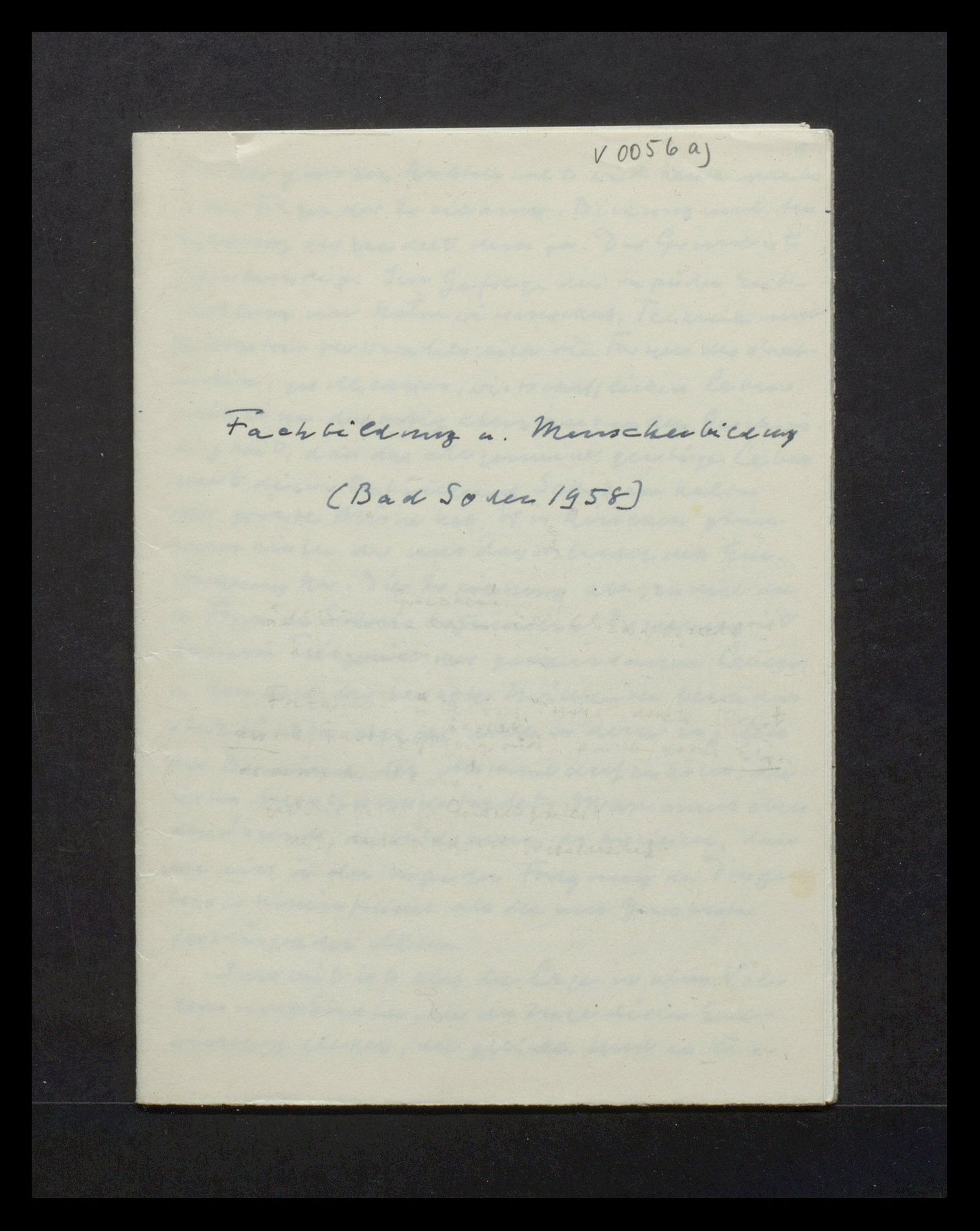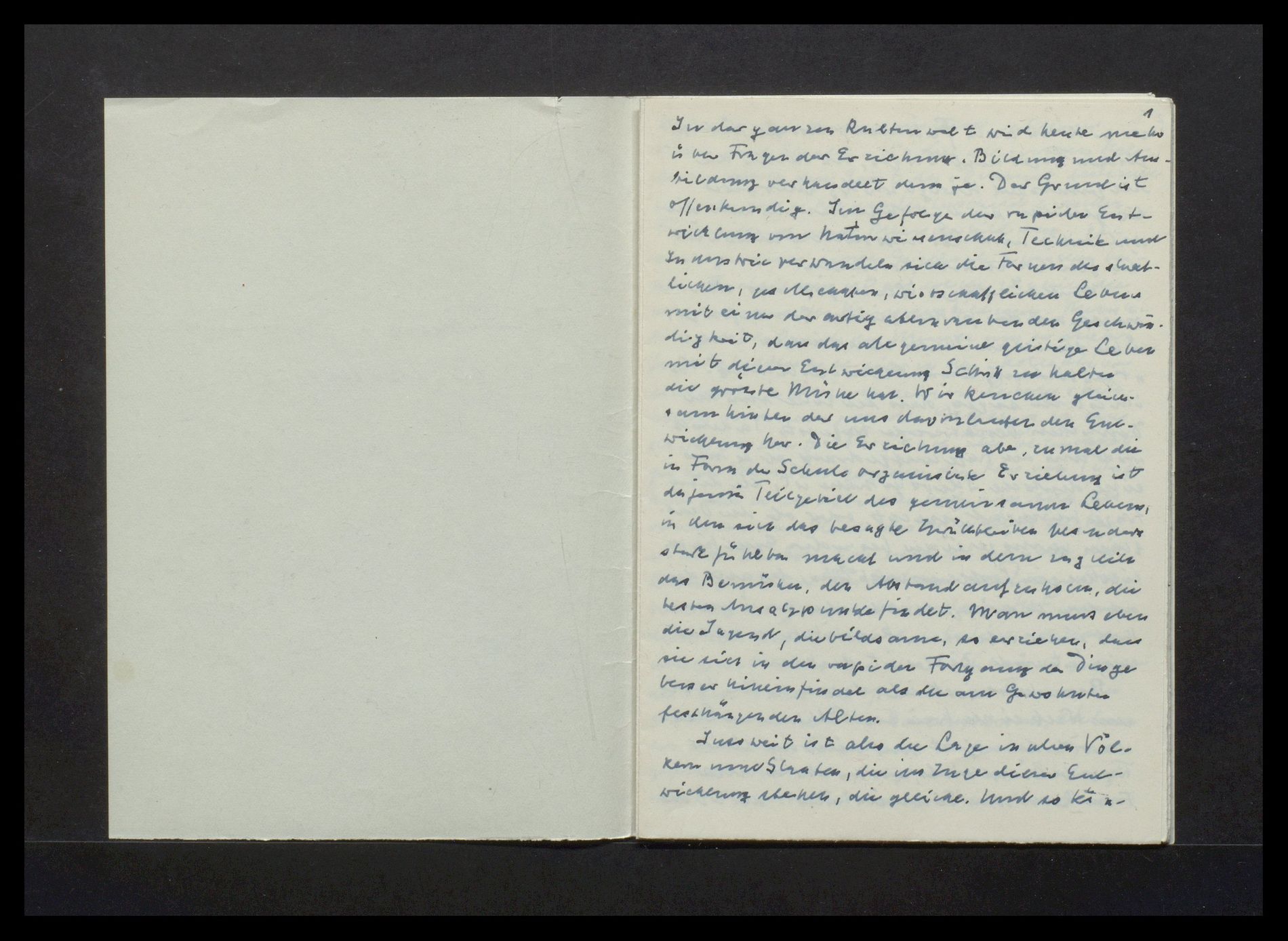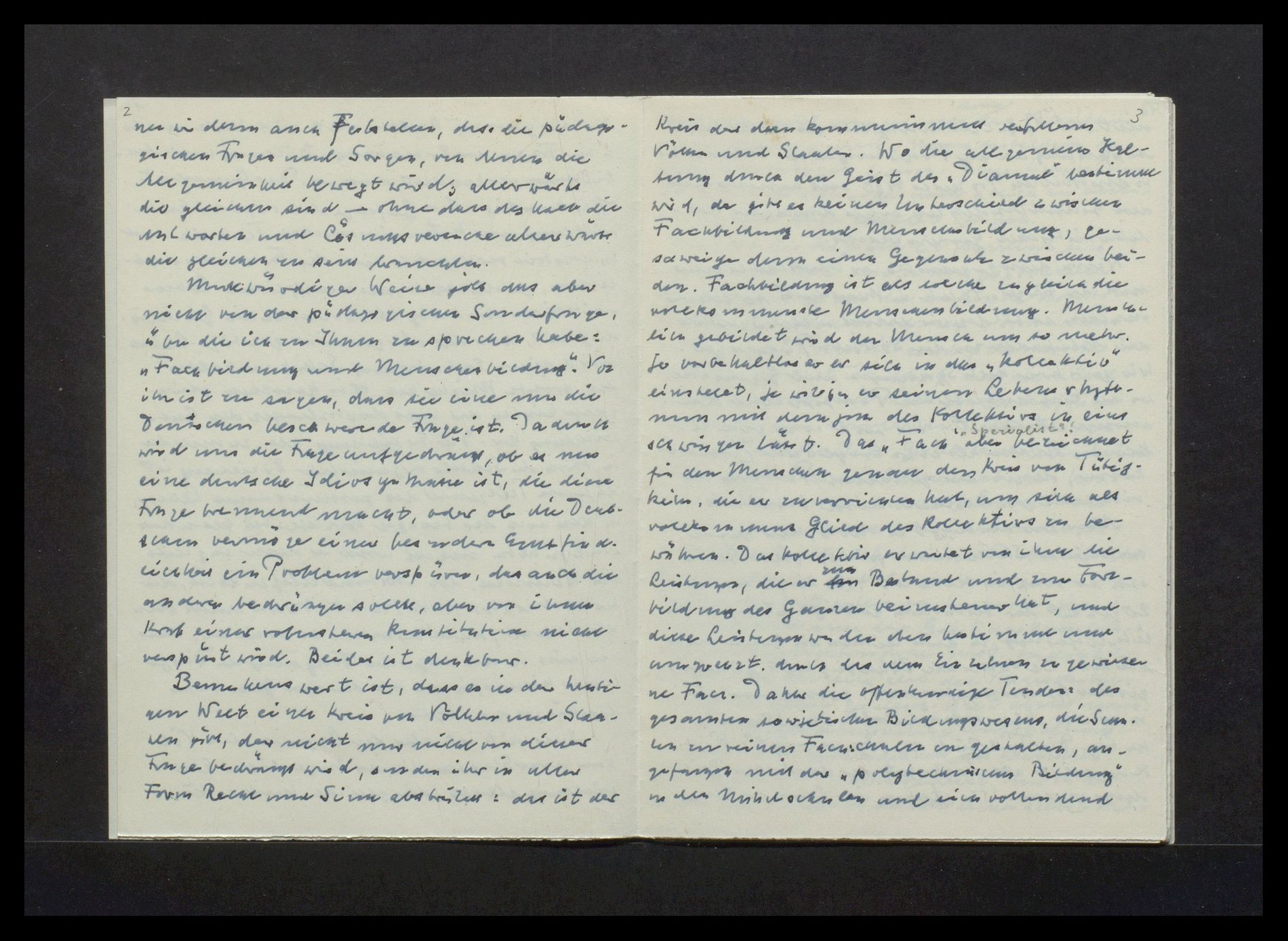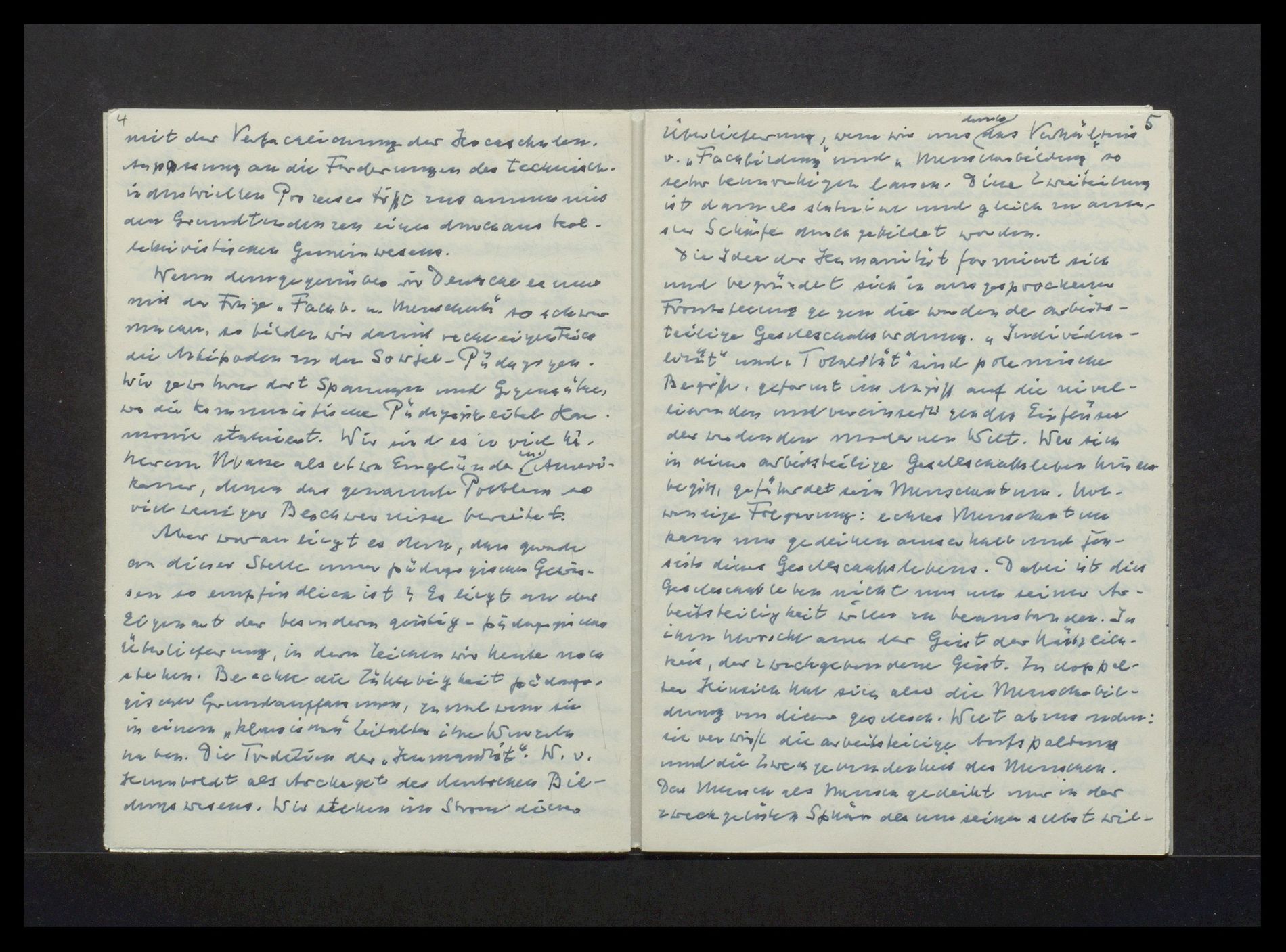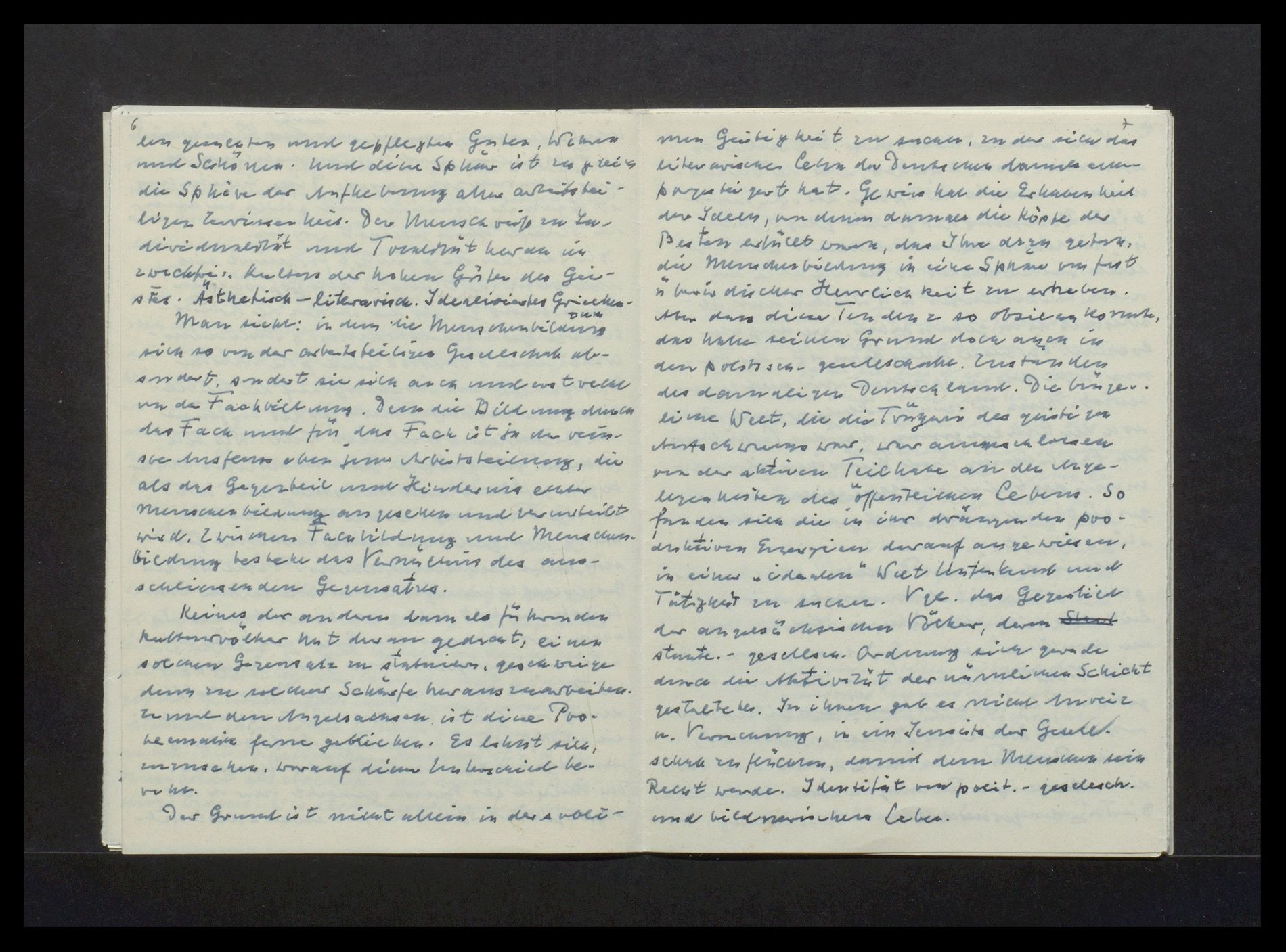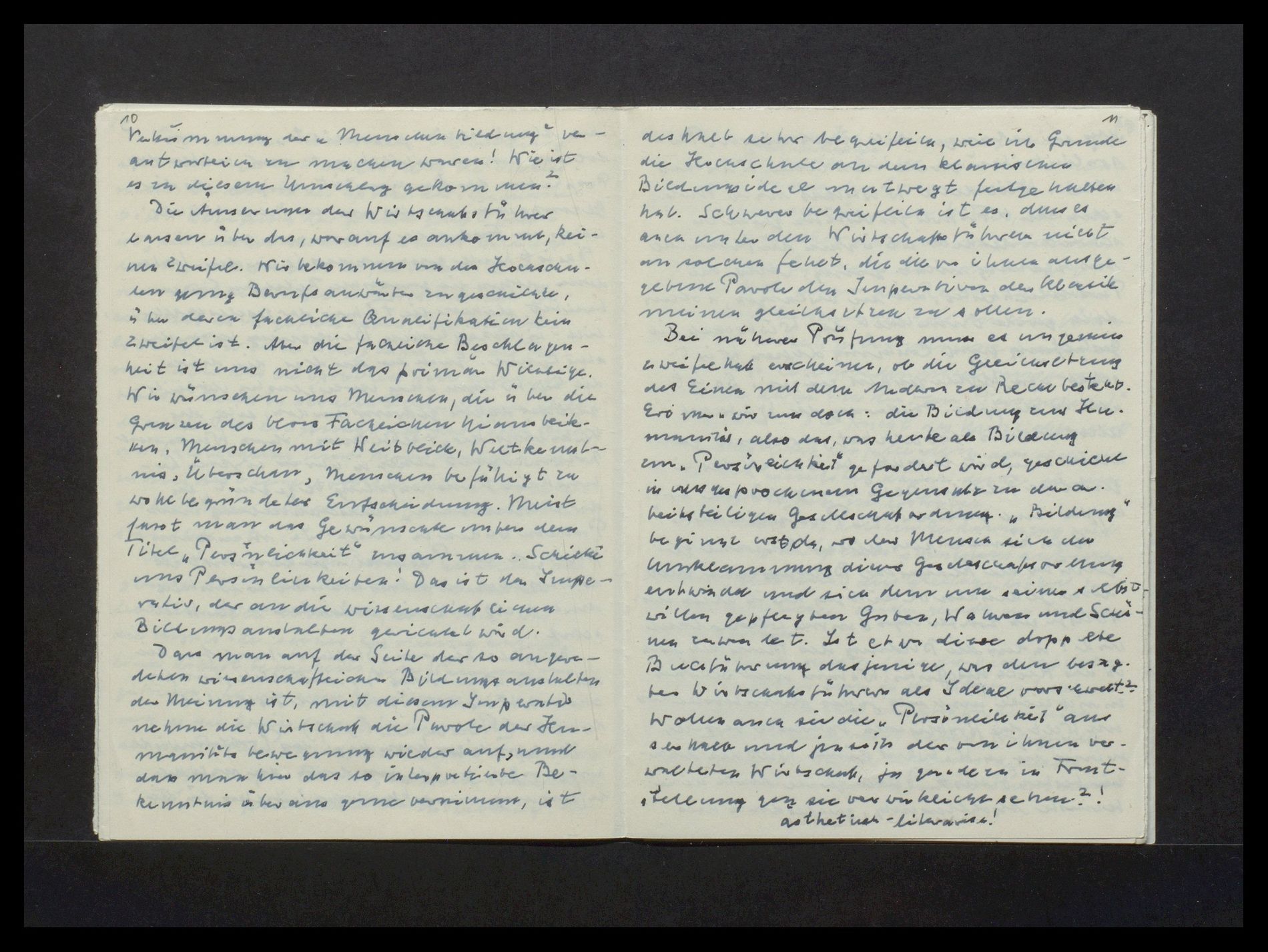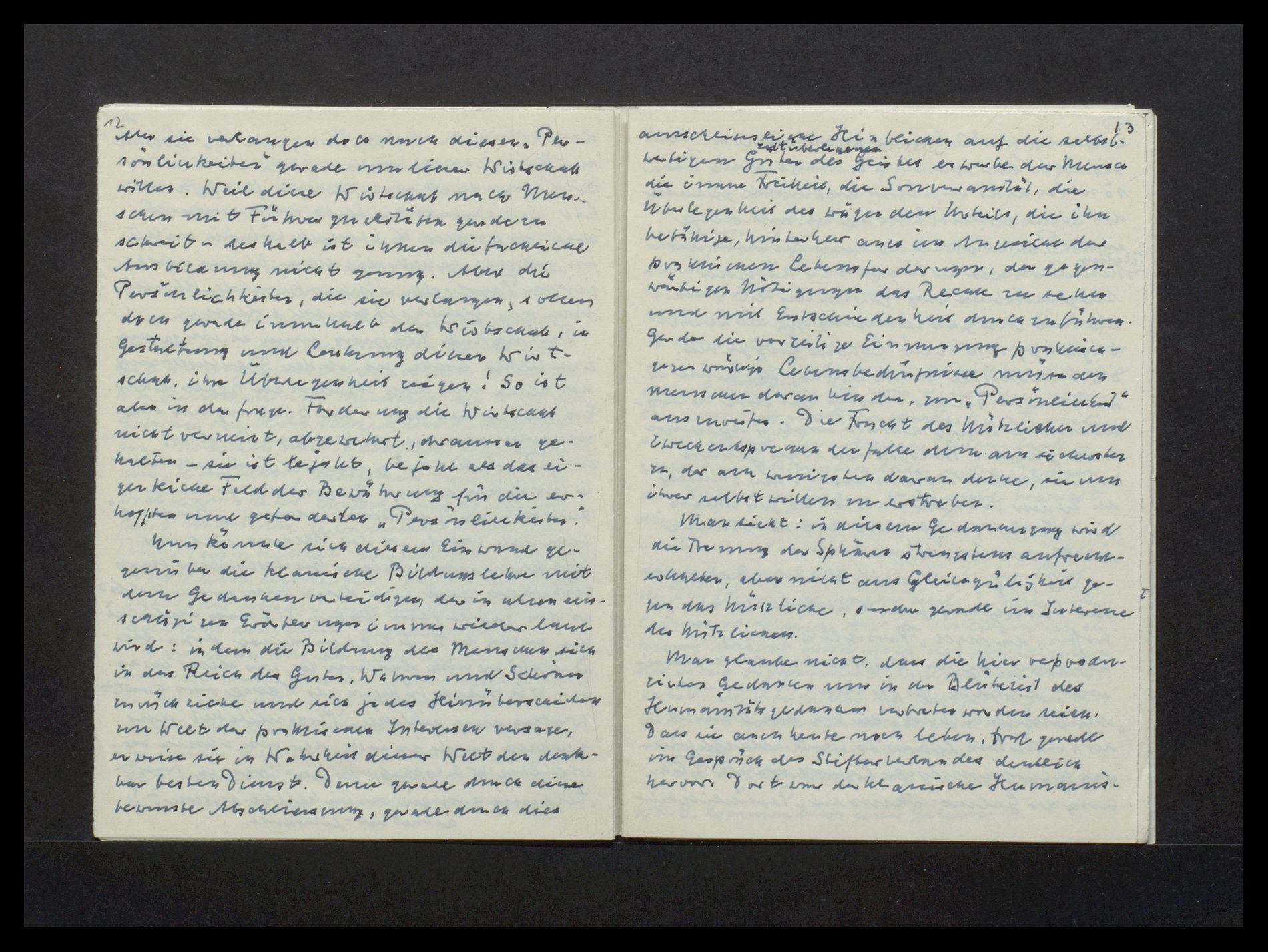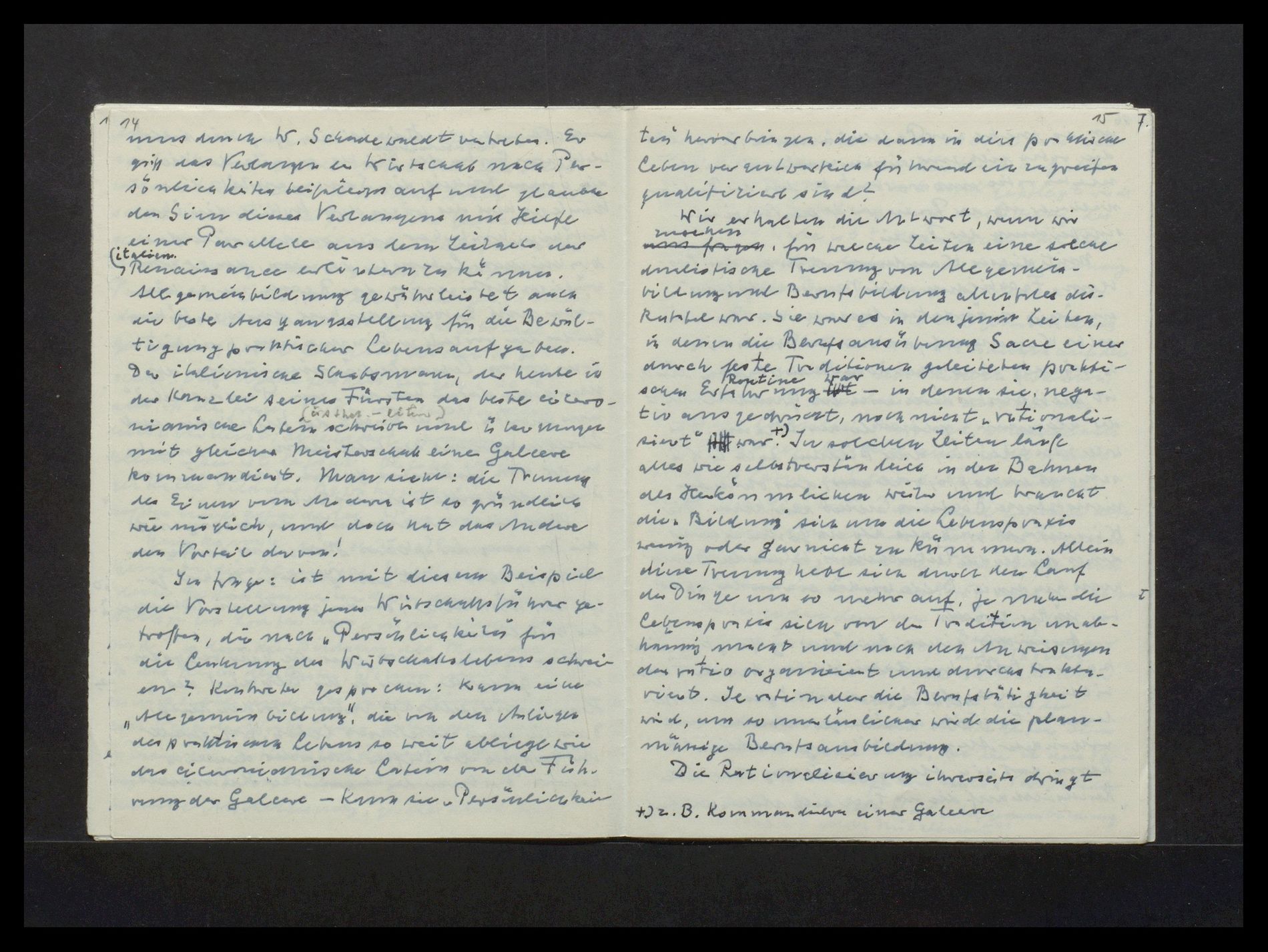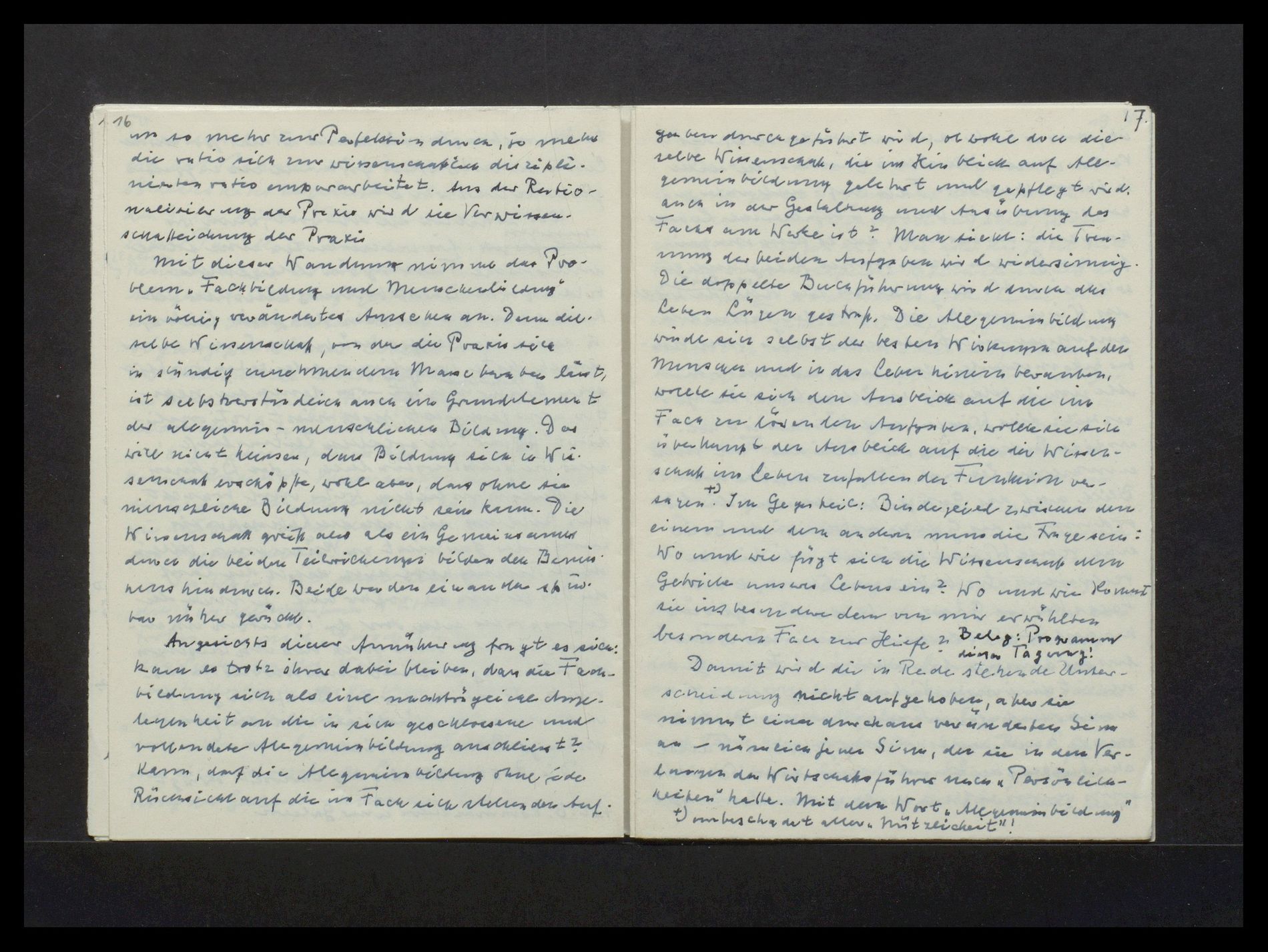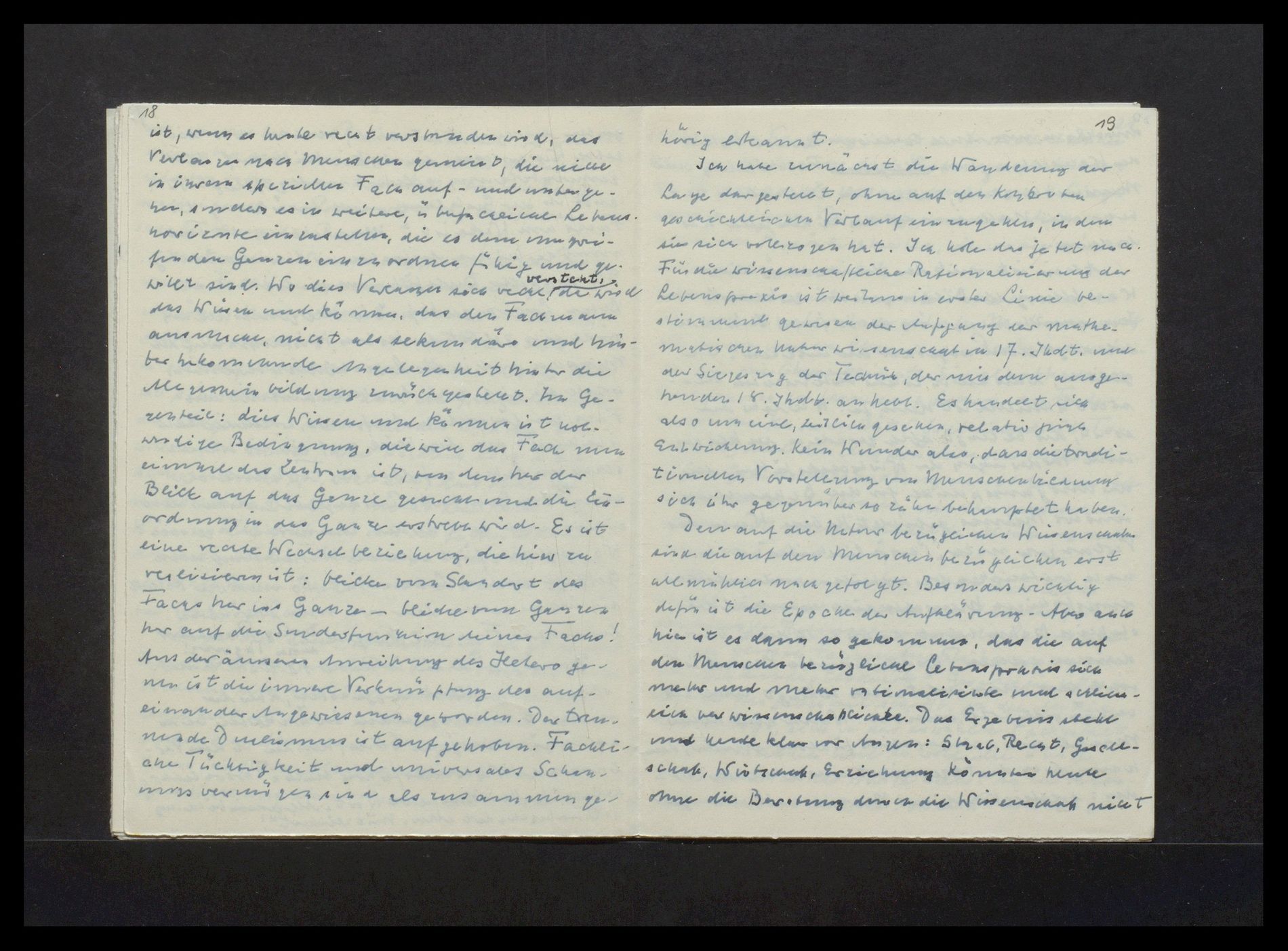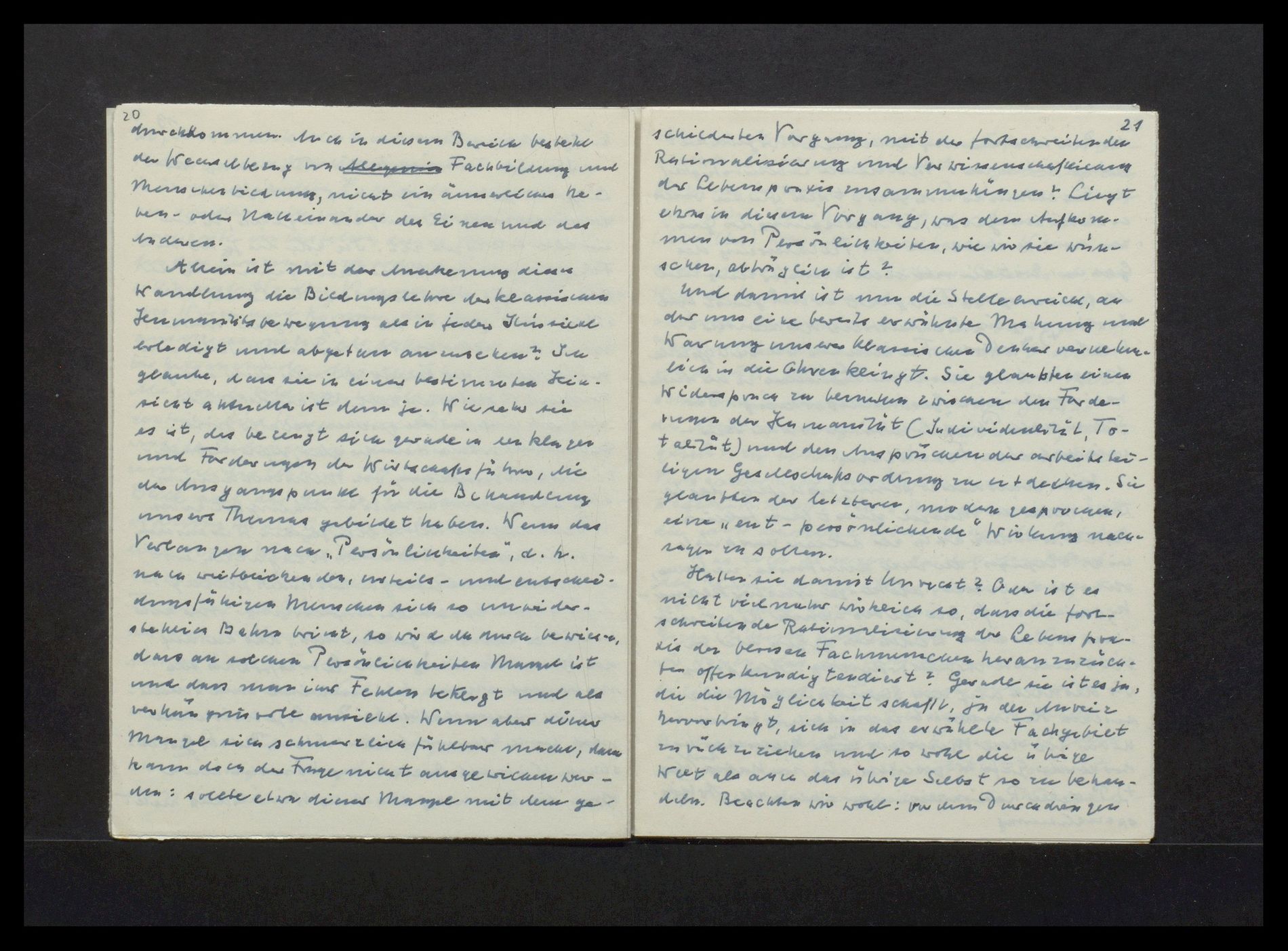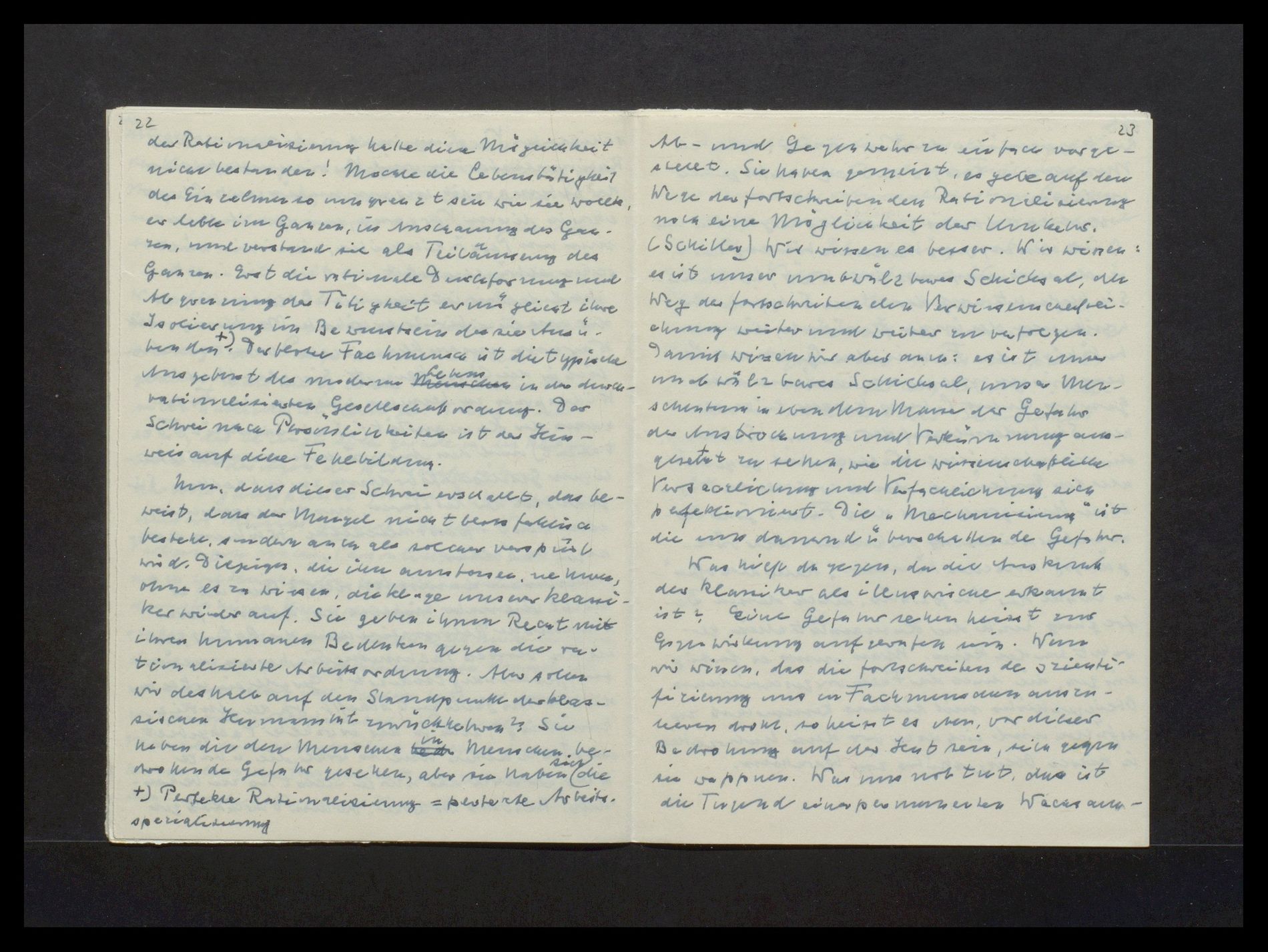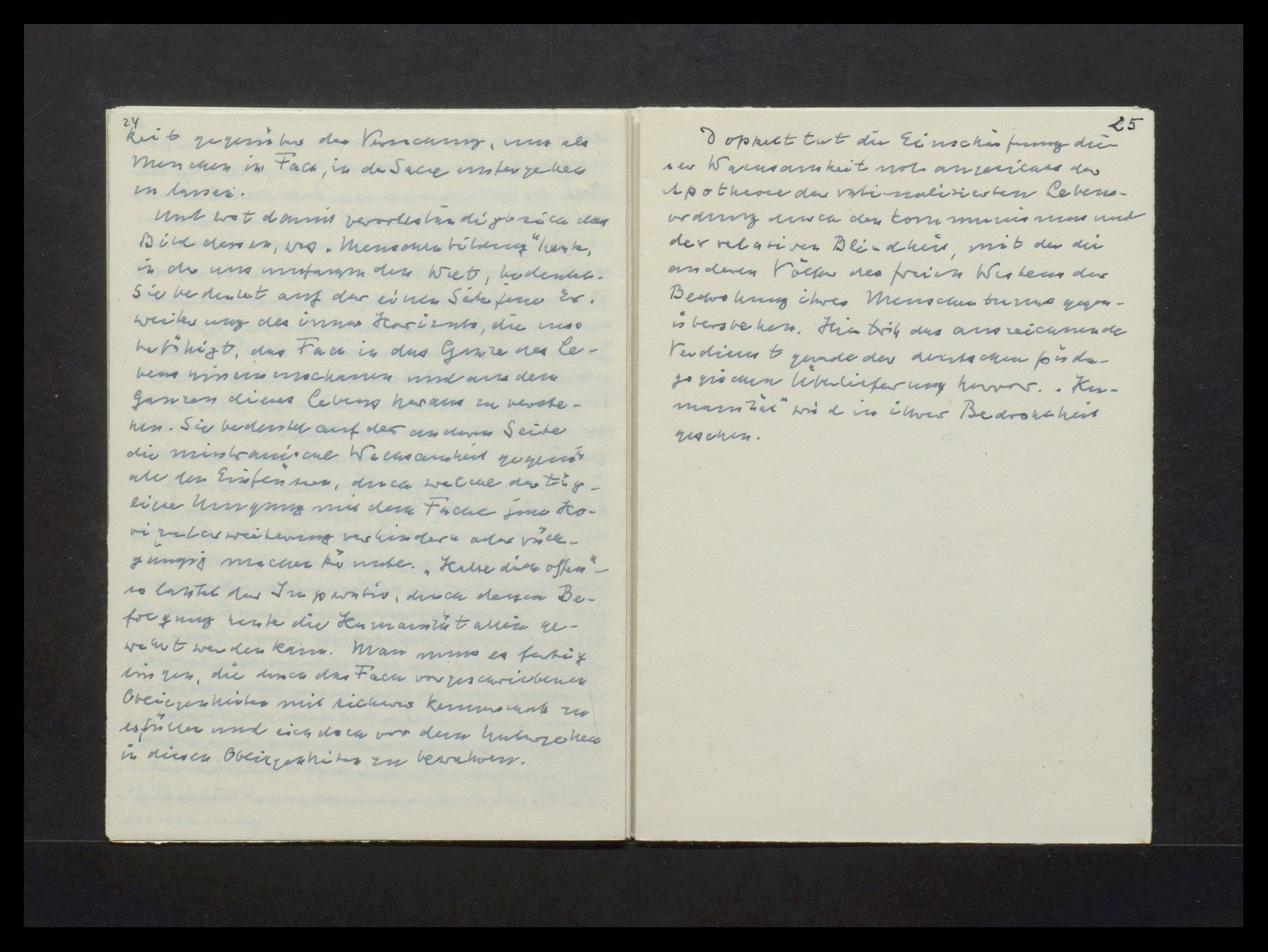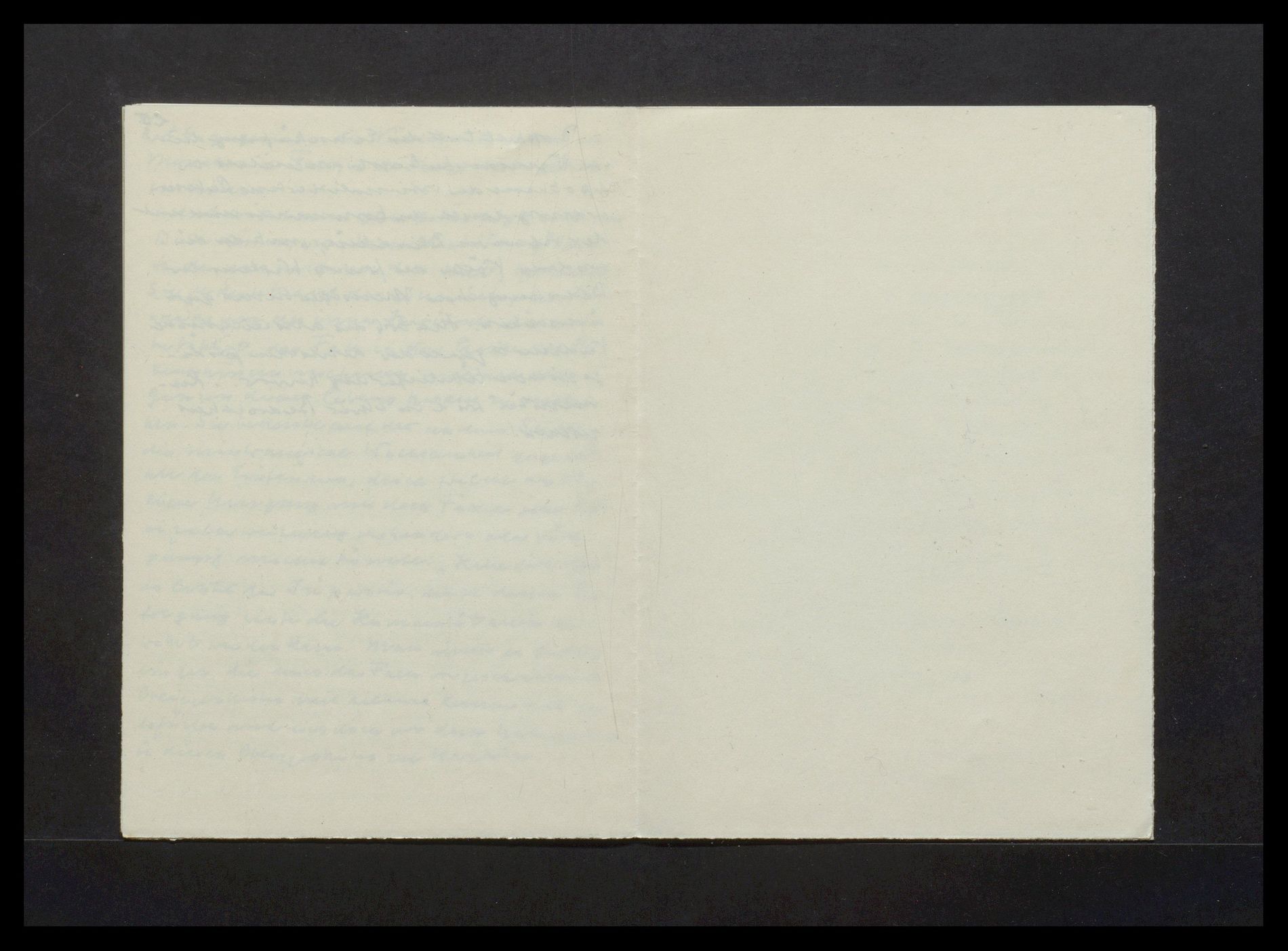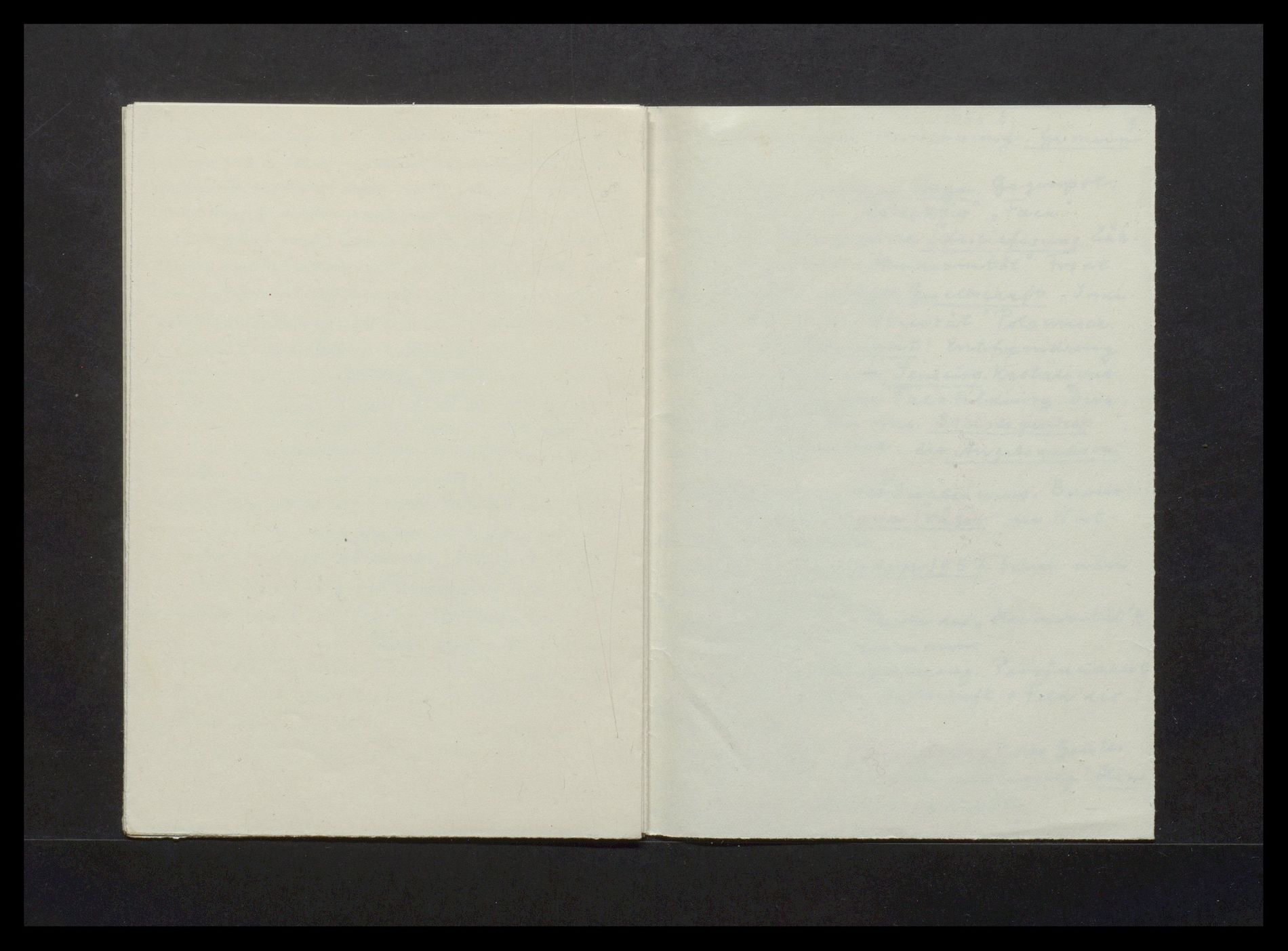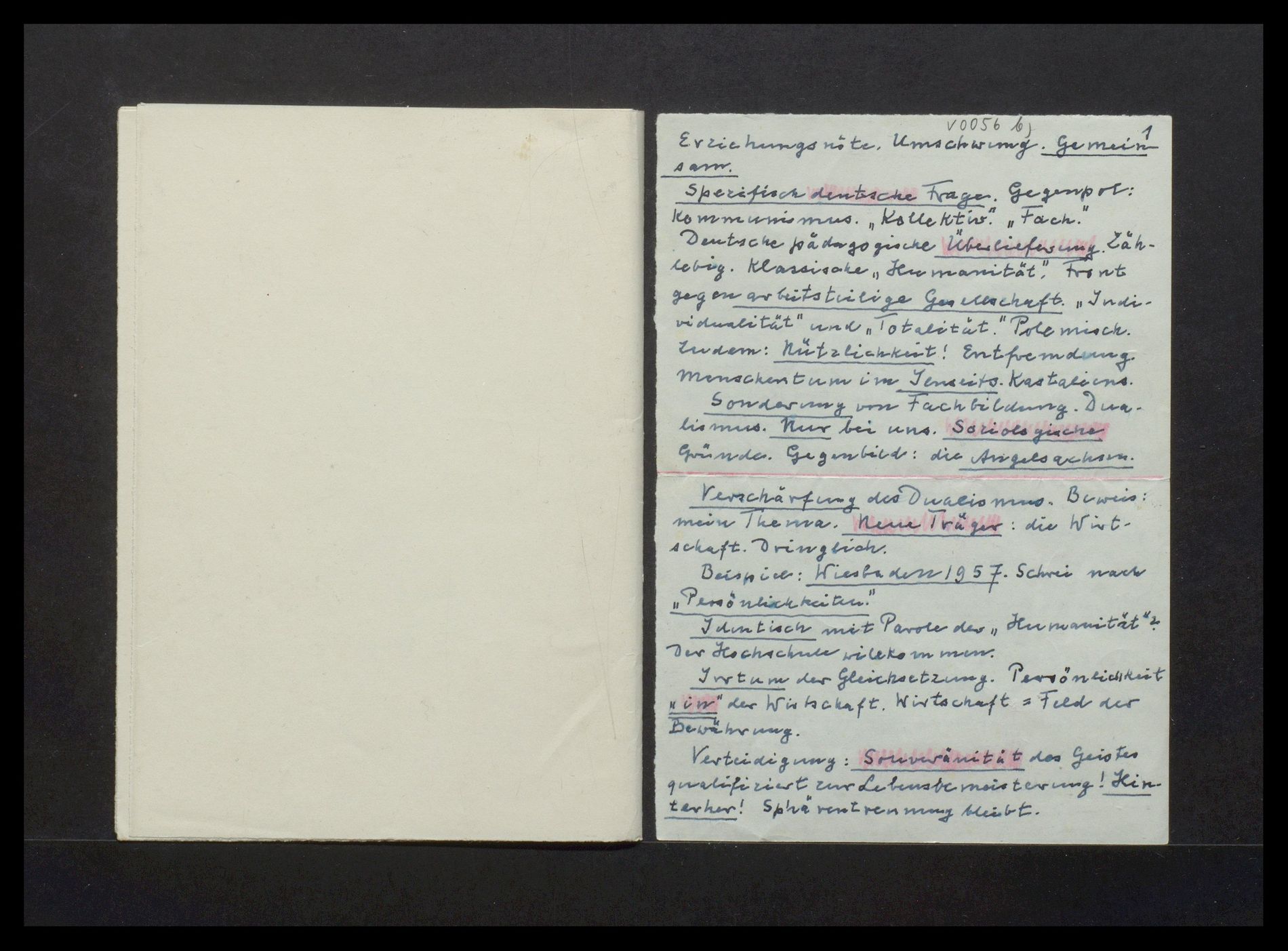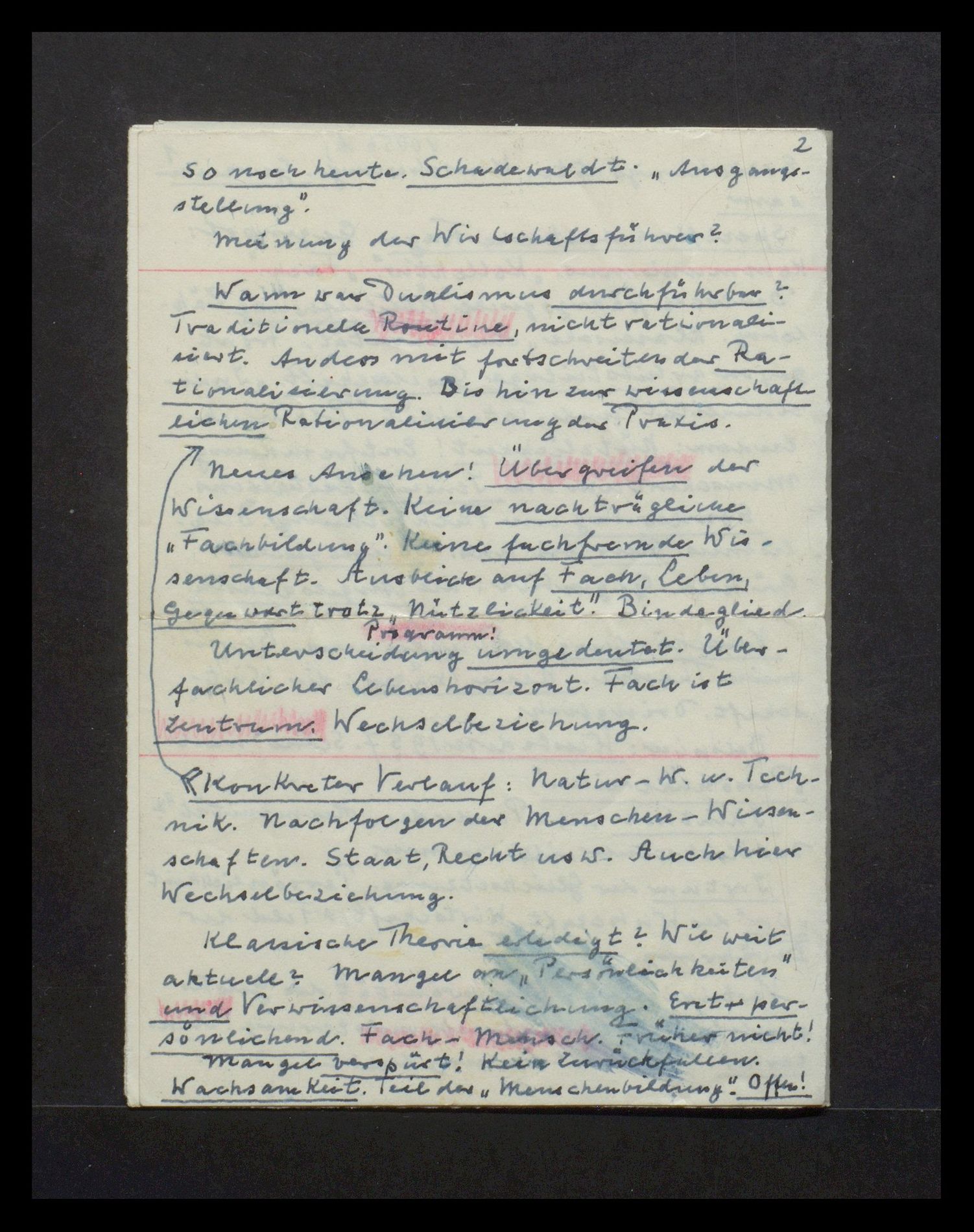| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0056a
Titelblatt
Fachbildung u. Menschenbildung
(Bad Soden 1958)
1
In der ganzen Kulturwelt wird heute mehr
über Fragen der Erziehung, Bildung und Aus-
bildung verhandelt denn je. Der Grund ist
offenkundig. Im Gefolge der rapiden Ent-
wicklung von Naturwissenschaft, Technik und
Industrie verwandeln sich die Formen des staat-
lichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Lebens
mit einer derartig atemberaubenden Geschwin-
digekeit, dass das allgemeine geistige Leben
mit dieser Entwicklung Schritt zu halten
die grösste Mühe hat. Wir klucken gleich-
sam hinter der uns davonlaufenden Ent-
wicklung her. Die Erziehung aber, zumal die
in Form der Schule organisierte Erziehung ist
dasjenige Teilgebiet des gemeinsamen Lebens,
in dem sich das besagte Zurückbleiben besonders
stark fühlbar macht und in dem zugleich
das Bemühen, den Abstand aufzuholen, die
besten Ansatzpunkte findet. Man muss eben
die Jugend, die bildsame, so erziehen, dass
sie sich in den rapiden Fortgang der Dinge
besser hineinfindet als die am Gewohnten
festhängenden Alten.
Insoweit ist also die Lage in allen Völ-
kern und Staaten, die im Zuge dieser Ent-
wicklung stehen, die gleiche. Und so kön-
2
nen wir denn auch feststellen, dass die pädago-
gischen Fragen und Sorgen, von denen die
Allgemeinheit bewegt wird, allerwärts
die gleichen sind – ohne dass deshalb die
Antworten und Lösungsversuche allerwärts
die gleichen sein brauchten.
Merkwürdiger Weise gilt das aber
nicht von der pädagogischen Sonderfrage,
über die ich zu Ihnen zu sprechen habe:
„Fachbildung und Menschenbildung“. Von
ihr ist zu sagen, dass sie eine nur die
Deutschen beschwerende Frage ist. Dadurch
wird uns die Frage aufgedrängt, ob es nur
eine deutsche Idiosynkrasie ist, die diese
Frage brennend macht, oder ob die Deut-
schen ver,öge einer besonderen Empfind-
lichkeit ein Problem verspüren, das auch die
anderen bedrängen sollte, aber vor ihnen
Kraft einer robusteren Konstitution nicht
verspürt wird. Beides ist denkbar.
Bemerkenswert ist, dass es in der heuti-
gen Welt einen Kreis von Völkern und Staa-
ten gibt, der nicht nur nicht von dieser
Frage bedrängt wird, sondern ihr in aller
Form Recht und Sinn abstreitet: das ist der
3
Kreis der dem kommunismus verfallenen
Völker und Staaten. Wo die allgemeine Hal-
tung durch den Geist des „Diamat“ bestimmt
wird, da gibt es keinen Unterschied zwischen
Fachbildung und Menschenbildung, ge-
schweige denn einen Gegensatz zwischen bei-
den. Fachbildung ist als solche zugleich die
vollkommenste Menschenbildung. Mensch-
lich gebildet wird der Mensch um so mehr,
je vorbehaltloser er sich in das „Kollektiv“
einstellt, je williger er seinen Lebensrhyt-
mus mit demjenigen des Kollektivs in eins
„Spezialist“?
schwingen lässt. Das „Fach“ aber bezeichnet
für den Menschen genau den Kreis von Tätig-
keiten, die er zu verrichten hat, um sich als
vollkommenes Glied des Kollektivs zu be-
währen. Das Kollektiv erwartet von ihm die
Leistungen, die er zum Bestand und zur Fort-
bildung des Ganzen beizusteuern hat, und
diese Leistungen werden eben bestimmt und
umgrenzt, durch das dem Einzelnen zugewiese-
ne Fach. Daher die offenkundige Tendenz des
gesamten sowjetischen Bildungswesens, die Schu-
len zu reinen Fachschulen zu gestalten, an-
gefangen mit der „polytechnischen Bildung“
in den Mittelschulen und sich vollendend
4
mit der Verfachlichung der Hochschulen.
Anpassung an die Forderungen des technisch-
industriellen Processes trifft zusammen mit
den Grundtendenzen eines durchaus kol-
lektivistischen Gemeinwesens.
Wenn demgegenüber wir Deutschen es uns
mit der Frage „Fachb. u. Menschenb.“ so schwer
machen, so bilden wir damit recht eigentlich
die Antipoden zu den Sowjet-Pädagogen.
Wir gewahren dort Spannungen und Gegensätze,
wo die kommunistische Pädagogik eitel Har-
monie statuiert. Wir sind es in viel hö-
herem Masse als etwa Engländer u. Ameri-
kaner, denen das genannte Problem so
viel weniger Beschwernisse bereitet.
Aber woran liegt es denn, dass gerade
an dieser Stelle unser pädagogisches Gewis-
sen so empfindlich ist? Es liegt an der
Eigenart der besonderen geistig-pädagogischen
Überlieferung, in deren Zeichen wir heute noch
stehen. Beachte die Zählebigkeit pädago-
gischer Grundauffassungen, zumal wenn sie
in einem „klassischen“ Zeitalter ihre Wurzeln
haben. Die Tradition der „Humanität“. W. v.
Humboldt als Archeget des deutschen Bil-
dungswesens. Wir stehen im Strom dieser
5
Überlieferung, wenn wir uns durch das Verhältnis
v. „Fachbildung“ und „Menschenbildung“ so
sehr beunruhigen lassen. Diese Zweiteilung
ist damals statuiert und gleich zu äusser-
ster Schärfe auch gebildet worden.
Die Idee der Humanität formiert sich
und begründet sich in ausgesprochener
Frontstellung gegen die werdende arbeits-
teilige Gesellschaftsordnung. „Individua-
lität“ und „Totalität“ sind polemische
Begriffe, geformt im Angriff auf die nivel-
lierenden und einflüsse
der werdenden modernen Welt. Wer sich
in dieses arbeitsteilige Gesellschaftsleben hinein-
begibt, gefährdet sein Menschentum. Not-
wendige Folgerung: echtes Menschentum
kann nur gedeihen ausserhalb und jen-
seits dieses Gesellschaftslebens. Dabei ist dies
Gesellschaftsleben nicht nur um seiner Ar-
beitsteiligkeit willen zu beanstanden. In
ihm herrscht auch der Geist der Nützlich-
keit, der zweckgebundene Geist. In doppel-
ter Hinsicht hat sich also die Menschenbil-
dung von dieser gesellsch. Welt abzusondern:
sie verwirft die arbeitsteilige Aufspaltung
und die Zweckgebundenheit des Menschen.
Der Mensch als Mensch gedeiht nur in der
zweckgelösten Sphäre als um seiner selbst wil-
6
len und gepflegten Guten, Wahren
und Schönen. Und diese Sphäre ist zugleich
die Sphäre der Aufhebung aller arbeitstei-
ligen Zerrissenheit. Der Mensch reift zu In-
dividualität und Totalität heran im
zweckfreien Kultus der hohen Güter des Gei-
stes. Ästhetisch-literarisch. Idealisiertes Griechen-
tum.
Man sieht: in dem die Menschenbildung
sich so von der arbeitsteiligen Gesellschaft ab-
sondert, sondert sie sich auch und erst recht
von der Fachbildung. Denn die Bildung durch
das Fach und für das Fach ist ja der rein-
ste Ausfluss eben jener Arbeitsteilung, die
als das Gegenteil und Hindernis echter
Menschenbildung angesehen und verurteilt
wird. Zwischen Fachbildung und Menschen-
bildung besteht das Verhältnis des aus-
schliessenden Gegensatzes.
Keines der anderen als führenden
Kulturvölker hat daran gedacht, einen
solchen Gegensatz zu statuieren, geschweige
denn zu solcher Schärfe herauszuarbeiten.
Zumal den Angelsachsen ist diese Pro-
blematik ferne geblieben. Es lohnt sich,
zuzusehen, worauf dieser Unterschied be-
ruht.
Der Grund ist nicht allein in der subli-
7
men Geistigekeit zu suchen, zu der sich das
literarische Leben der Deutschen damals em-
porgesteigert hat. Gewiss hat die Erhabenheit
der Ideen, von denen damals die Köpfe der
Besten erfüllt waren, das Ihre dazu getan,
die Menschenbildung in eine Sphäre von fast
überirdischer Herrlichkeit zu erheben.
Aber dass diese Tendenz so obsiegen konnte,
das hatte seinen Grund doch auch in
den politisch-gesellschaftl. Zuständen
des damaligen Deutschland. Die bürger-
liche Welt, die die Trägerin des geistigen
Aufschwungswar, war ausgeschlossen
von der aktiven Teilhabe an den Ange-
legenheiten des öffentlichen Lebens. So
fanden sich die in ihr drängenden pro-
duktiven Energien darauf angewiesen,
in einer „idealen“ welt Unterkunft und
Tätigkeit zu suchen. Vgl. das Gegenbild
der angelsächsischen Völker, deren Staat
staatl.-gesellsch. Ordnung sich gerade
durch die Aktivität der nämlichen Schicht
gestalteten. In ihnen gab es nicht Anreiz
u. Versuchung, in ein Jenseits derGesell-
schaft zu flüchten, damit dem Menschen sein
Recht werde. Identität von polit.-gesellsch.
und bildnerischem Leben.
8
Von unserer deutschen Entwicklung
aber muss gesagt werden, das der Dualis-
mus, zu dem in der Epoche der „Humani-
täts“-Bewegung der Grund gelegt worden
ist, seit dem nicht aus unserem Bildungs-
leben verschwunden ist, so viel auch die
rechten Entwicklungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft dazu getan haben, ihn aufzu-
lockern. Der beste Beleg dafür ist – das The-
ma, über das zu sprechen mir aufgege-
ben ist. Denn in seinem Hindergrunde steht
soch die Überzeugung, das das Verhältnis
von Fachbildung und Menschenbildung –
zumindest eine problematische Angele-
genheit und nichts weniger als selbstver-
ständlich ist.
Allein obwohl das Problem als solches das
gleiche ist, mit dem ausserklassiscehn
Zeitalter sich abmühen, so ist doch, was
die Umstände seiner erörterung angeht,
eine höchst bemerkenswerte Wendung ein-
getreten. In unserem klassischen Zeitalter wa-
ren es die Kreise der „Dichter und Denker“,
die das Problem sahen, durchdachten und durch
die aufgezeigte Trennung zu lösen versuchten.
Die Träger der geschichtlichen Entwicklung, die
9
ihre Abwehraktion provozierte, waren von
solchen Sorgen unbeschwert und galten den
Propheten der Humanität in sofern als die
Gegenpartei, der das um der Menschlichkeit
willen zu Fordernde abzuringen sei.
Das ist heute ganz anders geworden. Unter
denen, denen die Relation Sorgen
bereitet, stehen die Führer der geschicht-
lich-wissenschaftlichen Bewegung in vorder-
ster Linie. Gerade sie sind es, die durch
die Erfahrungen ihres ureigensten Arbeits-
gebietes dahin gedrängt werden, sich das
Verhältnis der „Fachbildung“, deren Wesen und
Notwendigkeit ihnen in ihren eigensten Le-
benskreise tausendfältig begegnet zu
der allgemeinen „Menschenbildung“ zum
Problem werden zu lassen. Ja, man kann
fragen, ob dies Problem irgendwo sonst als
so dringlich empfunden und so ernstlich
durchdacht wird wie in den Kreisen der Wirt-
schaft.
Beispiel: die vom „Stifterverband für die
deutsche Wissenschaft“ veranstaltete Ausspra-
che von Wirtschaftsführern und Hochschul-
lehrern. (Wiesbaden 1957)
Merkwürdiger Umschlag: das Problem wird
aufgegriffen gerade von denen, die nach der
Auffassung unseres klassischen Zeitalters für die
10
Verkümmerung der „Menschenbildung“ ver-
antwortlich zu machen waren! Wie ist
es zu diesem Umschlag gekommen?
Die Äusserungen der Wirtschaftsführer
lassen über das, worauf es ankommt, kei-
nen Zweifel. Wir bekommen von den Hochschu-
len genug Berufsanwärter zugeschickt,
über deren fachliche Qualifikation kein
Zweifel ist. Aber die fachliche Beschlagen-
heit ist uns nicht das primär Wichtige.
Wir wünschen uns Menschen, die über die
Grenzen des bloss Fachlichen jinaus blik-
ken, Menschen mit Weitblick, Weltkennt-
nis, Überschau, Menschen befähigt zu
wohlbegründeter Entscheidung. Meist
fasst man das Gewünschte unter dem
Titel „Persönlichkeit“ zusammen. Schicke
uns Persönlichkeiten! das ist der Impe-
rativ, der an die wissenschaftlichen
Bildungsanstalten gerichtet wird.
Dass man auf der Seite der so angere-
deten wissenschaftlichen Bildungsanstalten
der Meinung ist, mit diesem Imperativ
nehme die Wirtschaft die Parole der Hu-
maitätsbewegung wieder auf, und
dass man hier das so interpretierte Be-
kenntnis überaus gerne vernimmt, ist
11
deshalb sehr begreiflich, weil im Grunde
die Hochschule an dem klassischen
Bildungsideal unentwegt festgehalten
hat. Schwerer begreiflich ist es, dass es
auch unter den Wirtschaftsführern nicht
an solchen fehlt, die die von ihnen ausge-
gebene Parole den Imperativen dr Klassik
meinen gleichsetzen zu sollen.
Bei näherer Prüfung muss es ungemein
zweifelhaft erscheinen, ob die Gleichsetzung
des Einen mit dem Anderen zu Recht besteht.
Erinnern wir uns doch: die Bildung zur Hu-
manität, also das, was heute als Bildung
zur „Persönlichkeit“ gefordert wird, geschieht
in ausgesprochenem Gegensatz zu der ar-
beitsteiligen Gesellschaftsordnung. „Bildung“
beginnt erst da, wo der Mensch sich der
Umklammerung dieser Gesellschaftsordnung
entschwindet und sich dem um seiner selbst
willen gepflegten Gaben, Wahren und Schö-
nen zuwendet. Ist etwa diese doppelte
Buchführung dasjenige, was den besag-
tenWirtschaftsführern als Ideal vorschwebt?
Wollen auch sie die „Persönlichkeit“ aus-
serhalb und jenseits der von ihnen ver-
walteten Wirtschaft, ja geradezu in Front-
stellung gegen sie verwirklicht sehen?!
ästhetisch-literarisch!
12
Aber sie verlangen doch nach diesen „Per-
sönlichkeiten“ gerade um dieser Wirtschaft
willen. Weil diese Wirtschaft nach Men-
schen mit Führerqualitäten geradezu
schreit – deshalb ist ihnen die fachliche
Ausbildung nicht genug. Aber die
Persönlichkeiten, die sie verlangen, sollen
doch gerade innerhalb der Wirtschaft, in
Gestaltung und Lenkung dieser Wirt-
schaft, ihre Überlegenheit zeigen! So ist
also in der fragl. Forderung die Wirtschaft
nicht verneint, abgewehrt, draussen ge-
halten – sie ist bejaht, bejaht als das ei-
gentliche feld der Beweährung für die er-
hofften und geforderten „Persönlichkeiten“.
Nun könnte sich diesem Einwand ge-
genüber die klassische Bildungslehre mit
dem Gedanken verteidigen, der in allen ein-
schlägigen Erörterungen immer wieder laut
wird: indem die Bildung des Menschen sich
in das Reich des Guten, Wahren und Schönen
zurückziehe und sich jedes Hinüberschielen
zur Welt der praktischen Interessen versage,
erweist sie in Wahrheit dieser Welt den denk-
bar besten Dienst. Denn gerade durch diese
bewusste Abschliessung, gerade durch dies
13
ausschliessliche Hinblicken auf die selbst-
zeitüberlegenen
wertigen Güter des Geistes erwarbe der Mensch
die innere Freiheit, die Souveränität, die
Überlegenheit des wägenden Urteils, die ihn
befähige, hinterher auch im Angesicht der
praktischen Lebensforderungen, der gegen-
wärtigen Nötigungen das rechte zu sehen
und mit Entschiedenheit durchzuführen.
Gerade die vorzeitige Einmengung praktisch-
gegenwärtiger Lebensbedürfnisse müssen den
Menschen daran hindern, zur „Persönlichkeit“
auszureifen. Die Frucht des Nützlichen und
Zweckentsprechenden falle dem am sichersten
zu, der am wenigsten daran denke, sie um
ihrer selbst willen zu erstreben.
Man sieht: in diesem Gedankengang wird
die Trennung der Sphären strengstens aufrecht-
erhalten, aber nicht aus Gleichgültigkeit ge-
gen das Nützliche, sondern gerade im Interesse
des Nützlichen.
Man glaube nicht, dass die hier reprodu-
zierten Gedanken nur in der Blütezeit des
Humanitätsgedankens vertreten worden seien.
Dass sie auch heute noch leben, trat gerade
im Gespräch des Stifterverbandes deutlich
hervor. Dort war der klassische Humanis-
14
mus durch W. Schadewaldt vertreten. Er
griff das Verlangen der Wirtschaft nach Per-
sönlichkeiten beifälligst auf und glaubte
den Sinn dieses Verlangens mit Hilfe
einer Parallele aus dem zeitalter der
italien. Renaissance erläutern zu können.
Allgemeinbildung gewährleistet auch
die beste Ausgangsstellung für die Bewäl-
tigung praktischer Lebensaufgaben.
Der italienische Staatmann, der heute in
der Kanzlei seines Fürsten das beste cicero-
(ästhet.-literar.)
nianische Latein schreibt und übermorgen
mit gleicher Meisterschaft eine Galeere
kommandiert. Man sieht: die Trennung
des Einen vom Anderen ist so gründlich
wie möglich, und doch hat das Andere
den Vorteil davon!
Ich frage: ist mit diesem Beispiel
die Vorstellung jener Wirtschaftsführer ge-
troffen, die nach „Persönlichkeiten“ für
die Lenkung des Wirtschaftslebens schrei-
en? Konkreter gesprochen: kann eine
„Allgemeinbildung“, die von den Anliegen
des praktischen Lebens so weit abliegt wie
das literarische Latein von der Füh-
rung der Galeere – kann sie „Persönlichkei-
15
ten“ hervorbringen, die dann in dies praktische
Leben verantwortlich führend einzugreifen
qualifiziert sind?
Wir erhalten die antwort, wenn wir
ansehen
uns fragen, für welche Zeiten eine solche
dualistische Trennung von Allgemein-
bildung und Berufsbildung allenfalls dis-
kutabel war. Sie war es in denjenigen Zeiten,
in denen die Berufsausübung Sache einer
durch feste Traditionen geleiteten prakti-
Routine
schen Erfahrung war – in denen sie, nega-
tiv ausgedrückt, noch nicht „rationali-
siert“ war. +) In solchen Zeiten läuft
alles wie selbstverständlich in den Bahnen
des Herkömmlichen weiter und braucht
die „Bildung“ sich um die Lebenspraxis
wenig odr gar nicht zu kümmern. Allein
diese Trennung hebt sich durch den Lauf
der Dinge um so mehr auf, je mehr die
Lebenspraxis sich von der Tradition unab-
hängig macht und nach den Anweisungen
der ratio organisiert und durchstruktu-
riert. Je rationaler die Berufstätigkeit
wird, um so unerlässlicher wird die plan-
mässige Berufsausbildung.
Die Rationalisierung ihrerseits dringt
+) z.B. kommandieren einer Galeere
16
um so mehr zur Perfektion durch, je mehr
die ratio sich zur wissenschaftlich diszipli-
nierten ratio emporarbeitet. Aus der Ratio-
nalisierung der Praxis wird die Verwissen-
schaftlichung der Praxis.
Mit dieser Wandlung nimmt das Pro-
blem „Fachbildung und Menschenbildung“
ein völlig verändertes, von der die Praxis sich
in ständig zunehmendem Masse berauben lässt,
ist selbstverständlich auch ein Grundelement
der allgemein-menschlichen Bildung. Das
will nicht heissen, dass Bildung sich in Wis-
senschaft erschöpfte, wohl aber, dass ohne sie
menschliche Bildung nicht sein kann. Die
Wissenschaft greift also als ein Gemeinsames
durch die beiden Teilrichtungen bilden den Bemü-
hens hindurch. Beide werden einander spür-
bar näher gerückt.
Angesichts dieser Annäherung fragt es sich:
kann es trotz ihrer dabei bleiben, dass die Fach-
bildung sich als eine nachträgliche Ange-
legenheit an die in sich geschlossene und
vollendete Allgemeinbildung anschliesst?
Kann, darf die Allgemeinbildung ohne jede
Rücksicht auf die im Fach sich stelenden Auf-
17
gaben durchgeführt wird, obwohl doch die-
selbe Wissenschaft, die im Hinblick auf All-
gemeinbildung gelehrt und gepflegt wird,
auch in der Gestaltung und Ausübung des
Fachs am Werke ist? Man sieht: die Tren-
nung der beiden Aufgaben wird widersinning.
Die doppelte Buchführung wird durch das
Leben Lügen gestraft. Die Allgemeinbildung
würde sich selbst der besten Wirkungen auf den
Menschen und in das Leben hinein berauben,
wollte sie sich den Ausblick auf die im
Fach zu lösenden Aufgaben, wollte sie sich
überhaupt den Ausblick auf die die Wissen-
schaft im Leben zufallenden Funktion ver-
sagen. +) Im Gegenteil: Bindeglied zwischen dem
einen und dem anderen muss die Frage sein:
Wo und wie fügt sich die Wissenschaft dem
Getriebe unseres Lebens ein? Wo und wie kommt
sie insbesondere dem von mir erwählten
besonderen Fach zu Hilfe? Beleg: Programm
dieser Tagung!
Damit wird die in Rede stehende Unter-
scheidung nicht aufgehoben, aber sie
nimmt einen durchaus veränderten Sinn
an – nämlich jenen Sinn, den sie in dem Ver-
langen der Wirtschaftsführer nach „Persönlich-
keiten“ hatte. Mit dem Wort „Allgemeinbildung“
unbeschadet aller „Nützlichkeit“!
18
ist, wenn es heute recht verstanden wird, das
Verlangen nach Menschen gemeint, die nicht
in ihrem speziellen Fach auf – und unterge-
hen, sondern es in weitere, überfachliche Lebens-
horizonte einzustellen, die es dem umgrei-
fenden Ganzen einzuordnen fähig und ge-
willt sind. Wo dies Verlangen sich recht versteht, da wird
das Wissen und Können, das den Fachmann
ausmacht, nicht als sekundär und hin-
terherkommende Angelegenheit hinter die
Allgemeinbildung zurückgestellt. Im Ge-
genteil: dies Wissen und Können ist not-
wendige Bedingung, die weil das Fach nun
einmal das Zentrum ist, von dem her der
Blick auf das Ganze gesucht und die Ein-
ordnung in das Ganze erstrebt wird. Es ist
eine rechte Wechselbeziehung, die hier zu
realisieren ist: blicke vom Standort des
fachs her ins Ganze – blicke vom Ganzen
her auf die Sonderfunktion deines Fachs!
Aus der äusseren Anreihung des Hetereoge-
nen ist die innere Verknüpfung des auf-
einander Angewiesenen geworden. Der tren-
nende Dualismus ist aufgehoben. Fachli-
che Tüchtigkeit und universales vermögen sind als zusammenge-
19
hörig erkennt.
Ich habe zunächst die Wandlung der
Lage dargestellt, ohne auf den konkreten
geschichtlichen Verlauf einzugehen, in dem
sie sich vollzogen hat. Ich hole das jetzt nach.
Für die wissenschaftliche Rationalisierung der
Lebenspraxis ist in erster Linie be-
stimmend gewesen der Ausgang der mathe-
matischen Naturwissenschaft im 17. Jhdt. und
der Siegeszug der Technik, der mit dem ausge-
henden 18. Jhdt. anhebt. Es handelt sich
also um eine, zeitlich gesehen, relativ junge
Entwicklung. Kein Wunder also, dass die tradi-
tionellen Vorstellungen von Menschenbildung
sich ihr gegenüber so zäh behauptet haben.
Den auf die Natur bezüglichen Wissenschaften
sind die auf den Menschen bezüglichen erst
allmählich nachgefolgt. Besonders wichtig
dafür die Epoche der Aufklärung – Aber auch
hier ist es dann so gekommen, das die auf
den Menschen bezügliche Lebenspraxis sich
mehr und mehr rationalisierte und schliess-
lich verwissenschaftlichte. Das Ergebnis steht
uns heute klar vor Augen: Staat, Recht, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Erziehung könnten heute
ohne die Beratung durch die Wissenschaft nicht
20
durchkommen. Auch in diesem Bereich besteht
der Wechselbezug von Allgemein Fachbildung und
Menschenbildung, nicht ein äusserliches Ne-
ben- oder Nacheinander des Einen und des
Anderen.
Allein ist mit der Anerkennung dieser
Wandlung die Bildungslehre der klassischen
Humanitätsbewegung als in jeder Hinsicht
erledigt und abgetan anzusehen? Ich
glaube, dass sie in einer bestimmten Hin-
sicht aktueller ist denn je. Wie sehr sie
es ist, das bezeugt sich gerade in den Klagen
und Forderungen der Wirtschaftsführer, die
der Ausgangspunkt für die Behandlung
unseres Themas gebildet haben. Wenn das
Verlangen nach „Persönlichkeiten“, d.h.
nach weitblickenden, urteils- und entschei-
dungsfähigen Menschen sich so unwider-
stehlich Bahn bricht, so wird dadurch bewirkt,
dass an solchen Persönlichkeiten Mangel ist
und dass man ihr Fehlen beklagt und als
verhängnisvoll ansieht. Wenn aber dieser
Mangel sich schmerzlich fühlbar macht, dann
kann doch der Frage nicht ausgewichen wer-
den: sollte etwa dieser Mangel mit dem ge-
21
schilderten Vorgang, mit der fortschreitenden
Rationalisierung und Verwissenschaftlichung
der Lebenspraxis zusammenhängen? Liegt
etwa in diesem Vorgang, was dem Aufkom-
men von Persönlichkeiten, wie wir sie wün-
schen, abträglich ist?
Und damit ist nun die Stelle erreicht, an
der uns eine bereits erwähnte Mahnung und
Warnung unserer klassischen Denker vernehm-
lich in die Ohren klingt. Sie glaubten einen
Wirderspruch zu bemerken zwischen den Forde-
rungen der Humanität (Individualität, To-
talität) und den Ansprüchen der arbeitstei-
ligen Gesellschaftsordnung zu entdecken. Sie
glaubten der letzteren, modern gesprochen,
eine „ent-persönlichende“ Wirkung nach-
sagen zu sollen.
Hatten sie damit Unrecht? Oder ist es
nicht vielmehr wirklich so, dass die fort-
schreitende Rationalisierung der Lebenspra-
xis den blossen Fachmenschen heranzuzüch-
ten offenkundig tendiert? Gerade sie ist es ja,
die die Möglichkeit schafft, ja den Anreiz
hervorbringt, sich in das erwählte Fachgebiet
zurückzuziehen und so wohl die übrige
Welt als auch das übrige Selbst so zu behan-
deln. Beachten wir wohl: vor dem Durchdringen
22
der Rationalisierung hatte diese Möglichkeit
nicht bestanden! Mochte die Lebenstätigkeit
des Einzelnen so umgrenzt sein wie sie wollte,
er lebte im Ganzen, in Anschauung des Gan-
zen, und verstand sie als Teiläusserung des
Ganzen. Erst die rationale Durchformung und
Abgrenzung der Tätigkeit ermöglicht ihre
Isolierung im Bewusstsein des sie Ausü-
benden. +) Der blosse Fachmensch ist die typische
Lebens
Ausgeburt des modernen Menschen in der durch-
rationalisierten Gesellschaftsordnung. Der
Schrei nach Persönlichkeiten ist der Hin-
weis auf diese Fehlbildung.
Nun, dass dieser Schrei erschallt, das be-
weist, dass der Mangel nicht bloss faktisch
besteht, sondern auch als solcher verspürt
wird. Diejenigen, die ihn ausstossen, nehmen,
ohne es zu wissen, die Klage unserer Klassi-
ker wieder auf. Sie geben ihnen Recht mit
ihren humanen Bedenken gegen die ra-
tionalisierte Arbeitsordnung. aber sollen
wir deshalb auf den Standpunkt der klas-
sischen Humanität zurückkehren? Sie
haben die den Menschen in menschenbe-
drohender Gefahr gesehen, aber sie haben sich die
+) Perfekte Rationalisierung = perfekte Arbeits-
spezialisierung
23
Ab- und Gegenwehr zu einfach vorge-
stellt. Sie haben gemeint, es gebe auf dem
Wege der fortschreitenden Rationalisierung
noch eine Möglichkeit der Umkehr.
(Schiller) Wir wissen es besser. Wir wissen:
es ist unser unabwälzbares Schicksal, den
Weg der fortschreitenden Verwissenschaftli-
chung weiter und weiter zu verfolgen.
Damit wissen wir aber auch: es ist unser
unabwälzbares Schicksal, unser Men-
schentum in eben dem Masse der Gefahr
der Austrocknung und Verkümmerung aus-
gesetzt zu sehen, wie die wissenschaftliche
Versachlichung und Verfachlichung sich
perfektioniert. Die „Mechanisierung“ ist
die uns dauernd überschattende Gefajr.
Was hilft dagegen, da die Auskunft
der Klassiker als illusorische anerkannt
ist? Eine Gefahr sehen heisst zur
Gegenwirkung aufgerufen sein. Wenn
wir wissen, das die fortschreitende <..ienti-
fizierung> uns Fachmenschen auszu-
leeren droht, so heisst es eben, vor dieser
Bedrohung auf der Hut sein, sich gegen
sie wappnen. Was uns not tut, das ist
die Tugend einer permanenten Wachsam-
24
keit gegenüber der Versuchung, um als
Menschen im Fach, in der Sache untergehen
zu lassen.
Und erst damit vervollständigt sich das
Bild dessen, was „Menschenbildung“ heute,
in der uns umfassenden Welt, bedeutet.
Sie bedeutet auf der einen Seite jene Er-
weiterung des innern Horizonts, die uns
befähigt, das Fach in das Ganze des Le-
bens hineinzuschauen und aus dem
Ganzen dieses Lebens heraus zu verste-
hen. Sie bedeutet auf der anderen Seite
die misstrauische Wachsamkeit gegen
all den Einflüssen, durch welche der täg-
liche Umgang mit dem Fache jene Ho-
rizonterweiterung verhindern oder rück-
gängig machen könnte. „Halte die offen“ –
so lautet der Imperativ, durch dessen Be-
folgung heute die Humanität allein ge-
wahrt werden kann. Man muss es fertig
bringen, die durch das Fach vorgeschriebenen
Obligenheiten mit sicherer Kennerschaft zu
erfüllen und sich doch vor dem Untergehen
in diesen Obligenheiten zu bewahren.
25
Doppelt tut die Einschärfung die-
ser Wachsamkeit not angesichts der
Apotheose der rationalisierten Lebens-
ordnung durch den Kommunismus und
der relativen Blindheit, mit der die
anderen Völker des freien Westens der
Bedrohung ihres Menschentums gegen-
überstehen. Hier tritt das auszeichnende
Verdienst gerade der deutschen päda-
gogischen Überlieferung hervor. „Hu-
manität“ wird in ihrer Bedrohtheit
gesehen.
V 0056b
1
Erziehungsnöte. Umschwung. Gemein-
sam.
Spezifisch deutsche Frage. Gegenpol:
Kommunismus. „Kollektiv“. „Fach“.
Deutsche pädagogische Überlieferung. Zäh-
lebig. Klassische „Humanität“. Front
gegen arbeitsteilige Gesellschaft. „Indi-
vidualität“ und „Totalität“. Polemisch.
Zudem: Nützlichkeit! Entfremdung.
Menschentum im Jenseits. Kastaliens.
Sonderung von Fachbildung. Dua-
lismus. Nur bei uns. Soziologische
Gründe. Gegenbild: die Angelsachsen.
-------------------------------------------------
Verschärfung des Dualismus. Beweis:
mein Thema. Neue Träger: die Wirt-
schaft. Dringlich.
Beispiel: Wiesbaden 1957. Schrei nach
„Persönlichkeiten“.
Identisch mit Parole der „Humanität“?
Der Hochschule willkommen.
Irrtum der Gleichsetzung. Persönlichkeit
„in“ der Wirtschaft. Wirtschaft = Feld der
Bewährung.
Verteidigung: Souveränität des Geistes
qualifiziert zur Lebensbemeisterung! Hin-
terher! Sphärentrennung bleibt.
2
So noch heute. Schadewaldt. „Ausgangs-
stellung“.
Meinung der Wirtschaftsführer?
--------------------------------------------------
Wann war Dualismus durchführbar?
Traditionelle Routine, nicht rationali-
siert. Anders mit fortschreitender Ra-
tionalisierung. Bis hin zur wissenschaft-
lichen Rationalisierung der Praxis.
| Neues Ansehen! Übergreifen der
| Wissenschaft. Keine nachträgliche
| „Fachbildung“. Keine fachfremde Wis-
| senschaft. Ausblick auf Fach, Leben,
| Gegenwart trotz „Nützlichkeit“. Bindeglied.
| Programm!
| Unterscheidung umgedeutet. Über-
| fachlicher Lebenshorizont. Fach ist
| Zentrum. Wechselbeziehung.
|-------------------------------------------------------
| Konkreter Verlauf: Natur-W. u. Tech-
nik. Nachfolgen der Menschen- Wissen-
schaften. Staat, Recht usw. Auch hier
Wechselbeziehung.
Klassische Theorie erledigt? Wie weit
aktuell? Mangel an „Persönlichkeiten“
und Verwissenschaftlichung. per-
sönlichend. Fach-Mensch. Früher nicht!
Mangel verspürt! Kein Zurückfallen.
Wachsamkeit. Teil der „Menschenbildung“. Offen! |