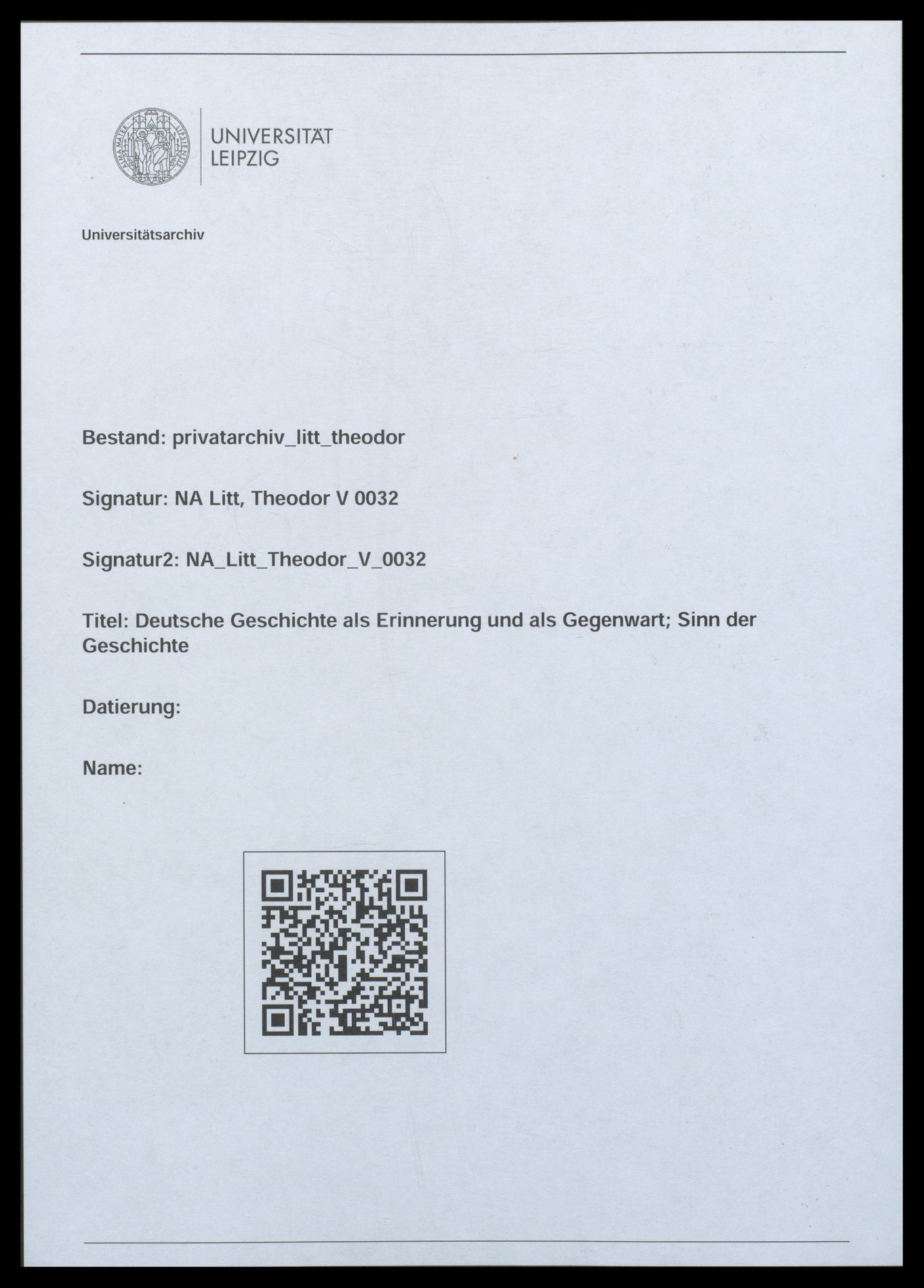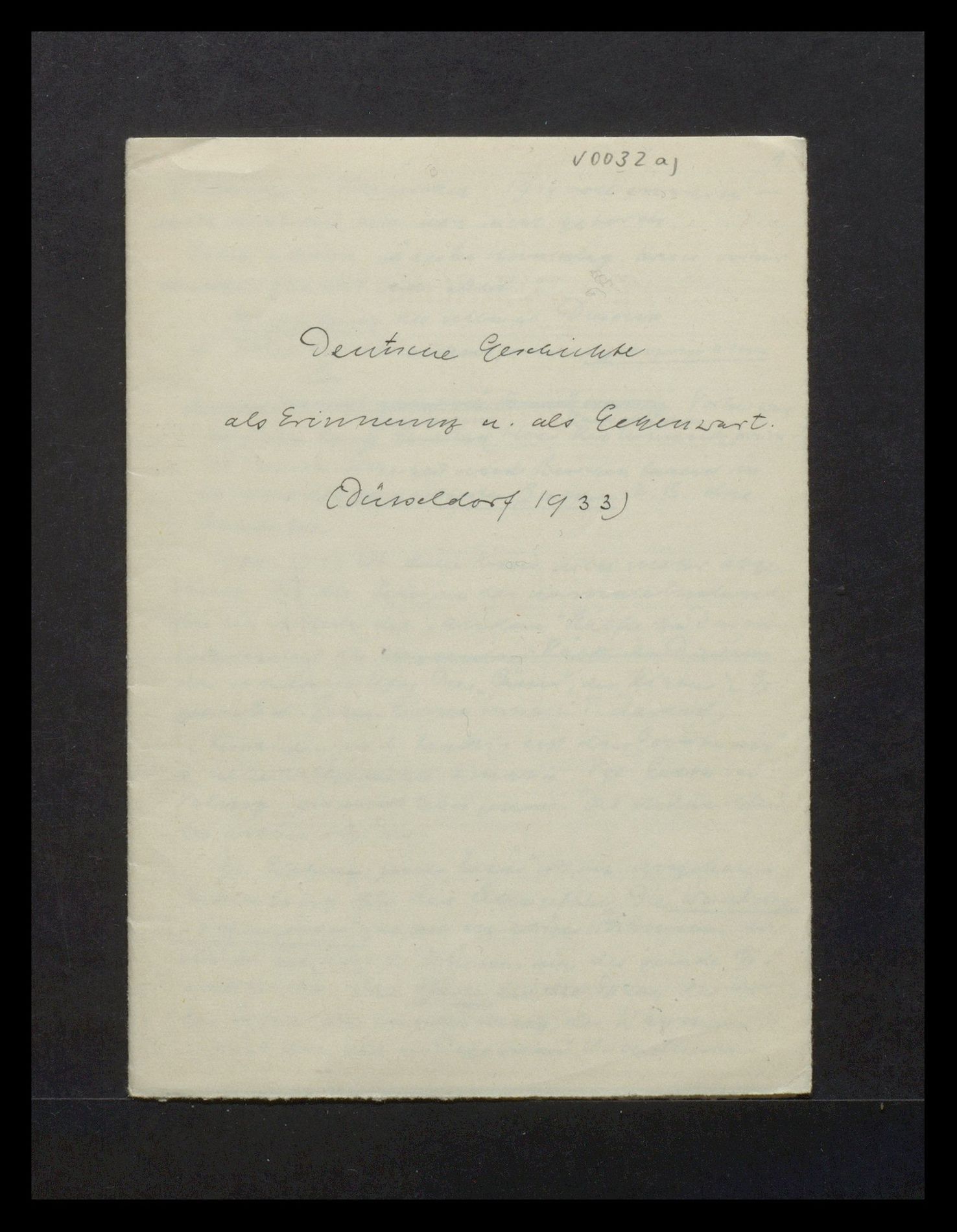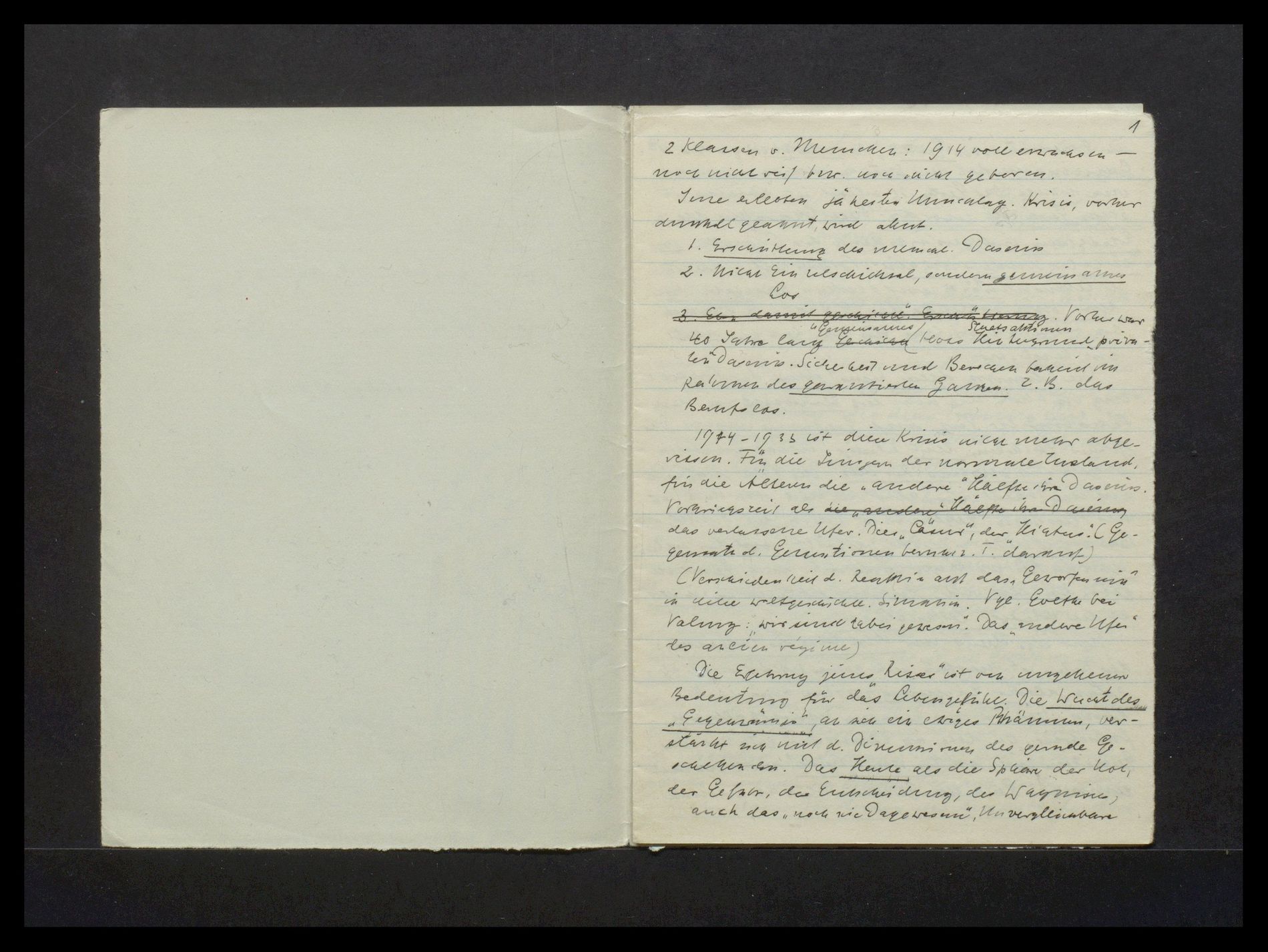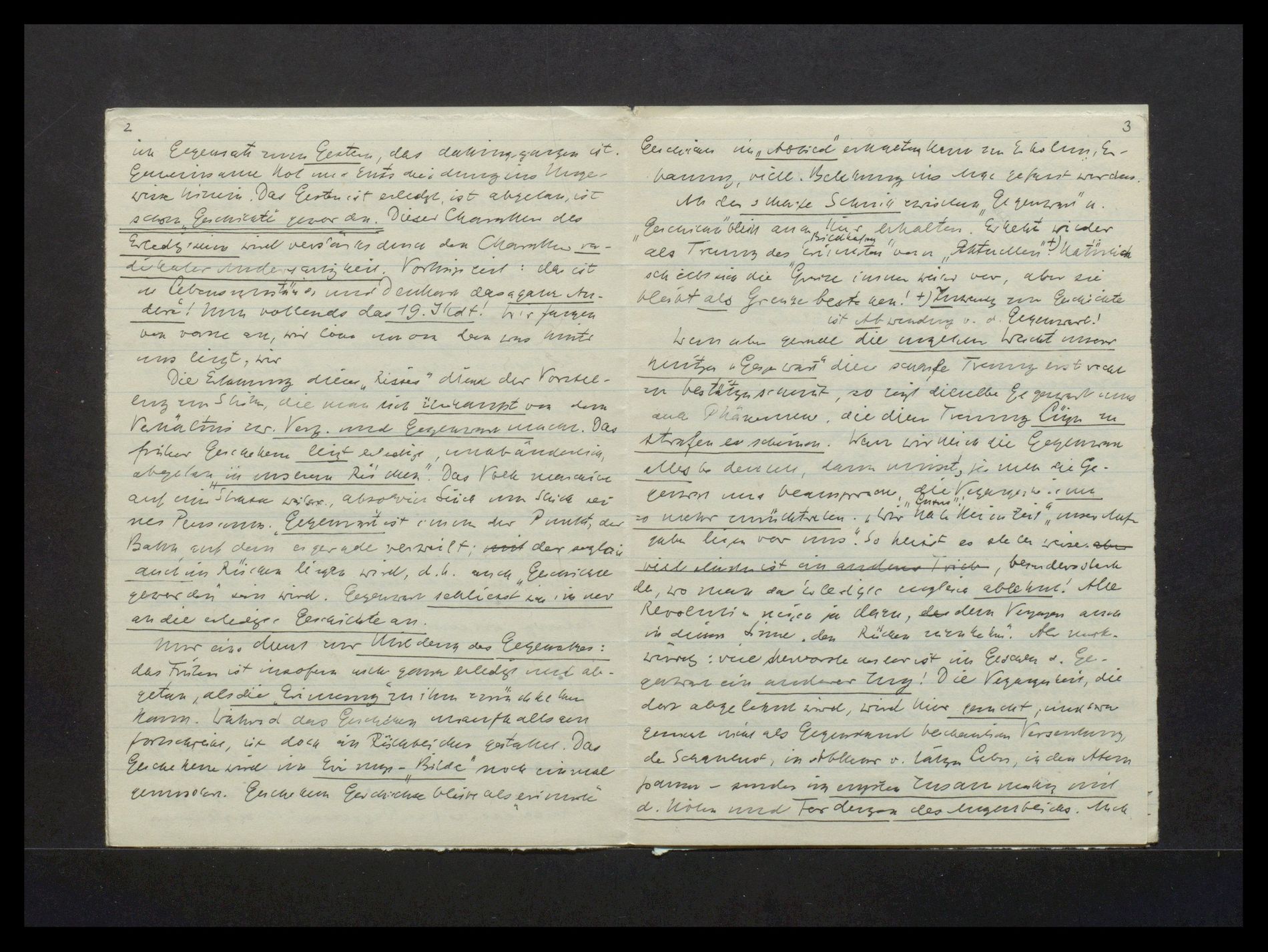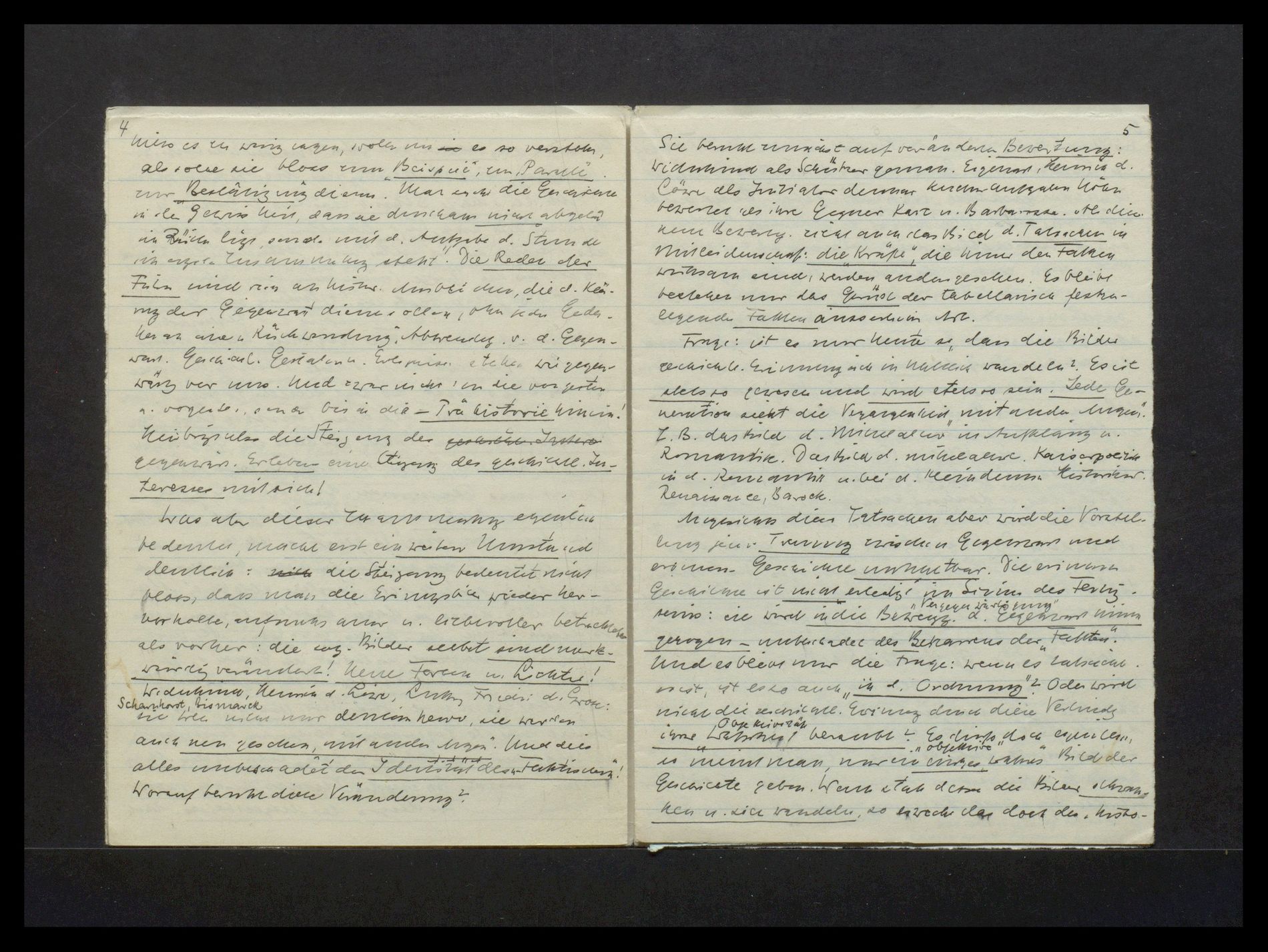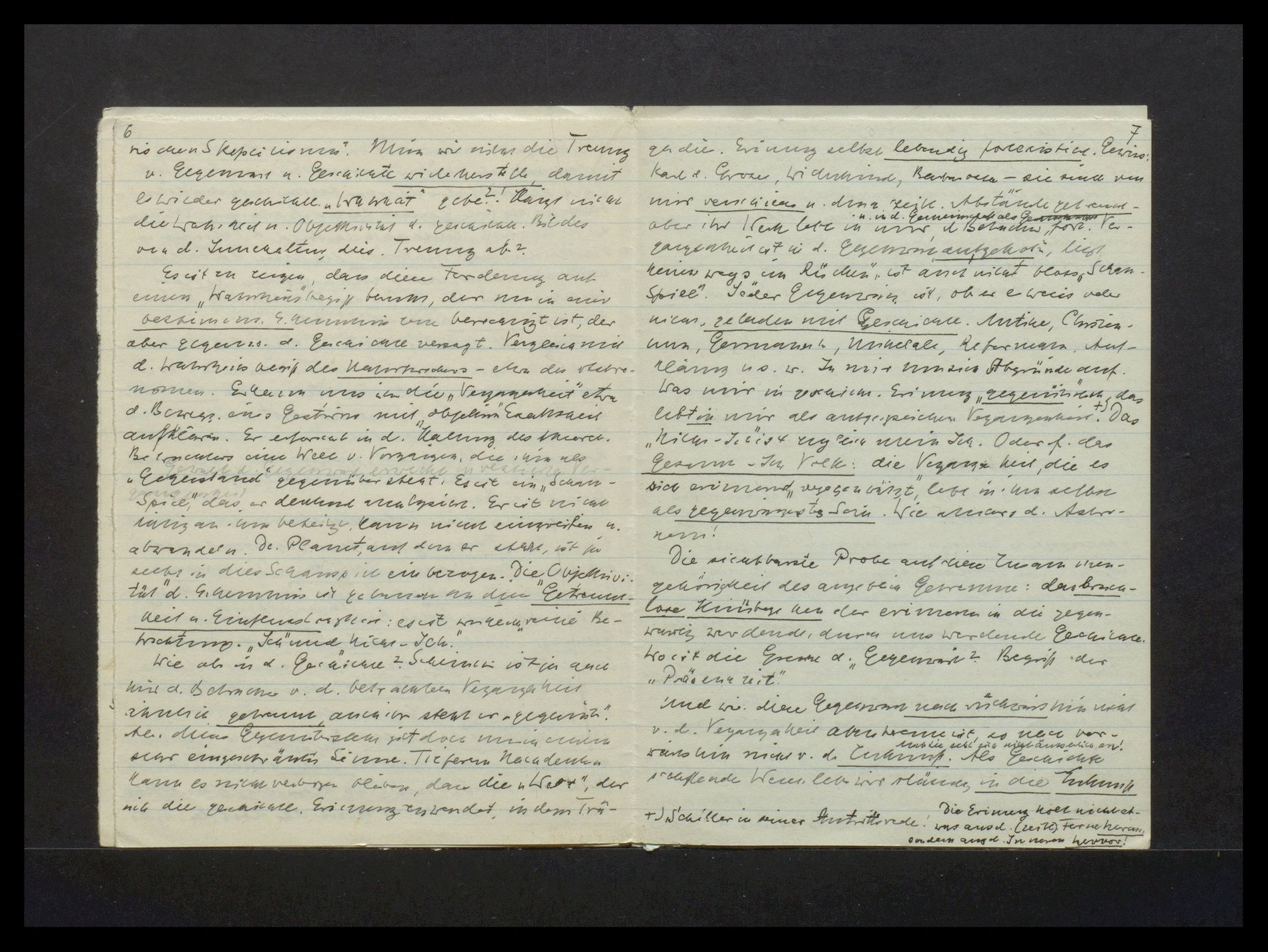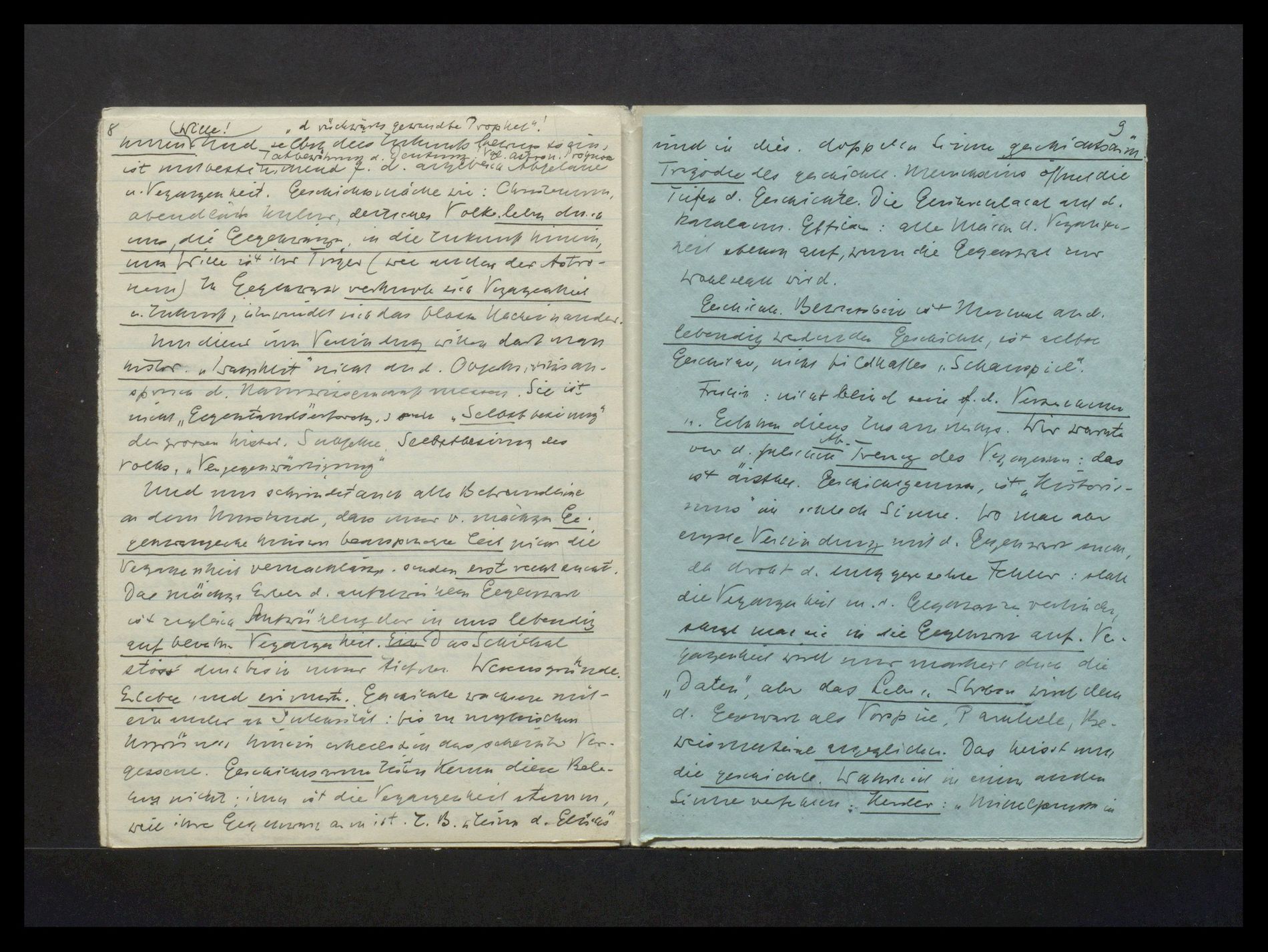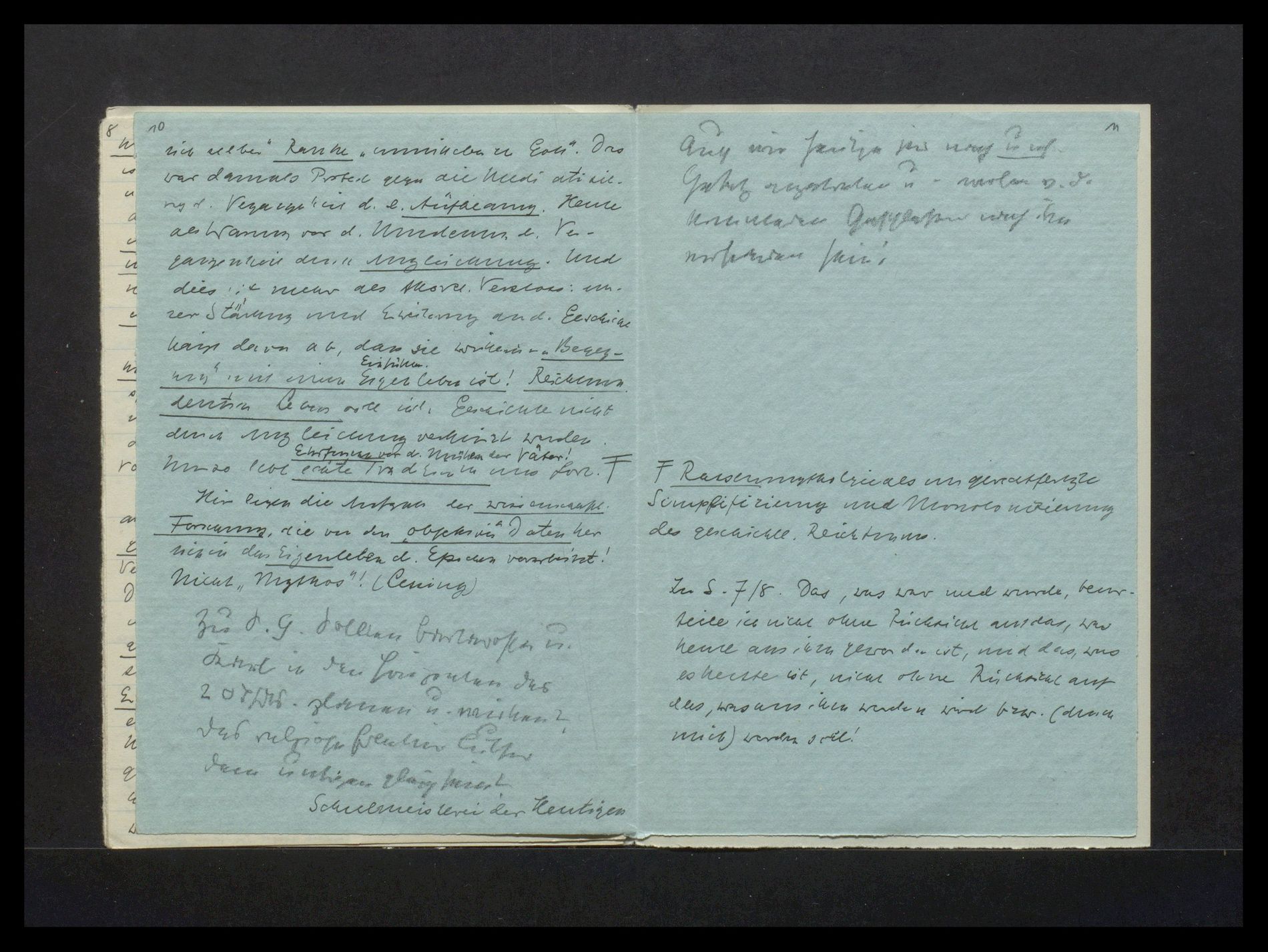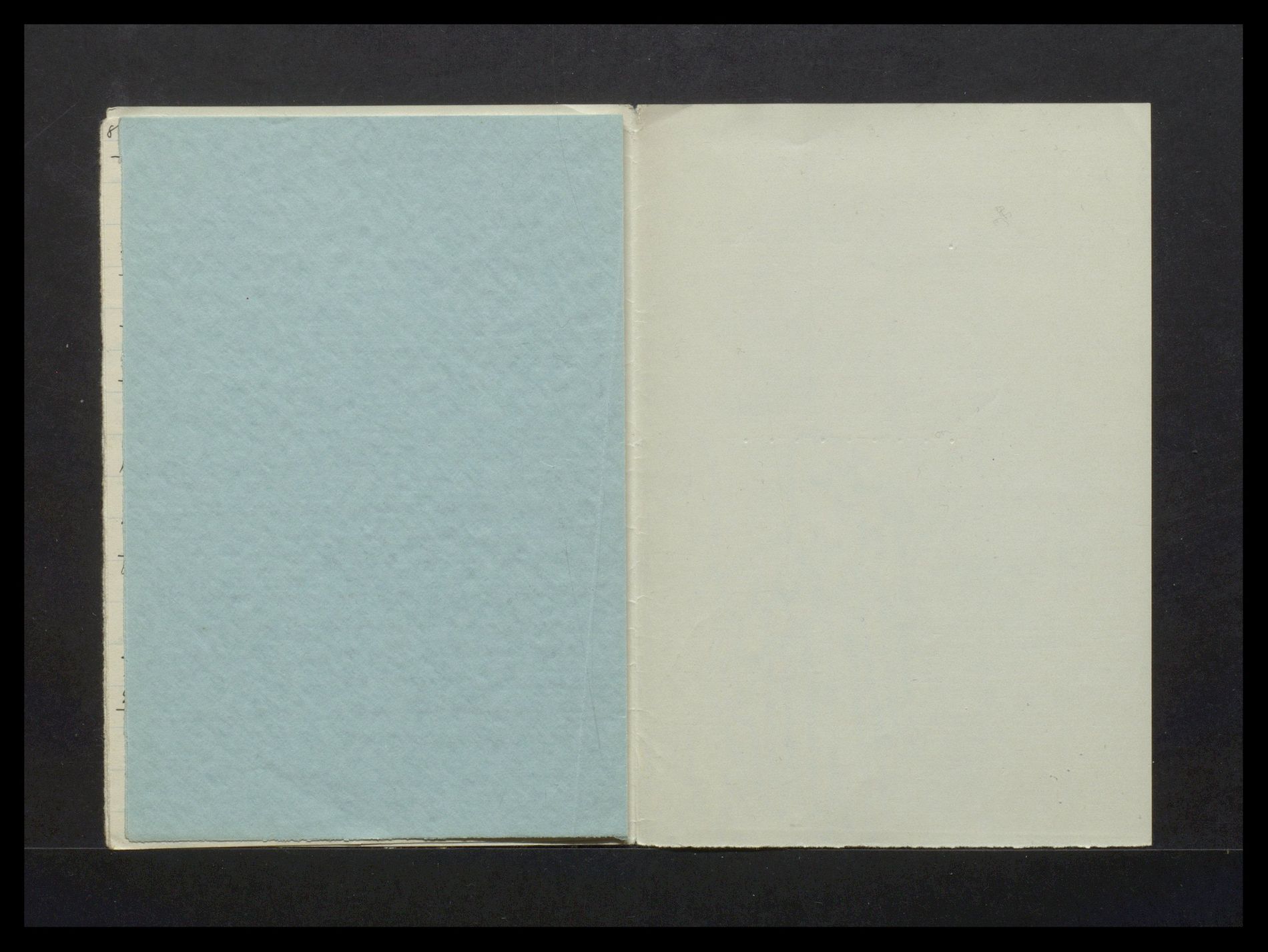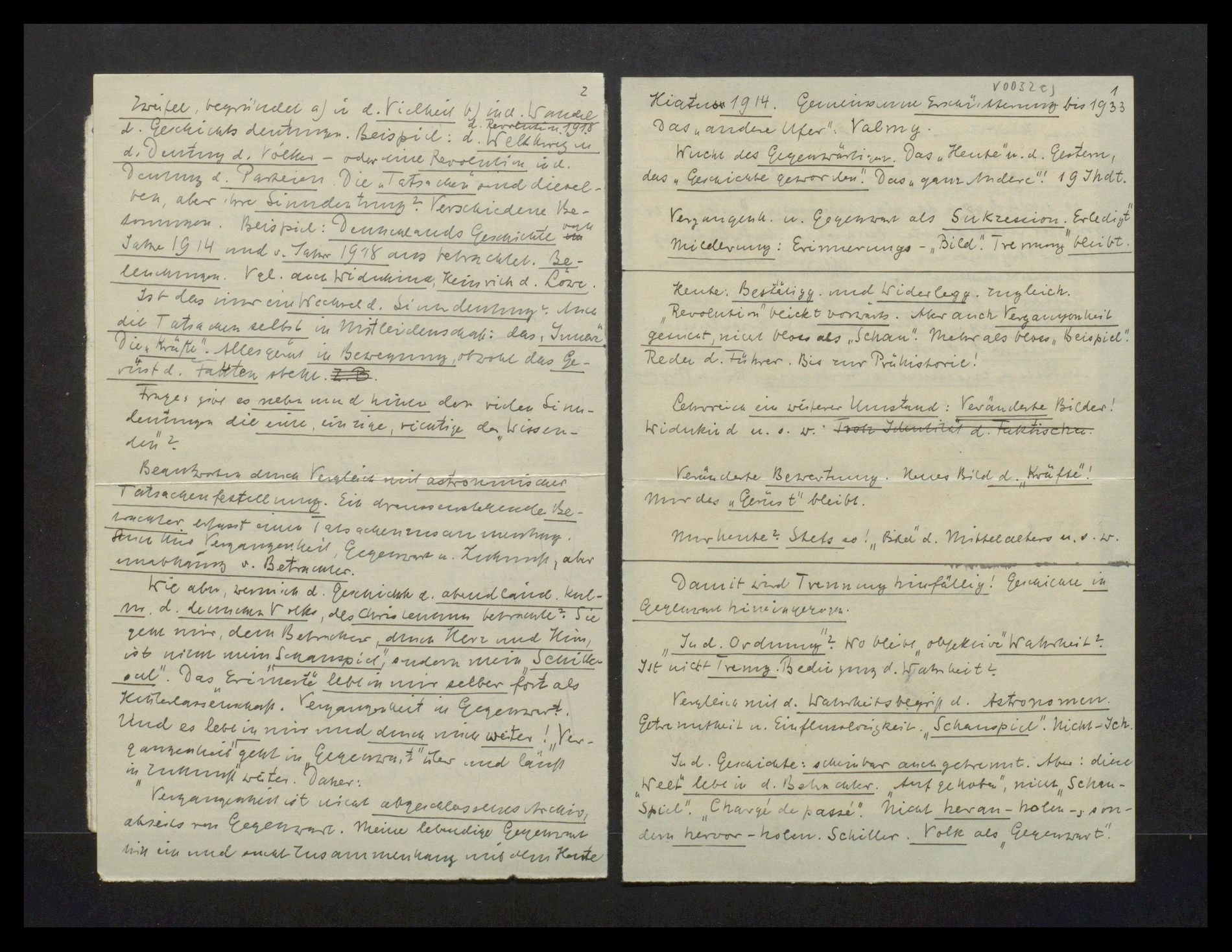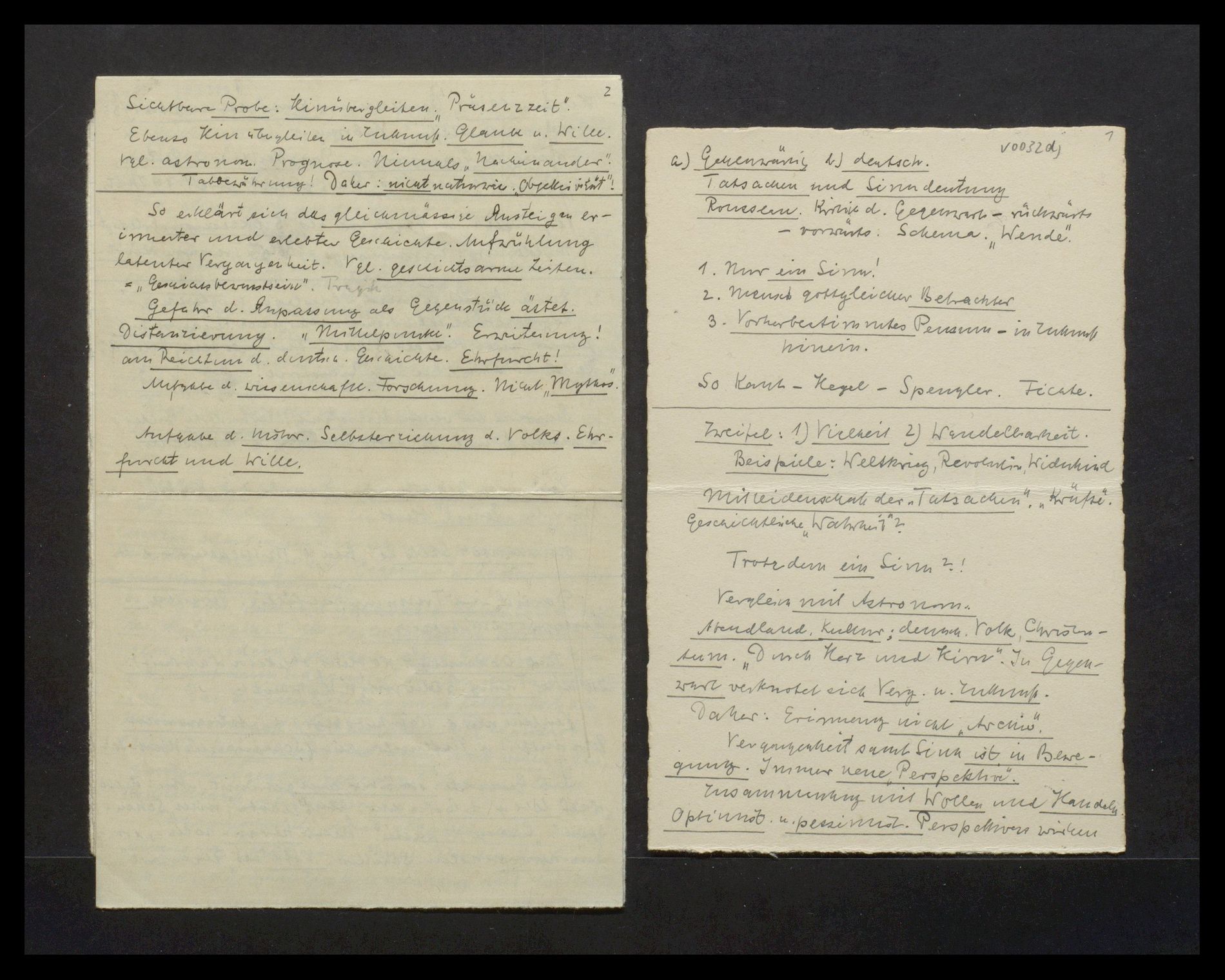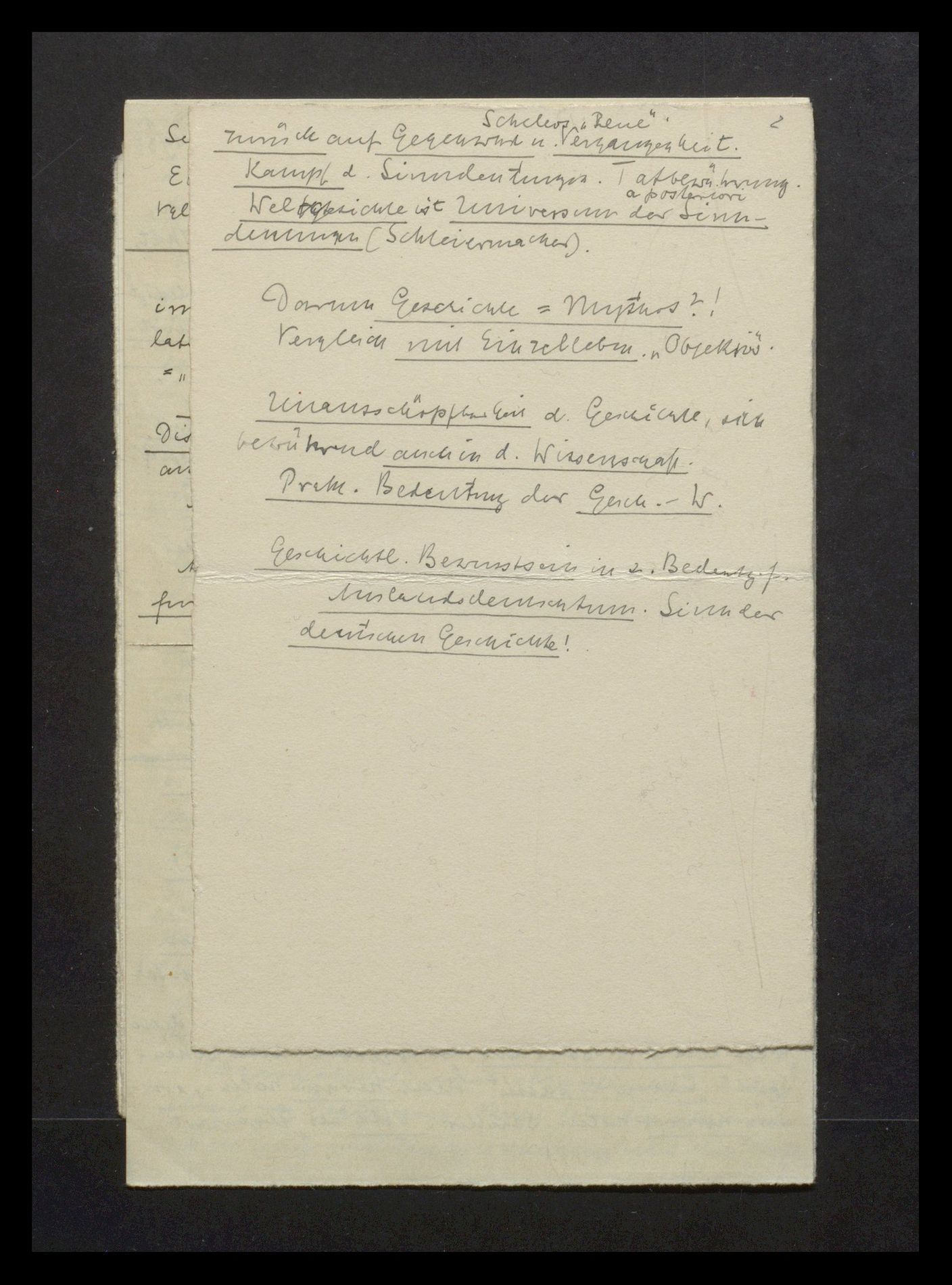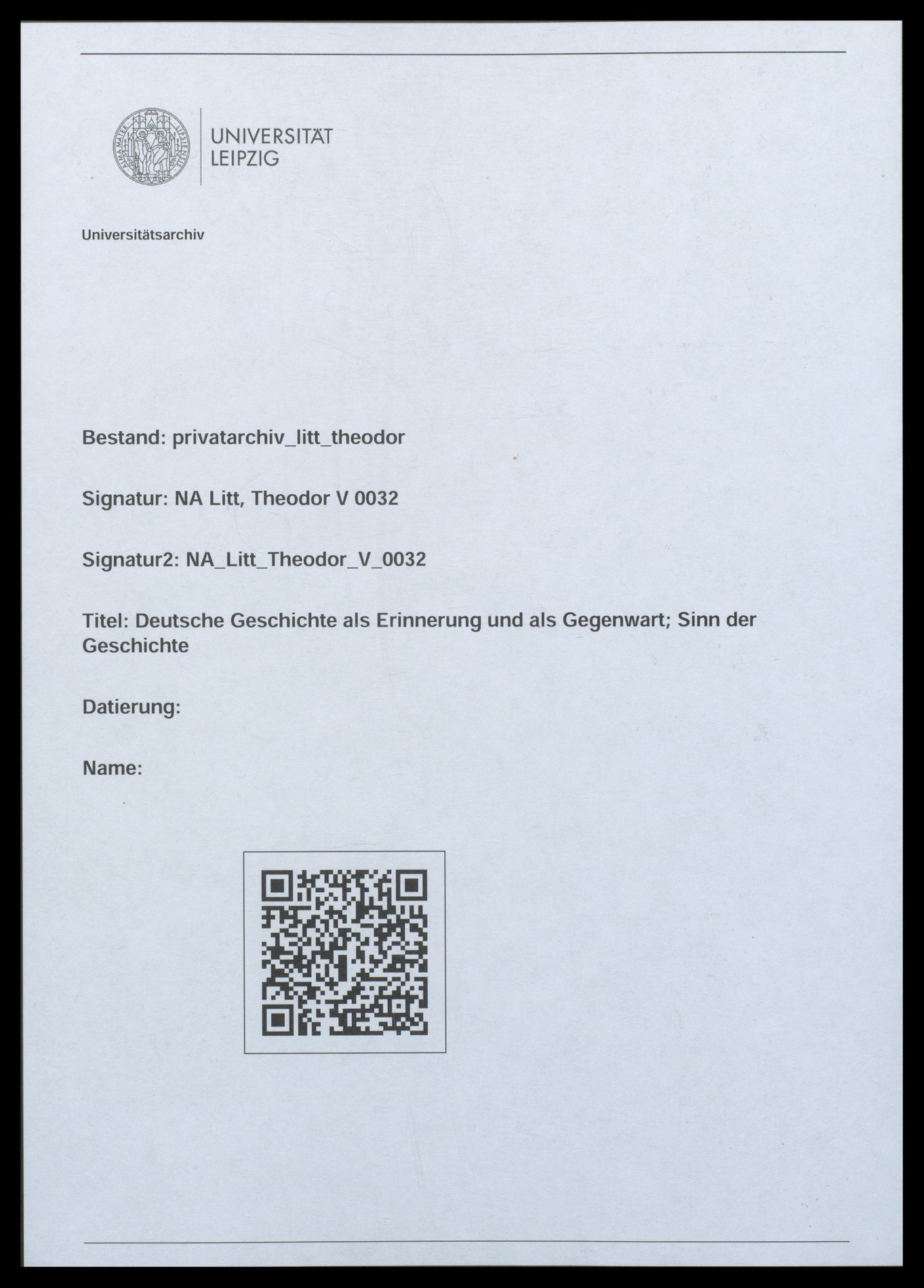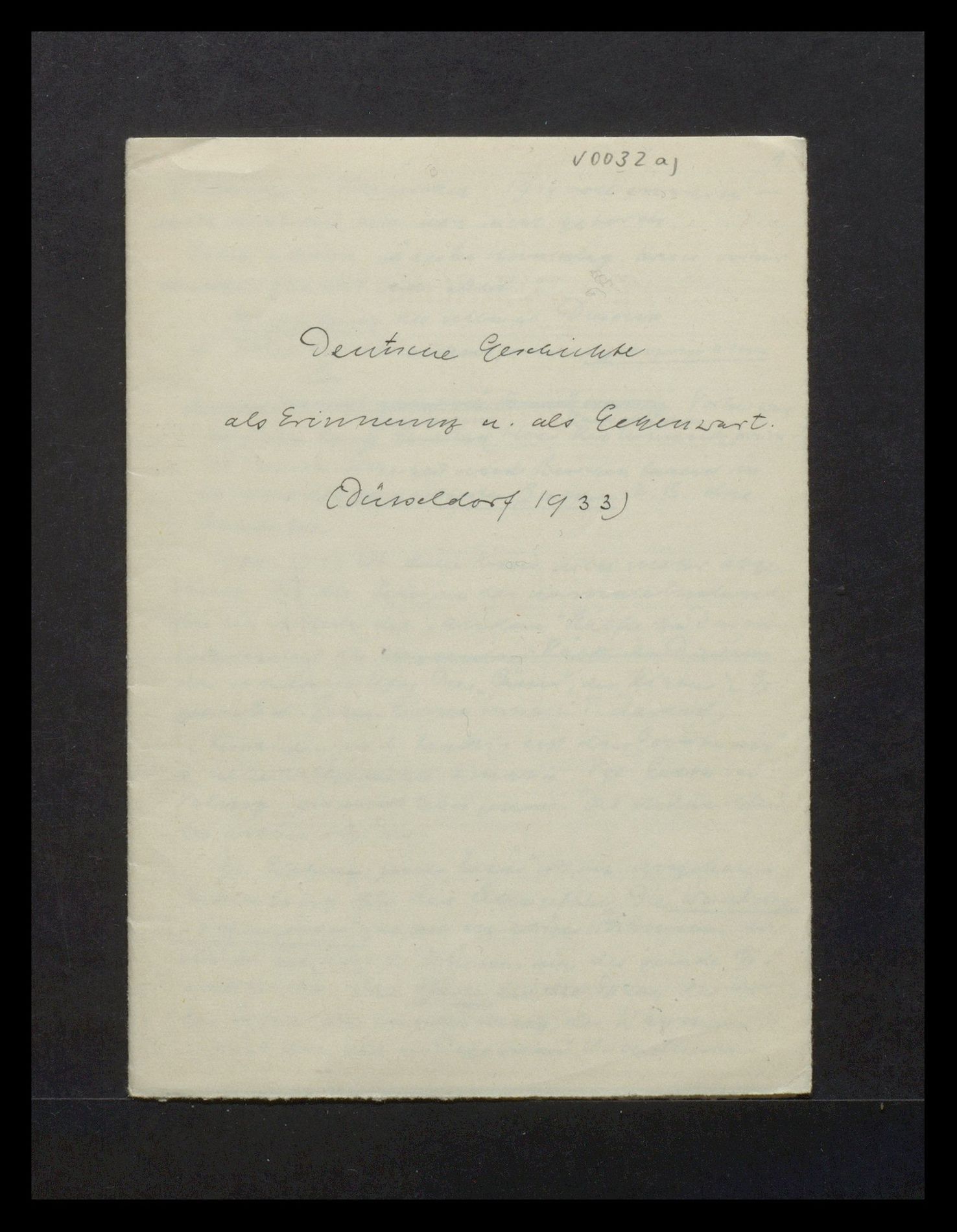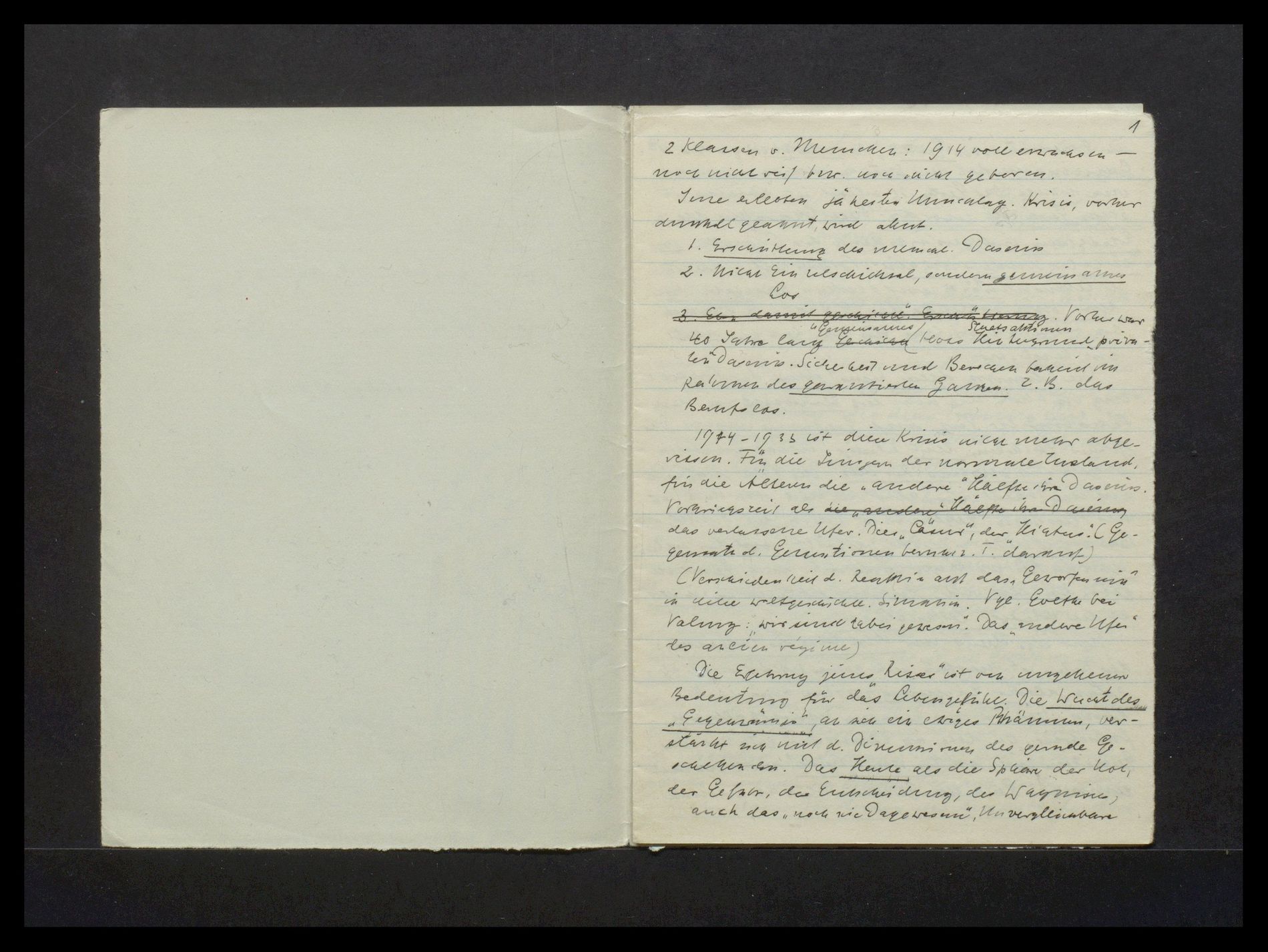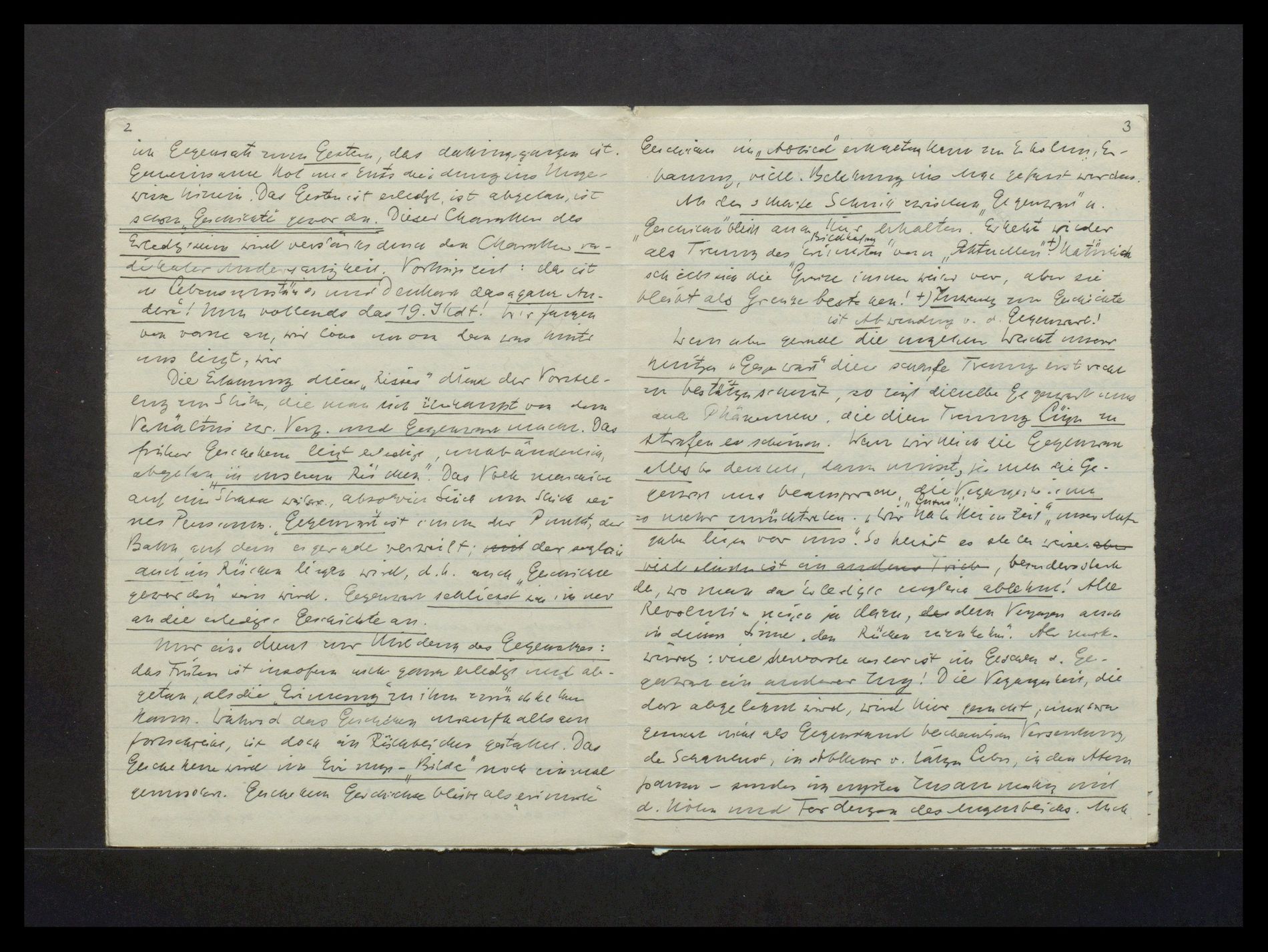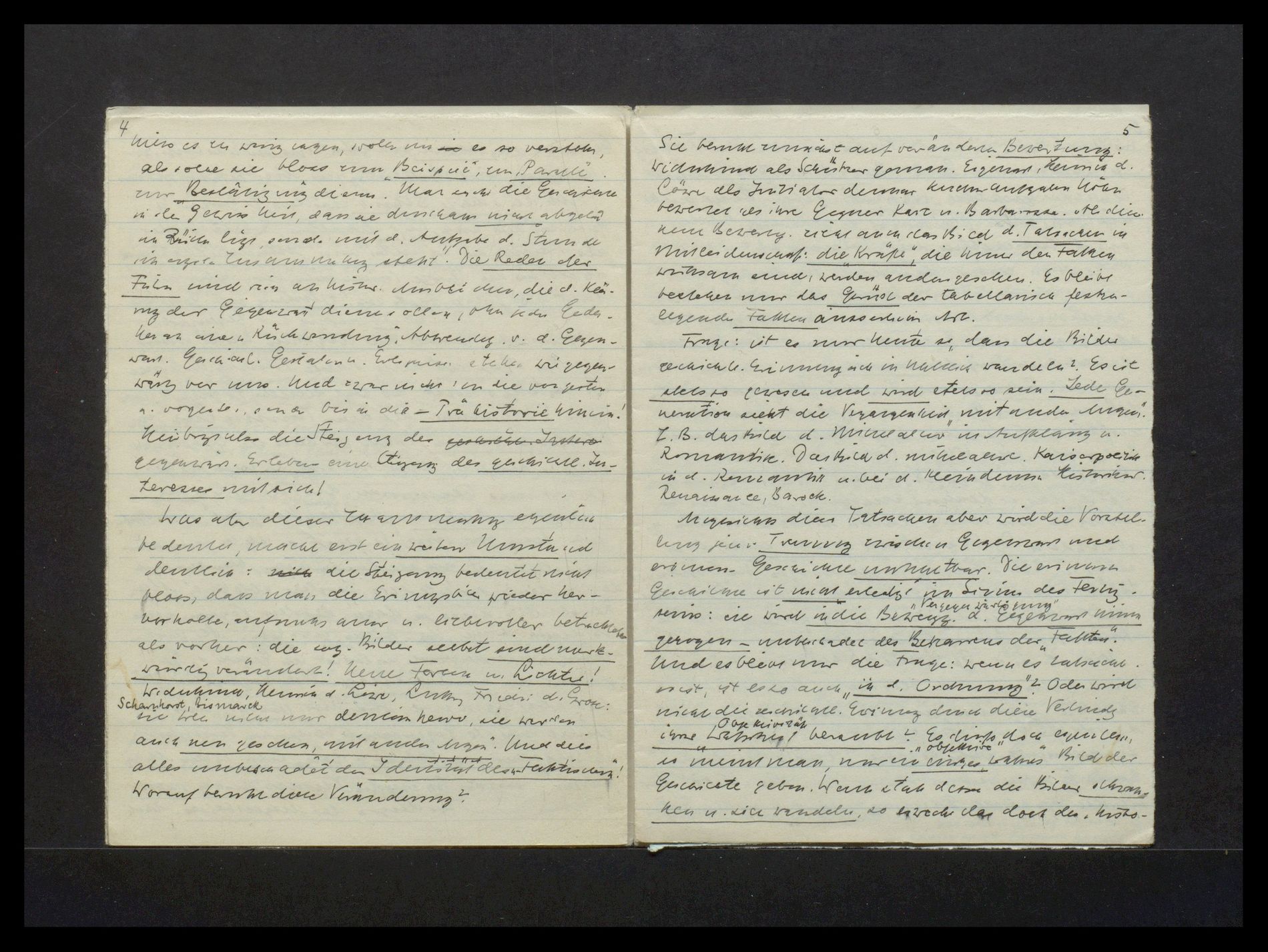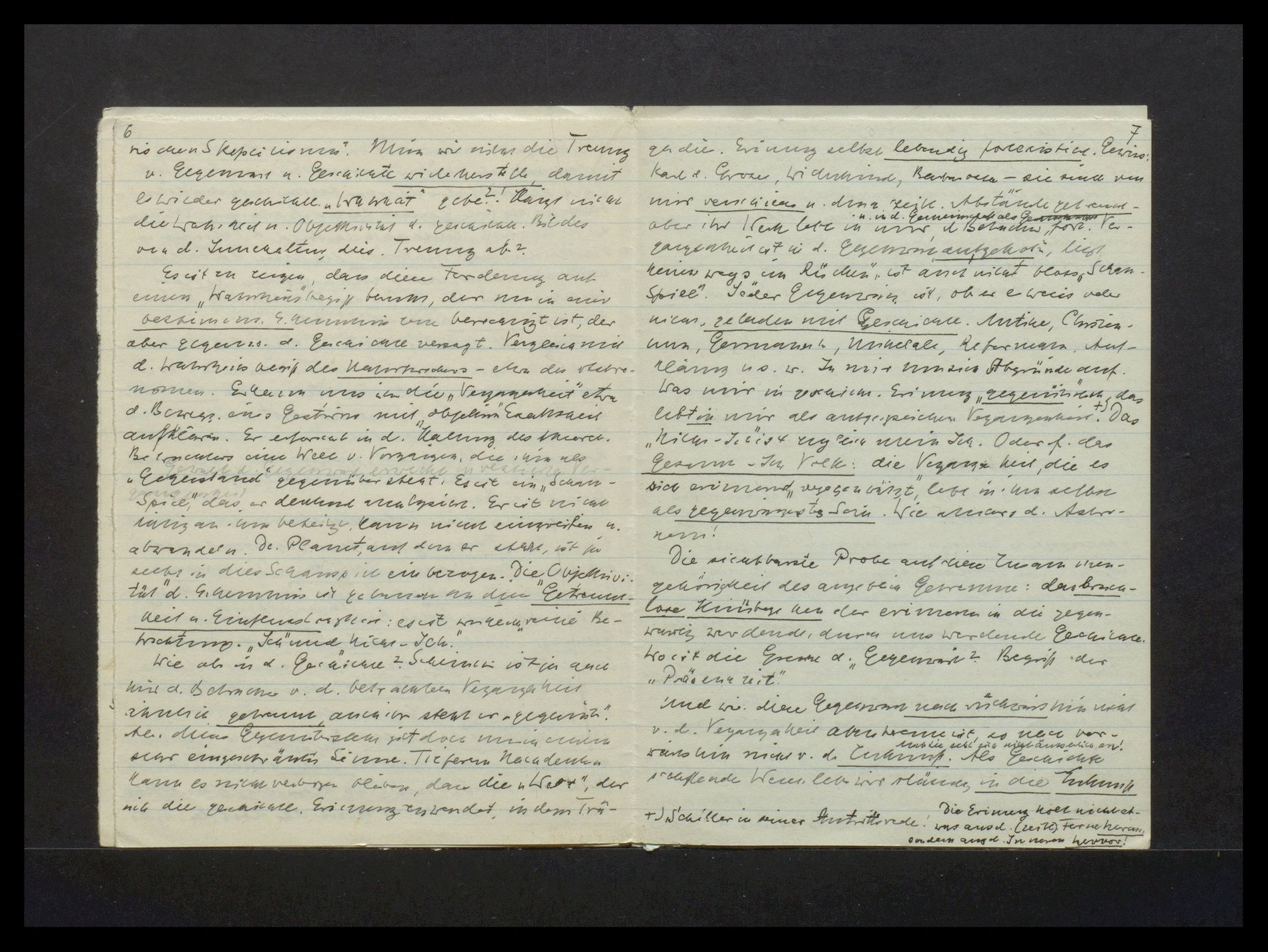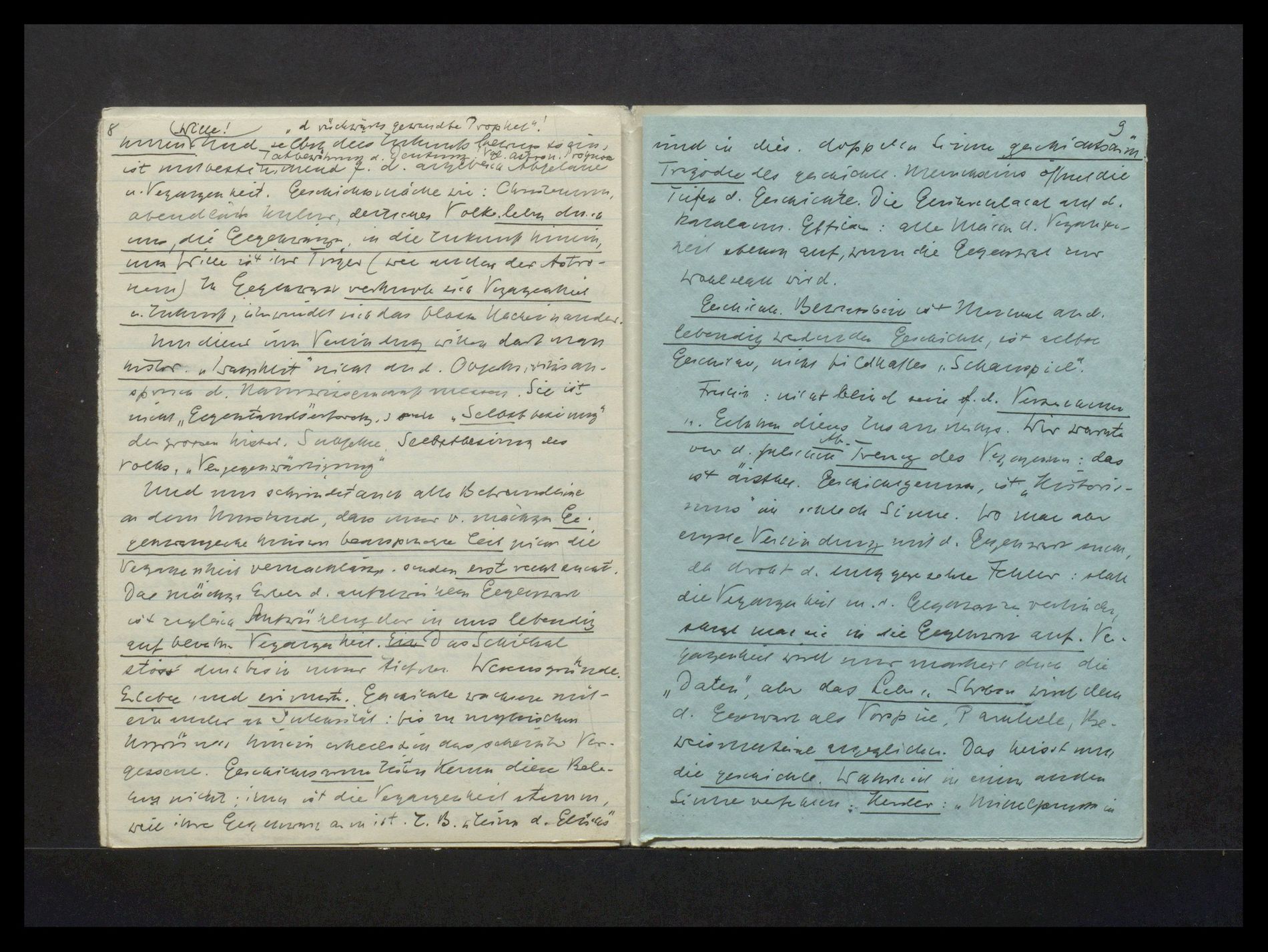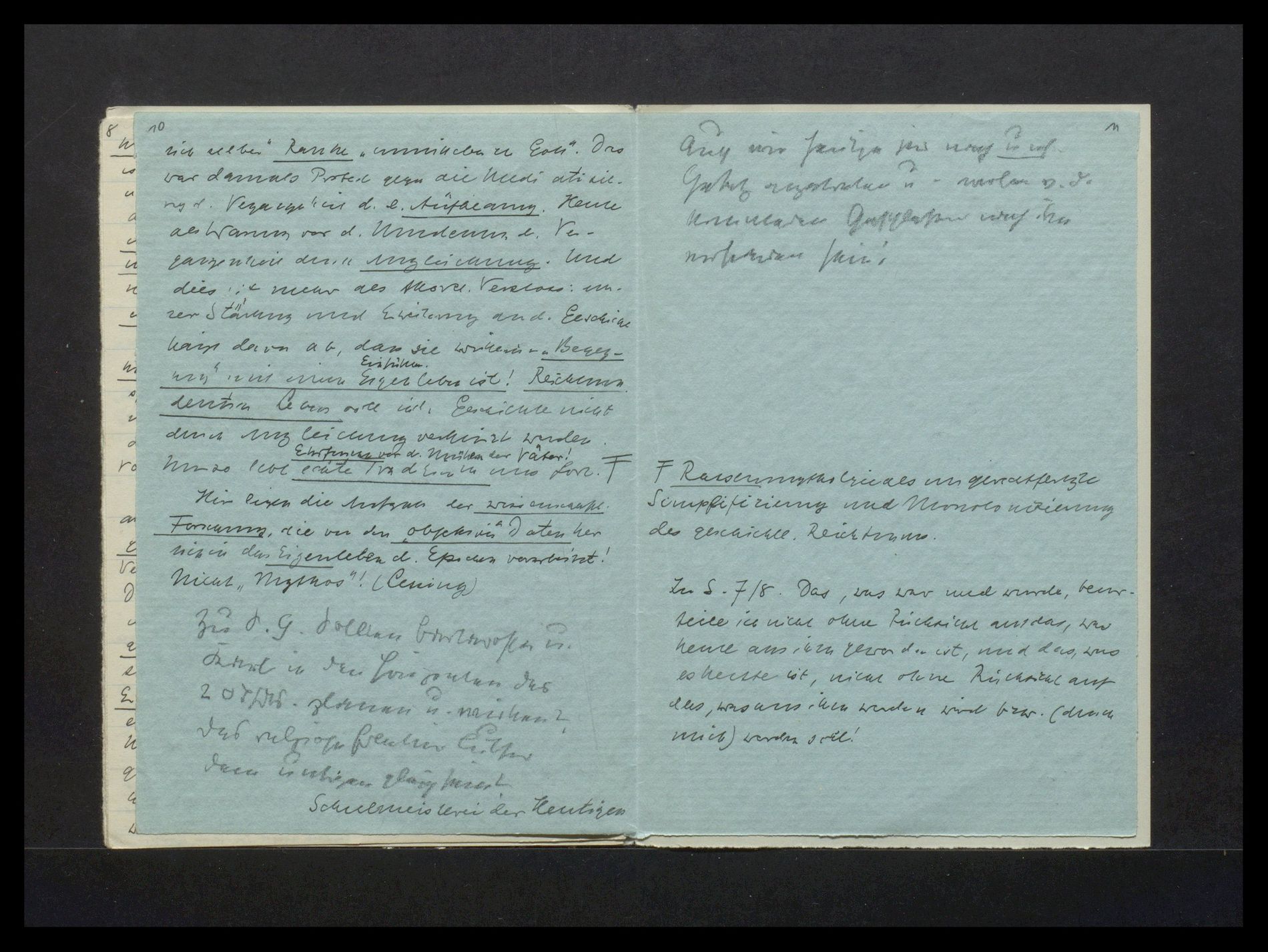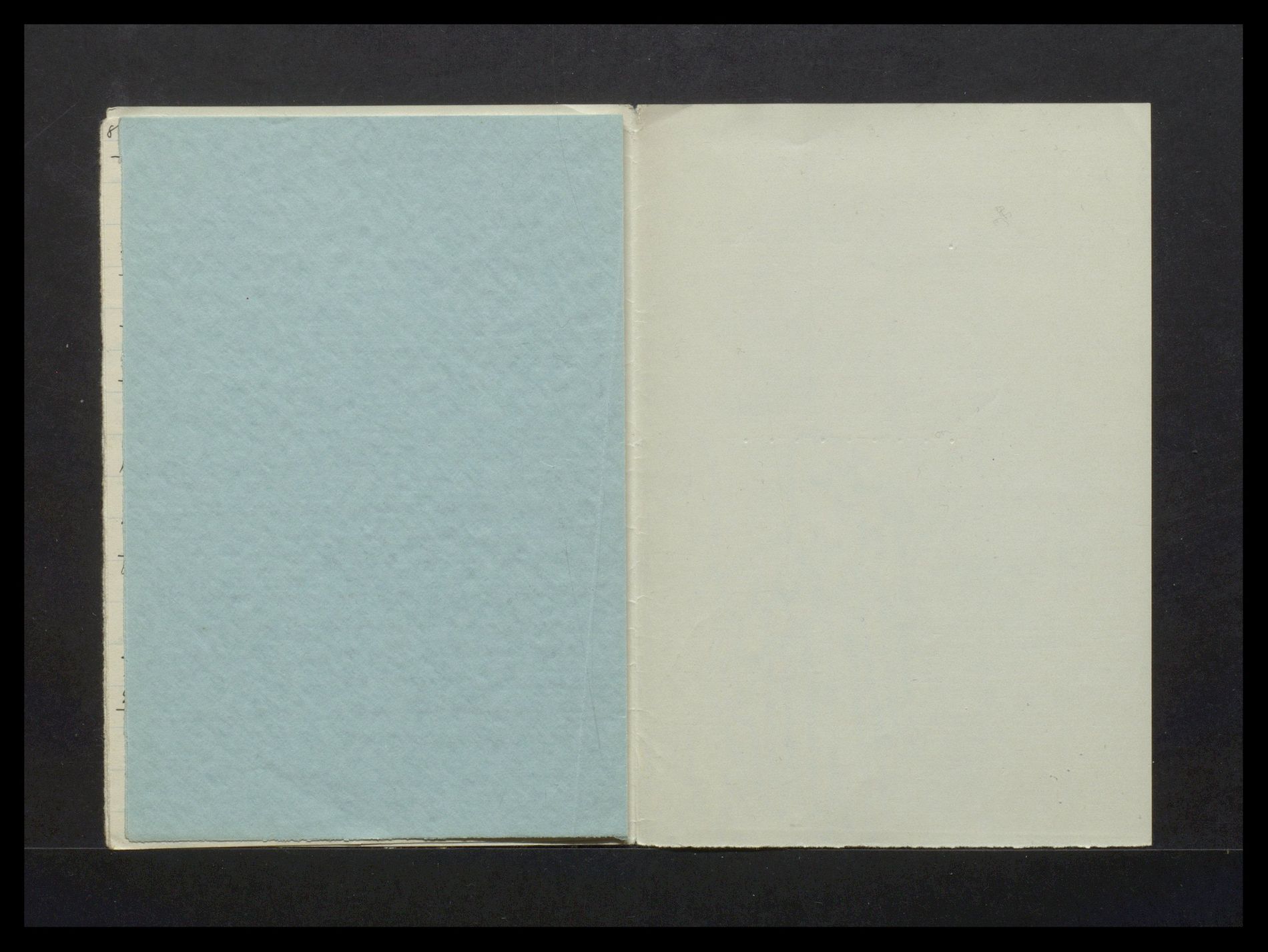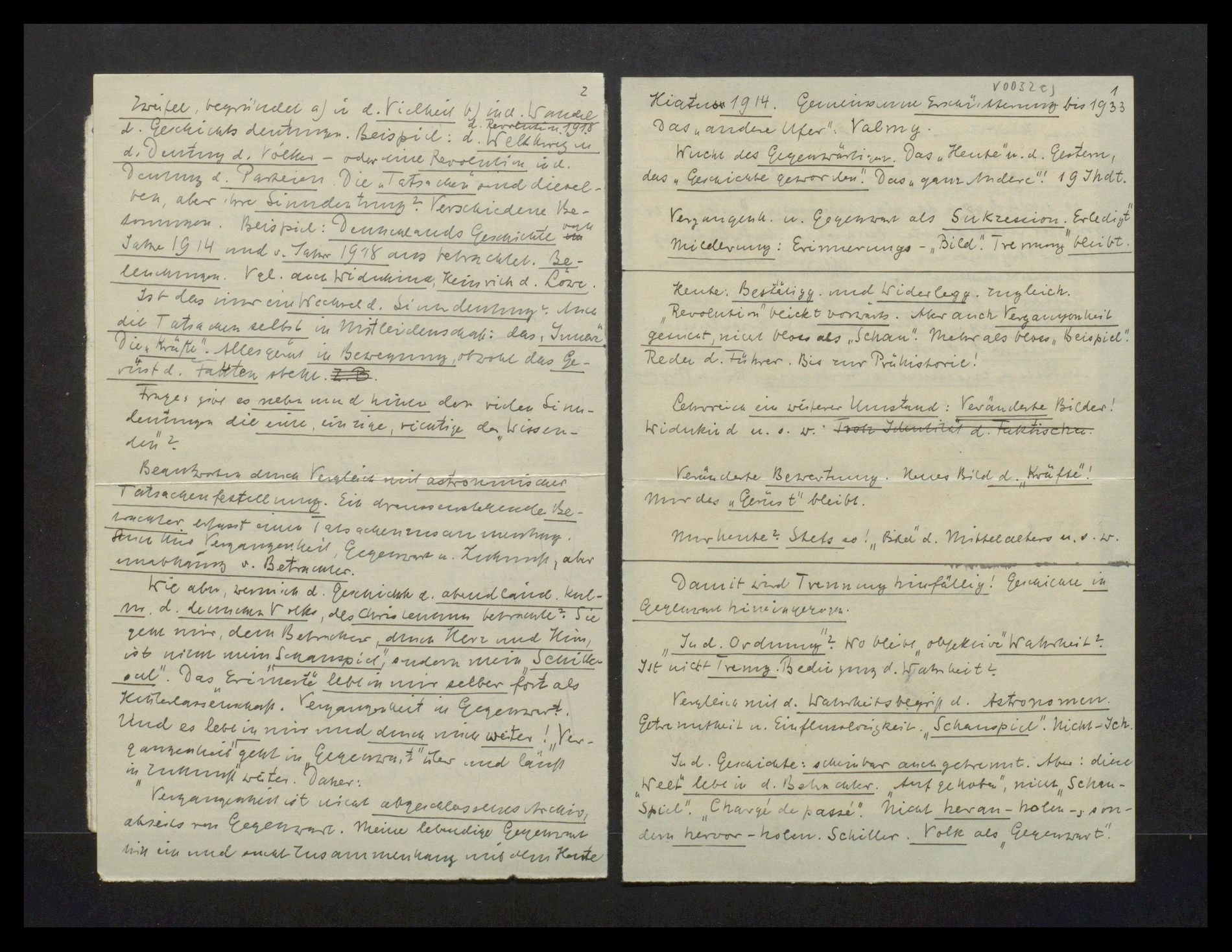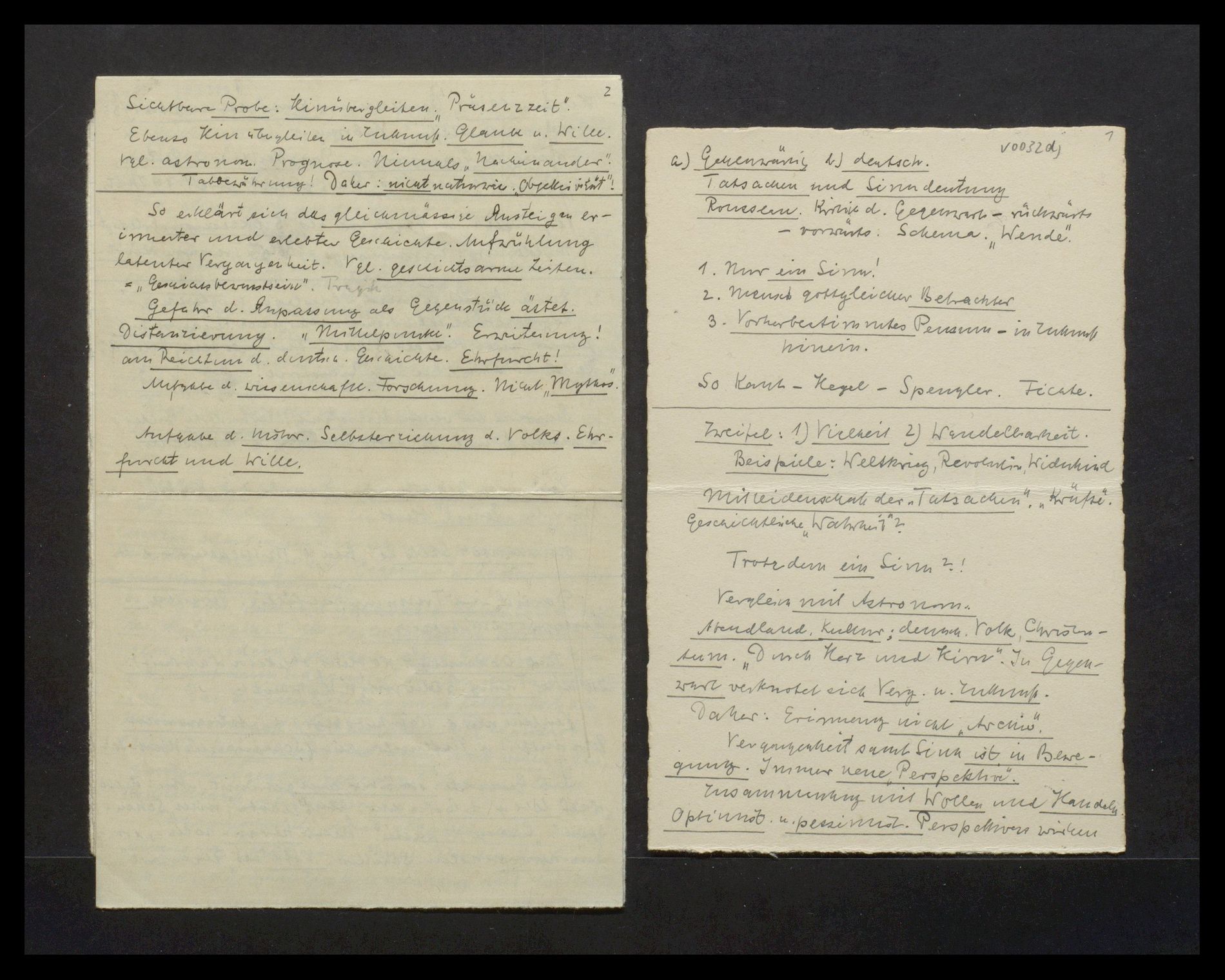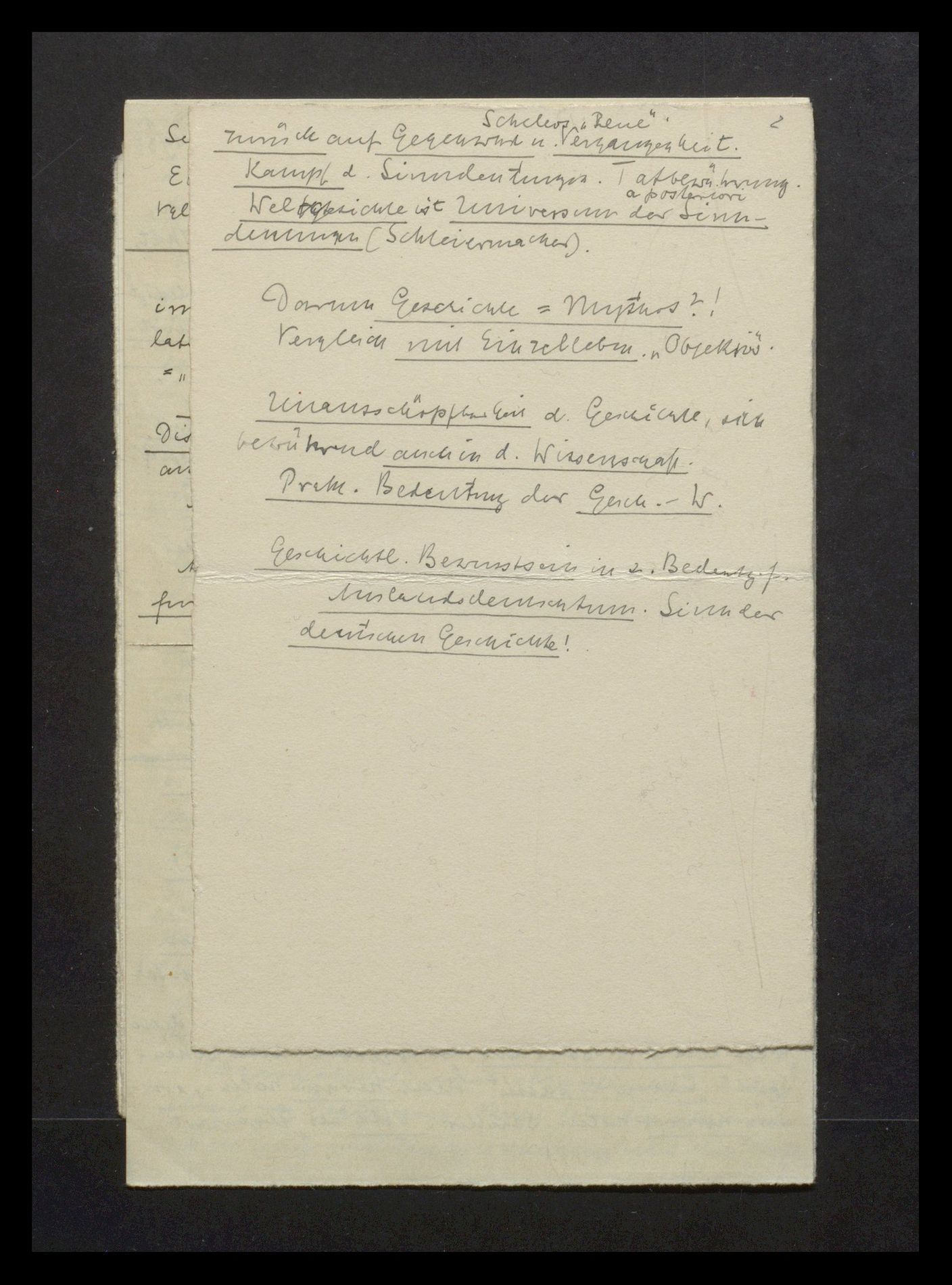| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0032a
1933
Titelseite
Deutsche Geschichte als Erinnerung u. als Gegenwart.
(Düsseldorf 1933)
1
2 Klassen v. Menschen: 1914 voll erwachsen –
noch nicht reif bzw. noch nicht geboren.
Jene erlebten jä wird akut.
1. Erschütterung des menschl. Daseins
2. Nicht Einzelschicksal, sondern gemeinsames
Los
3. Eben damit „geschichtl.“ Erschütterung. Vorher war
„Gemeinsames“ Staatsaktionen
40 Jahre lang Geschichte bloss Hintergrund „priva-
ten“ Daseins. Sicherheit und Berechenbarkeit im
Rahmen des garantierten Ganzen. Z.B. das
Berufslos
1914-1933 ist diese Krisis nicht mehr abge-
rissen. Für die Jüngern der normale Zustand,
für die Älteren die „andere“ Hälfte ihres Daseins.
Vorkriegszeit als die „andere“ Hälfte ihres Daseins
das verlassene Ufer. Dies „Cäsur“, der „Hiatus“ (Ge-
genrate d. Generationen beruht z.T. darauf)
(Verschiedenheit d. Reaktion auf das „Geworfensein“
in diese weltgeschichtl. Situation. Vgl. Goethe bei
Valung: „wir sind dabei gewesen“. Das „andere Ufer“
des anlien règime)
Die Erfahrung jenes « Risses“ ist von umgeheuerer
Bedeutung für das Lebensgefühl. Die Wucht des
„Gegenwärtigen“, an sich ein ewiges Phänomen, ver-
stärkt sich mit d. Dimensionen des gerade Ge-
schehenden. Das Heute als die Sphäre der Not,
der Gefahr, der Entscheidung, des Wagnisses,
auch das „noch nie Dagewesene“, Unvergleichbare
2
im Gegensatz zum Gestern, das dahingegangen ist.
Gemeinsame Not und Entscheidung ins Unge-
wisse hinein. Das Gestern ist erledigt, ist abgetan, ist
schon Geschichte geworden. Dieser Charakter des
Erledigtseins wird verstärkt durch den Charakter ra-
dikaler Andersartigkeit. Vorkriegszeit: das ist
in Lebensumstände und Denken das ganz An-
dere! Nun vollends das 19. Jhdt! Wir fangen
von vorne an, wir lösen uns von dem was hinter
uns liegt, wir
Die dieses „Risses“ der Vorstel-
lung zur , die man sich überhaupt von dem
Verhältnis zw. Verg. und Gegenwart macht. Das
früher Geschehene liegt erledigt, unabänderlich,
abgetan „in unserem Rücken“. Das Volk marschiert
auf einer Strasse weiter, absolviert Stück um Stück sei-
ne . „Gegenwart“ ist immer der Punkt, der
Bahn, auf dem es gerade verweilt; mit der <...>
auch im Rücken liegen wird, d.h. auch „Geschichte
geworden“ sein wird. Gegenwart schliesst sich immer
an die erledigte Geschichte an.
Nur eins dient zur des Gegensatzes:
das Früher ist insofern noch ganz erledigt und ab-
getan, als die „Erinnerung“ zu ihm zurückkehren
kann. Während das Geschehen unaufhaltsam
fortschreitet, ist doch ein Rückblicken gestattet. Das
Geschehene wird im Erinnerungs-„Bilde“ noch einmal
. Geschehene Geschichte bleibt als „erinnerte
3
Geschichte im „Abbild“ erhalten kann zur Erholung, Er-
bauung, viell. Belehrung ins Auge gefasst werden.
Aber der scharfe Schnitt zwischen „Gegenwart“ u.
„Geschichte“ bleibt auch hier erhalten. Er kehrt wieder
Bildhaften
als Trennung des „Erinnerten“ vom „Aktuellen“. +) Natürlich
schiebt sich die Grenze immer weiter vor, aber sie
bleibt als Grenze bestehen! +) Hinwendung zur Geschichte
ist Abwendung v. d. Gegenwart!
Wenn aber gerade die ungeheure Wucht unserer
heutigen „Gegenwart“ diese scharfe Trennung erst recht
zu bestätigen scheint, so zeigt diesselbe Gegenwart uns
auch Phänomene, die diese Trennung Lügen zu
strafen erscheinen. Wenn wirklich die Gegenwart
alles bedeutet, dann müsste die Ge-
genwart uns beanspruchen, die Vergangenheit immer
!“Lutus“!
mehr zurücktreten. „Wir haben keine Zeit“ „unsere Auf-
gaben liegen vor uns.“ So heisst es stellenweise, aber
viel stärker ist ein anderer Trieb, besonders , wo man das Erledigte zugleich ablehnt! Alle
Revolutionen neigen ja dazu, da dem Vergangen auch
in diesem Sinne „den Rücken zuzukehren“. Aber merk-
würdig: viel <....> <....> ist im >Geschehen> d. Ge-
genwart ein andererZug! Die Vergangenheit, die
dort abgelehnt wird, wird hier gesucht; und zwar
gesucht nicht als Gegenstand beschaulicher Versenkung,
der Schaulust, in Abkehr v. <...> Leben, in den Atem-
pausen – sondern im engsten Zusammenhang mit
d. Nöten und Forderungen des Augenblicks. Auch
4
hiess es zu wenig sagen, wollte man es so verstehen,
als solle sie bloss zum „Beispiel“, zur „Paralelle“,
zu Bestätigung dienen. Man die Geschichte
in der Gewissheit, dass sie durchaus nicht abgelegt
im liegt, sondern mit d. Aufgabe d. Stunde
im engst. Zusammenhang steht. Die Reden der
Führer sind an histor. Anblicken, die d. Klä-
rung der Gegenwart dienen sollen, ohne jeden Gedan-
ken einer „Rückwendung“, Abwendg. v. d. Gegen-
wart. Geschichtl. Gesichter u. Ereignisse stehen wie gegen-
wärtig vor uns. Und zwar in der <.... die ...vorge..
u. vorgeste., sondern> bis in die – Prähistorie hinein!
Hier bringt also die Steigerung des geschichtl. Intere
gegenwärt. Erleben eine des geschichtl. In-
teresses mit sich!
Was aaber dieser Zusammenhang eigentlich
bedeutet, macht erst ein weiterer Umstand
deutlich: nich die Steigerung bedeutet nicht
bloss, dass man die Erinnerungsbilder wieder her-
vorholt, aufmerksamer und liebevoller betrachtet
als vorher: die sog. Bilder selbst sind merk-
würdig verändert! Neue Formen u. Lichter!
Widukind, Heinrich d. Löwe, Luther, Friedrich d. Grosse:
Scharnhorst, Bismarck
sie treten nicht nur deutlich hervor, sie werden
auch neu gesehen, mit anderen Augen. Und dies
alles unbeschadet der Identität des „Faktischen“!
Worauf beruht diese Veränderung?
5
Sie beruht zunächst auf veränderter Bewertung:
Widukind als Schützer german. Eigenart, Heinrich d.
Löwe als Initiator deutscher <.... aufgaben> höher
bewertet als ihr Gegner Karl u. Barabarossa. All diese
neue Bewertg. zieht auch das Bild d. Tatsachen in
Mitleidenschaft: die „Kräfte“, die hinter den Fakten
wirksam sind, werden anders gesehen. Es bleibt
bestehen nur das Gerüst der tabellarisch festzu-
legenden Fakten äusserlicher Art.
Frage: ist es nur heute so, dass die Bilder
geschichtl. Erinnerung sich in <.....> wandeln? Es ist
stets so gewesen und wird stets so sein. Jede Ge-
neration sieht die Vergangenheit „mit anderen Augen“.
Z. B. das Bild d. Mittelalters in Aufklärg. u.
Romantik. Das Bild d. mittelalterl. Kaiserpolitik
in d. Romantik u. bei d. Historiker.
Renaissance, Barock.
Angesichts dieser Tatsachen aber wird die Vorstel-
lung jener Trennung zwischen Gegenwart und
erinner. Geschichte unhaltbar. Die erinnerte
Geschichte ist nicht erledigt im Sinne des Fertig-
„Vergegenwärtigung“
seins: sie wird in die Bewegg. d. Gegenwart hinein-
gezogen – unbeschadet des Beharrens der „Fakten“.
Und es bleibt nur die Frage: wenn es tatsächl.
so ist, ist es so auch „in d. Ordnung“? Oder wird
nicht die geschichtl. Erinnerung durch diese Verbindg.
Objektivität
ihrer Wahrheit beraubt?Es dürfte doch eigentlich,
„objektive“
so meint man, nur ein einziges „wahres“ Bild der
Geschichte geben. Wenn statt dessen die Bilder schwan-
ken u. sich wandeln, so erweckt das doch den „histo-
6
rischen Skeptizismus“. die Trenng
v. Gegenwart u. Geschichte wiederherstellen, damit
es wieder geschichtl. „Wahrheit“ gebe? Hängt nicht
die Wahrheit u. Objektivität d. geschichtl. Bildes
von d. Innehaltung dies. Trenng ab?
Es ist zu zeigen, dass diese Forderung auf
einen „Wahrheits“begriff beruht, der nur in einer
bestiment. Erkenntnis <...> berechtigt ist, der
aber gegenw. d. Geschichte versagt. Vergleichen wir
d. Wahrheitsbegriff des Naturforschers – etwa des <...-
...>. Er kann uns über die „Vergangenheit“ etwa
d. Bewegg. eines Gestrins mit „objektiver“ Exaktheit
aufklären. Er erforscht in d. Haltung des theoret.
Betrachtens eine Welt v. Vorgängern, die, ihm als
Gewalt d. Gegenwart erweckt investierte Ver-
„Gegenstand“ gegenübersteht. Es ist ein „Schau-
gangenheit
Spiel“, das er denkend analysiert. Er ist nicht
tätig an ihm beteiligt, kann nicht eingreifen u.
abwandeln. Der Planet, auf dem er steht, ist ja
selbst in dies Schauspiel einbezogen. Die „Objektivi-
tät“ d. Erkenntnis ist gebunden an dieser Getrennt-
heit u. : es ist wirklich „reine“ Be-
trachtung. „Ich“ und „Nicht-Ich“.
Wie aber in d. Geschichte? Scheinbar ist ja auch
hier d. Betrachter v. d. betrachteten Vergangenheit
ähnlich getrennt, auch ihr steht er „gegenüber“.
Aber dieses Gegenüberstellen gilt doch menschlich
sehr eingeschränkten Sinne. Tieferem Nachdenken
kann es nicht verborgen bleiben, dass die „Welt“, der
sich die geschichtl. Erinnerung zuwendet, in dem Trä-
7
ger die. Erinnerg. selbst lebendig
aber ihr Werk lebt in mir, d. Betrachter, fort. Ver-
gangenheit ist in d. Gegenwart , liegt
keineswegs im Rücken, ist auch nicht bloss „Schau-
Spiel“. Jeder ist, ob er es weiss oder
nicht, geladen mit Geschichte. Antike, Christen-
tum, Germanen, <....>, Reformen, Auf-
klärung usw. In mir tun sich Abgründe auf.
Was mir in geschichtl. Erinnerg. „gegenüber“ , das
lebt in mir als aufgespeicherte Vergangenheit. +) Das
„Nicht-Ich“ ist zugleich mein Ich. Oder f. das
Gesamt-Ich Volk: die Vergangenheit, die es
sich erinnert, „vergegenwärtigt“, lebt in ihm selber
als gegenwärtigstes Sein. Wie d. Astro-
nom!
Die sichtbarste Probe auf diese Zusammen-
gehörigkeit des angeblich getrennten: das bruch-
lose Hinübergehen der erinnerten in die gegen-
wärtig werdend, durch uns werdende Gegenwart.
Wo ist die Grenze d. „Gegebwart“? Begriff der
„Präsenzzeit“.
Und wie diese Gegenwart nach rückwärts hin nicht
v. d. Vergangenheit abzutrennen ist, so nach vor-
<...>. sie sachlich sich nicht äusserlich an!
wärts hin nicht v. d. Zukunft. Als Geschichte
schaffende Wesen leben wir <....> in die Zukunft
+) Schiller in seiner Antrittsrede! Die Erinnerung holt nicht et-
was aus d. (zeitl.) Ferne heraus,
sondern aus d. Innern hervor!
8
„d rückwärts gewandte Prophet“!
hinein. Wille! Und selbst dies Zukunftsbewusstsein,
Tatbewährung d. Deutung! Vgl. Astron. Prognose
ist mitbestimmend f. d. angeblich
u. Vergangenheit. >Geschichts...> wie: Christentum,
abendländ. <....>, deutsches Volk, leben durch
und, die Gegenwärtigen, in die Zukunft hinein,
uns Wille ist ihr Träger (wie anders der Astro-
nom) In Gegenwart sich Vergangenheit
u. Zukunft>, überwindet sich das blosse Nacheinander.
Um dieses <... Verein..g> wirken darf man
histor. „Wahrheit“ nicht an d. Objektivitätsan-
spruch der Naturwissenschaft messen. Sie ist
nicht „Gegenstands“erforschg., <...> „Selbstbesinnung“
der grossen histor. Subjekte. Selbstbesinnung des
Volks, „Vergegenwärtigung“
Und nund auch alle
an dem Umstand, dass nur v. mächtige <...zu> beanspruchte Zeit <....> die
Vergangenheit vernachlässigt, sondern erst recht sucht.
Das mächtige Erbe d. Gegenwart
ist zugleich Aufwühlung der in uns lebendig
aufbewahrten Vergangenheit. Ein Das Schicksal
stösst durch bis in unser tiefsten Wesensgründe.
Erlebete und erinnerte. wachsen mit-
einander an Intensität: bis zu
<....> hinein erhellt sie das scheinbar Ver-
gessene. Geschichtsarme Zeiten kennen diese nicht: ihnen ist die Vergangenheit stumm,
weil ihre Gegenwart arm ist. Z.B. „Zeiten d. Glücks“
9
sind in dies. doppelten Sinn „geschichtsarm“.
Tragödie des geschichtl. Menschseins öffnet die
Tiefen d. Geschichte. Die . alle Mächte d. Vergangen-
heit <....> auf, wenn die Gegenwart zur
wird.
Geschicht. Bewusstsein ist an d.
lebendig werdende Geschichte, ist selbst
Geschichte, nicht bildhaftes „Schauspiel“.
Freilich: nicht blind sein f. d.
u. dieses Zusammenhangs. Wir warnten
vor d. falschen Trenng des Vergangenen: das
ist ästhet. Geschichtsgenuss, ist „Historis-
mus“ im schlech Sinne. Wo man aber
engste Verbindung mit d. Gegenwart sucht,
da droht d. <.....> Fehler: statt
die Vergangenheit m. d. Gegenwart zu verbinden,
<....> man sie in die Gegenwart auf. Ver-
gangenheit wird nur durch die
„Daten“, aber das Leben u. Streben wird dem
d. Gegenwart als Vorspiel, <....>, Be-
weismaterial angeglichen. Das heisst ,
die geschichtl. Wahrheit in einem anderen
Sinne verfehlen. Herder: „ in
10
sich selber“ Ranke „unmittelbar zu Gott“. Das
war damals Protest gegen die <.....sie-
rg> d. Vergangenheit d. e. Aufklärung. Heute
als Warnung vor d. <....> d. Ver-
gangenheit durch Angleichung. Und
dies ist mehr als theoret. Verstoss: un-
ter Stärkung und Erweiterung an d. Geschichte
hängt davon ab, dass sie wirklich „Begeg-
Einfühlen
nung“ mit einem Eigenleben ist! Reichtum
deutschen Lebens soll in d. Geschichte nicht
durch Angleichung verkürzt werden.
Ehrfurcht vor d. Mühen d. Väter!
Nur so lebt echte Tradition in uns fort. |=
Hier liegen die Aufgaben der wissenschaftl.
Forschung, die von den „objektiven“ Daten her
sich in das Eigenleben d. Epochen verarbeitet!
Nicht „Mythos“! (Lessing)
Zu S. 9 Barbarossa u.
Karl in den <....> des
20. Jhdts. planen u. wirken?
Das religiöse <.... Luther>
dem unsrigen ?
Schulmeisterei der Heutigen
11
Auch wir Heutigen sind nach uns.
Gesetz angetreten u. wolen v. d.
kommenden Geschlechtern nach ihn
<....> sein!
|= Rassenmythologie als ungerechtfertigte
Simplifizierung und Monolonisierung
des geschichtl. Reichtums.
Zu S. 7/8. Das, was war und wurde, beur-
teile ich nicht ohne Rücksicht auf das, was
es heute ist, nicht ohne Rücksicht auf
das, was aus ihm werden wird bzw. (durch
mich) werden soll!
V 0032b
1
Sinn der Geschichte.
Spezifisch gegenwärtige und spezifisch deutsche
Frage. Scheinbare Sinnlosigkeit d. Gegenwart und d.
deutsch. Gesamtschicksals. Andere fragen mach d. „Sinn
d. Lebens“, d. „menschl. Daseins“ u.ä.
Unterschiede zwischen dem Tatsachenbestand d. Ge-
schichte u. d. „Sinndeutung“. Scheinbar getrennte Über-
legungen. Historie u. Geschichtsphilosophie.
Beginn d. Fragestellung seit Roussau (Voraussetzg.:
die christl.-transcendente Deutung ist fraglich ge-
worden) Schon hier ist d. Zweifel an Sinn u. Wert, die
Voraussetzung. Man geht aus von d. angezweifelten
Gegenwart und fragt zurück nach d. Vergangenheit.
Woher der .? Aber sogleich auch Blick auf
die noch nicht „Geschichte“!
Zukunft. Wie der ? Das dreigliedrige Sche-
ma entsteht, in dem immer die Gegenwart die
„Wende“, d. Knotenpunkt bedeutet. „Krisenbewusst-
sein“ als Grundlage. Wie stark ist es heute!
Schon hier zwei grundlegende Befunde: 1) Es
gibt nur einen Gesamtsinn, einen „Text“ zu
enträtseln. Er ist darin Gott gleich. Freilich: nur
Spengler.
der durch tieferes Wissen bevorzugte Mensch. Die Mas-
se verwirklicht durch ihr Tun den Sinn, ohne ihn
zu wissen. Vergleich der einen Satz stellenden Men-
schen. 3) der Sinn ist vorherbestimmt und ist ein
abzuarbeitendes „Pensum“, Programm! Entweder
göttliche Bestimmung oder Kausale bzw. logische Not-
wendigkeit. Die Zukunft gehört hinzu!
Diese Grundzüge kehren in d. Reihe d. Geschichts-
deuter immer wieder. V. |