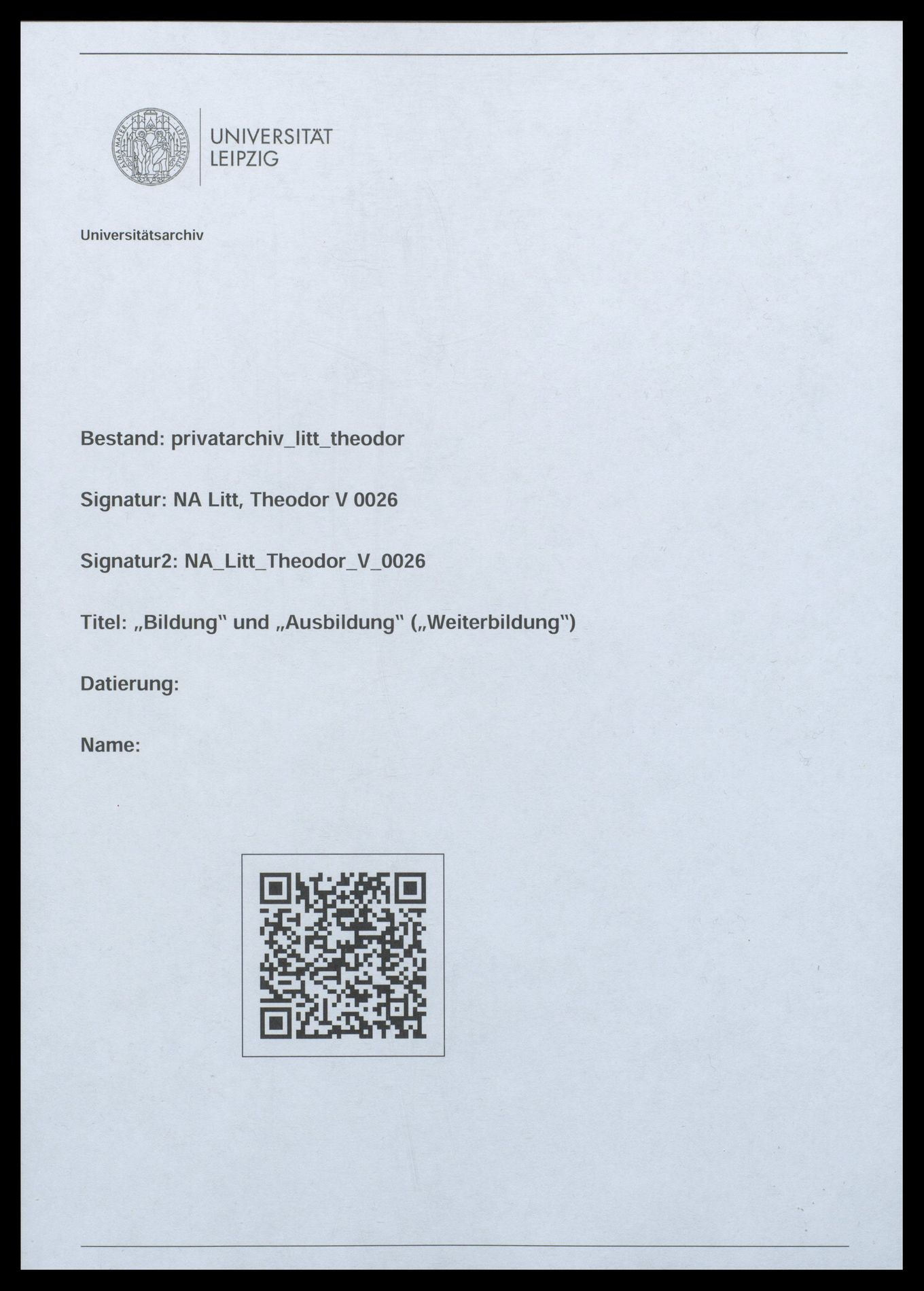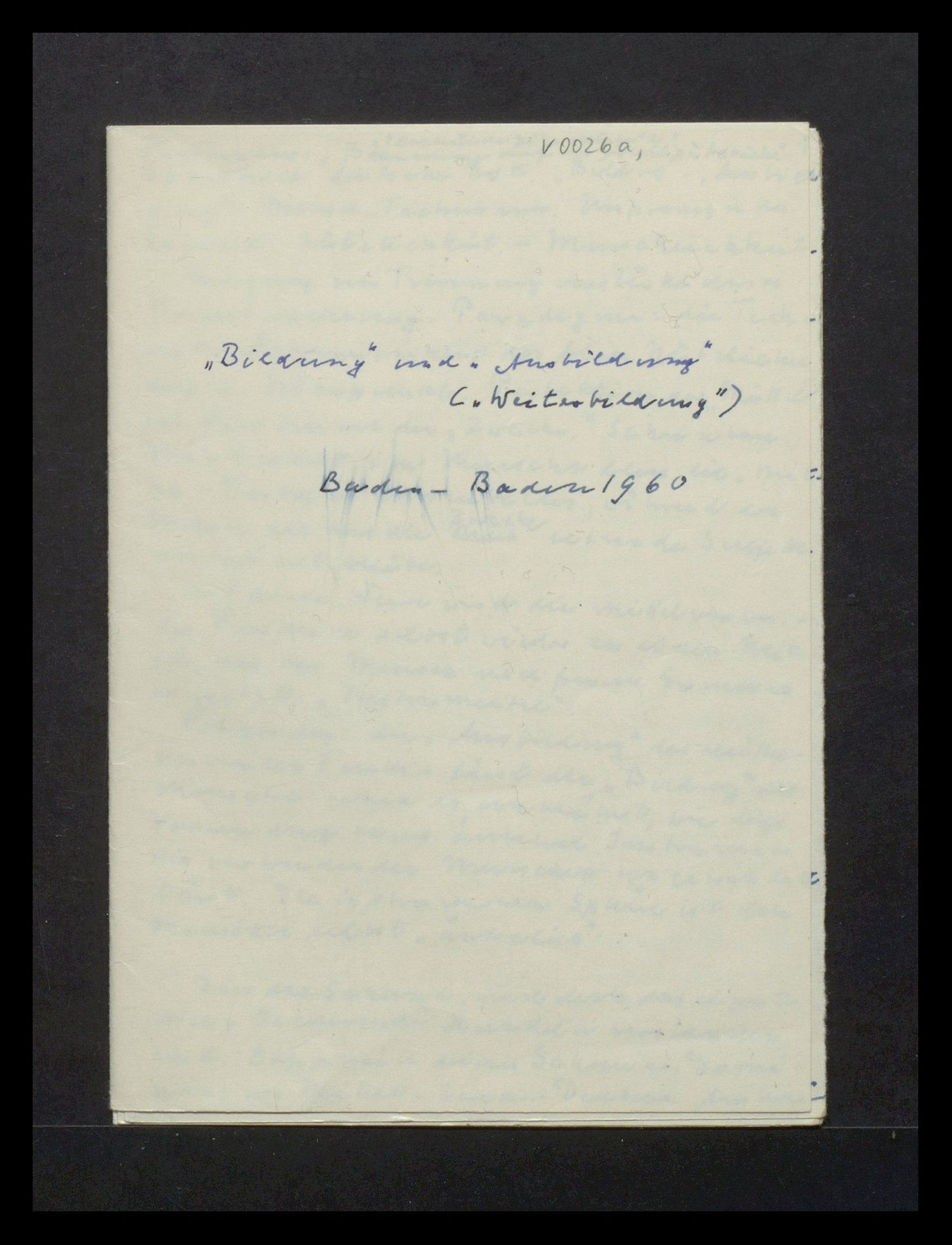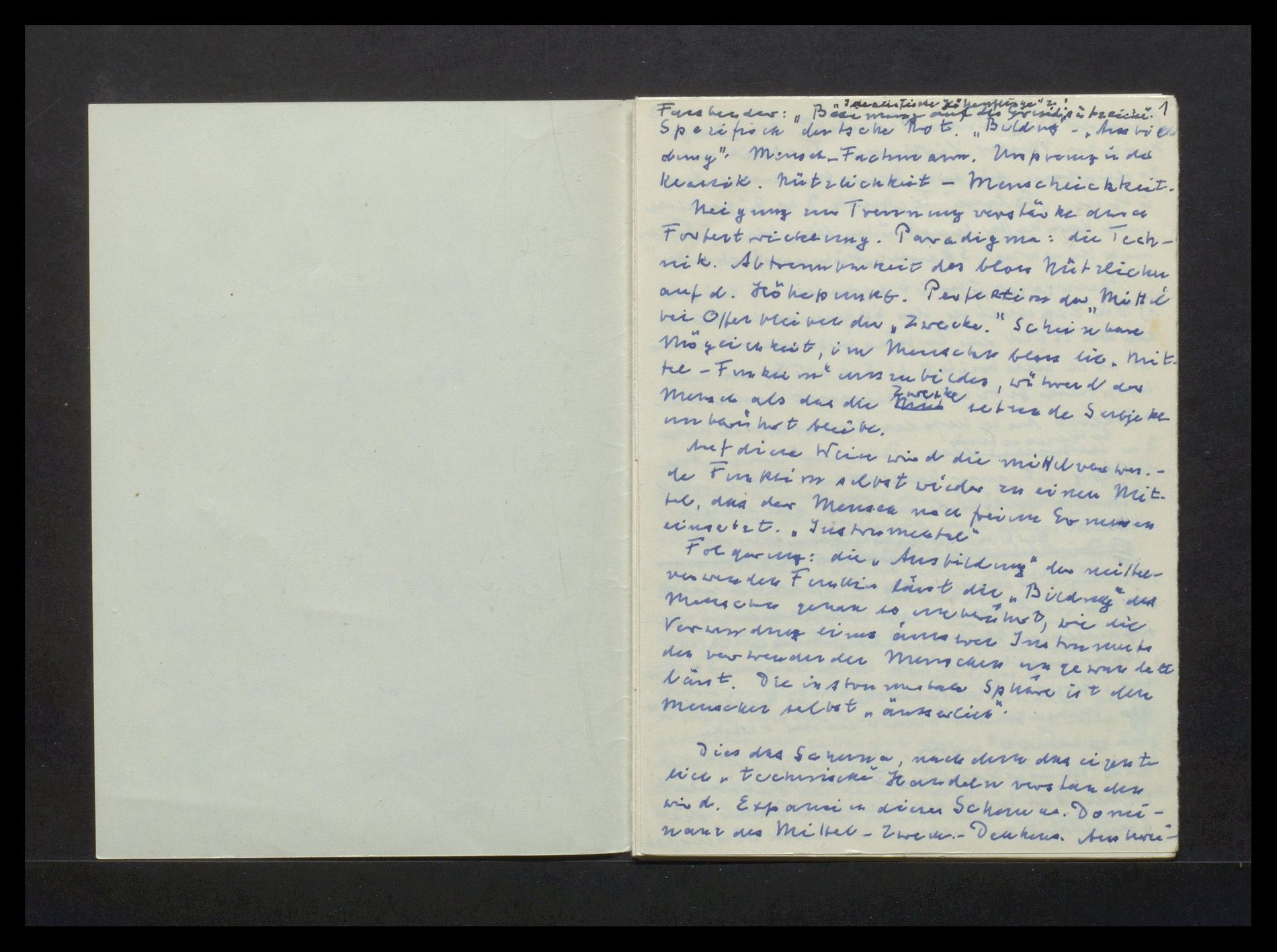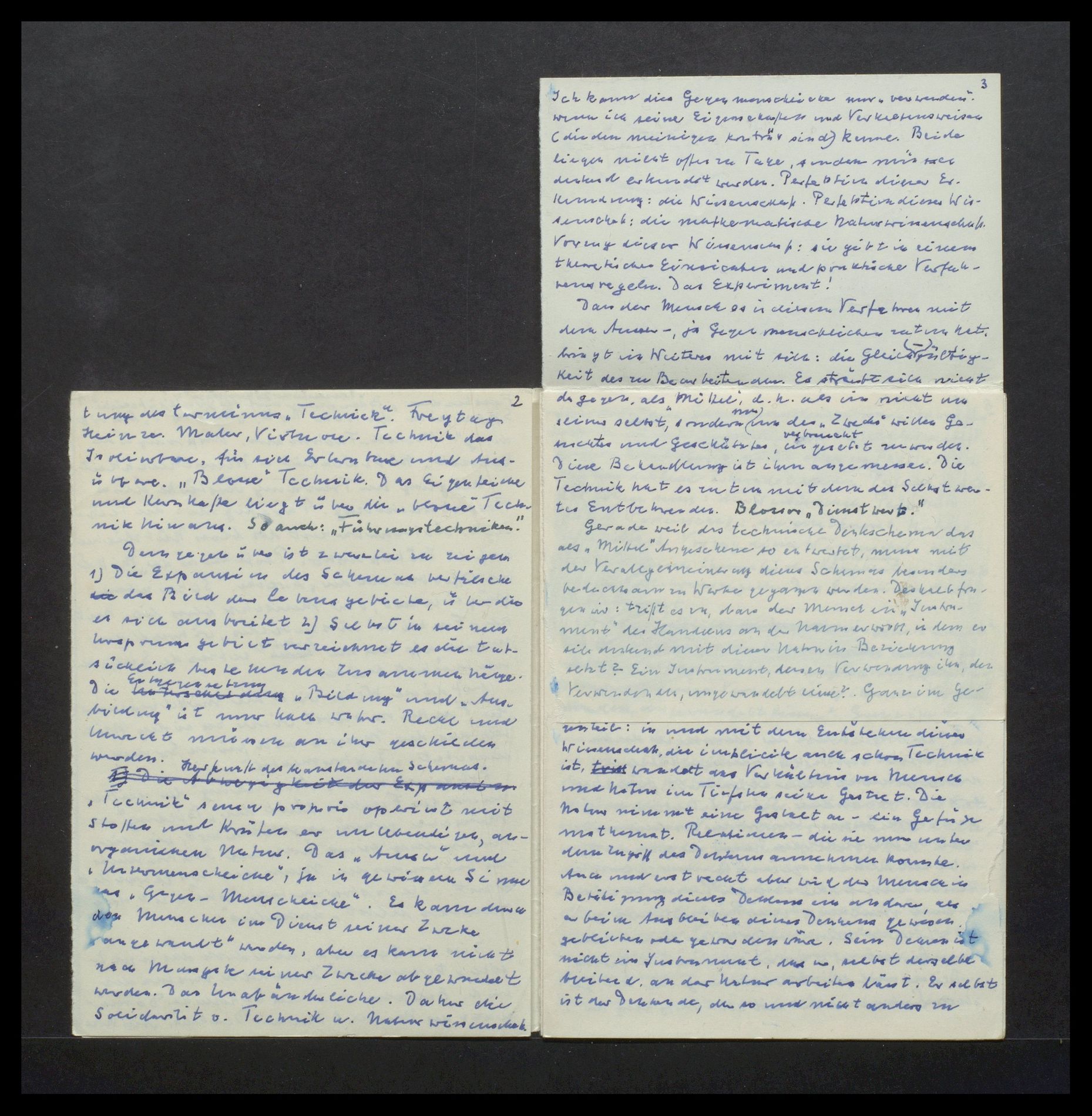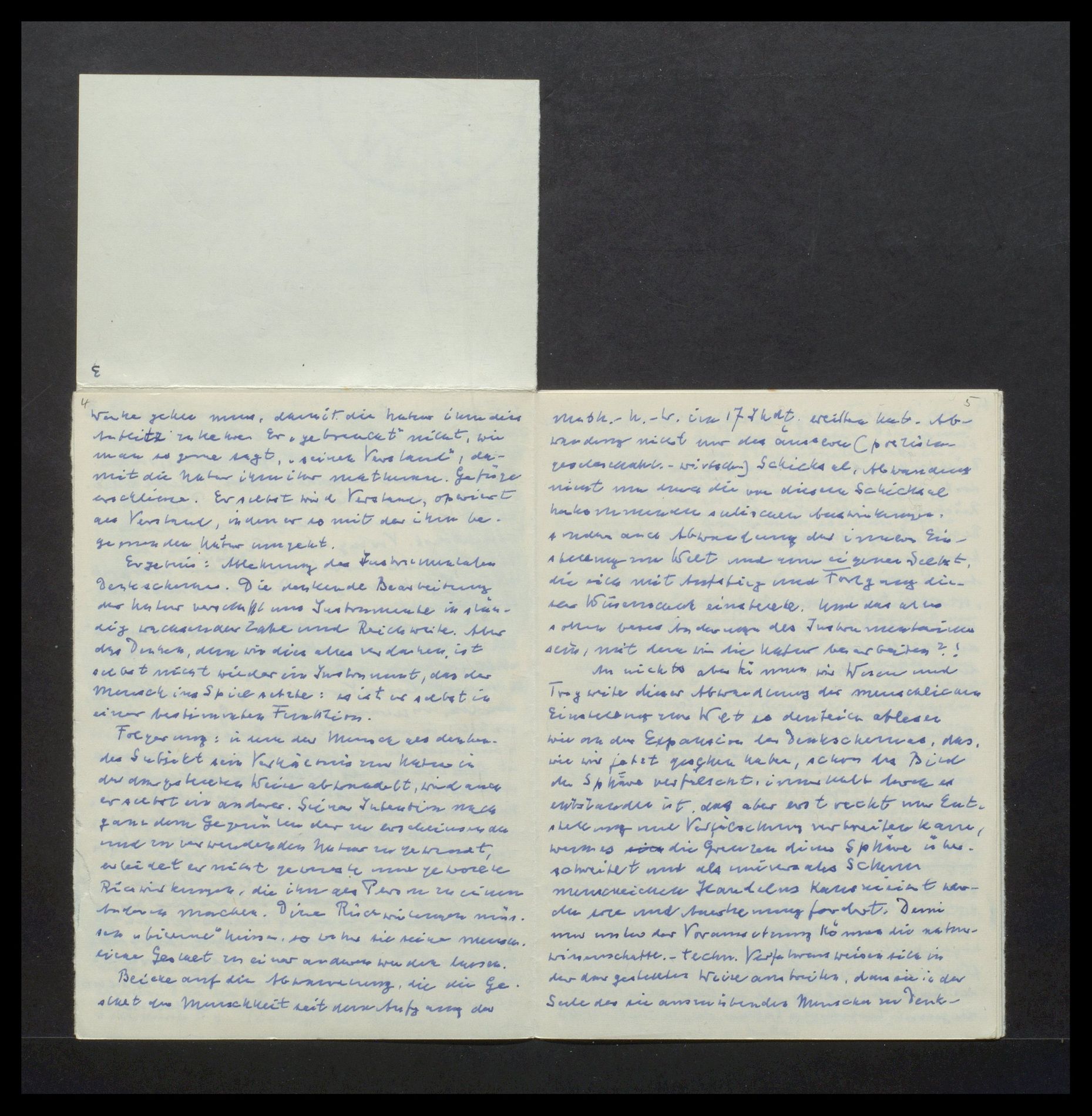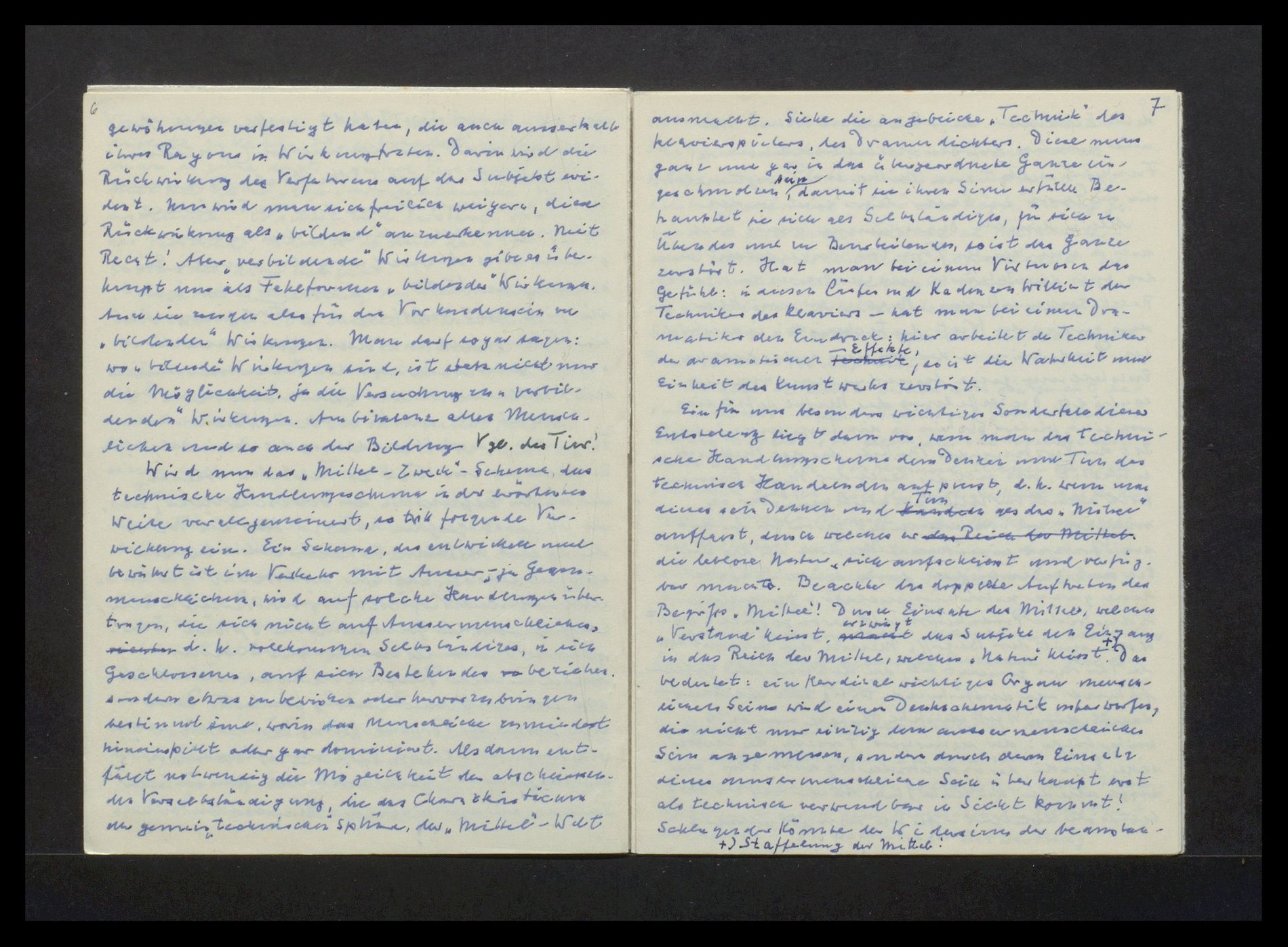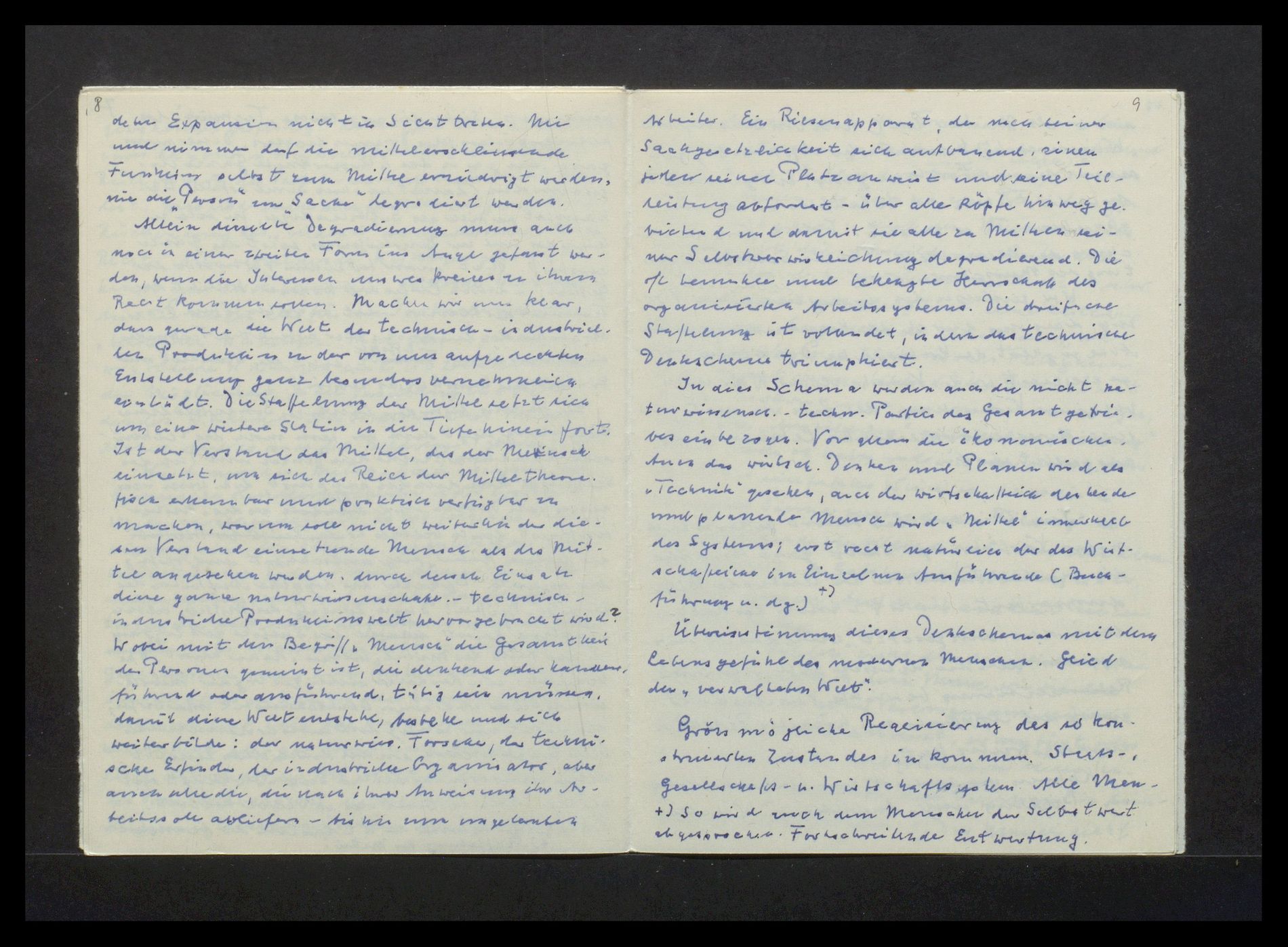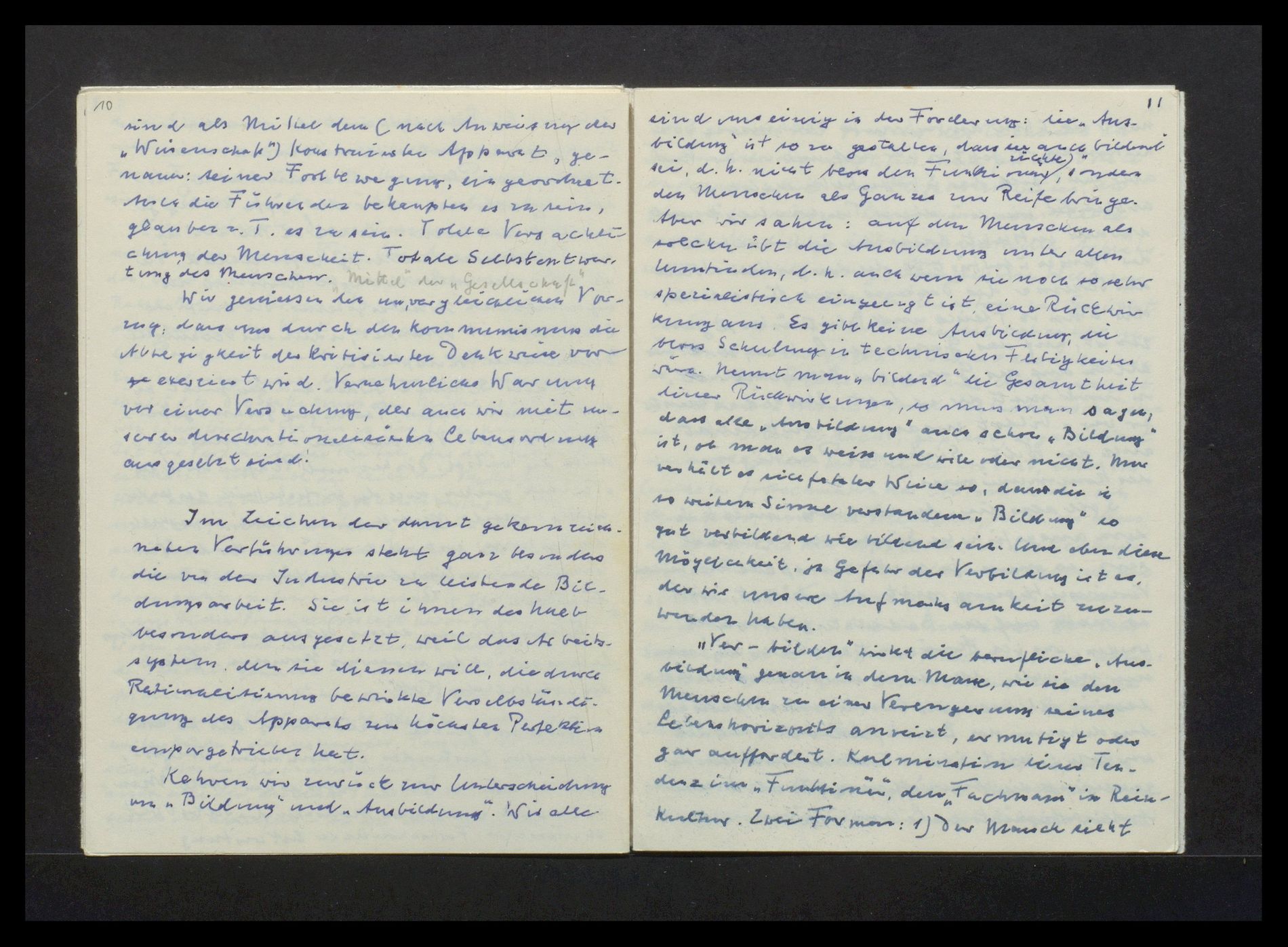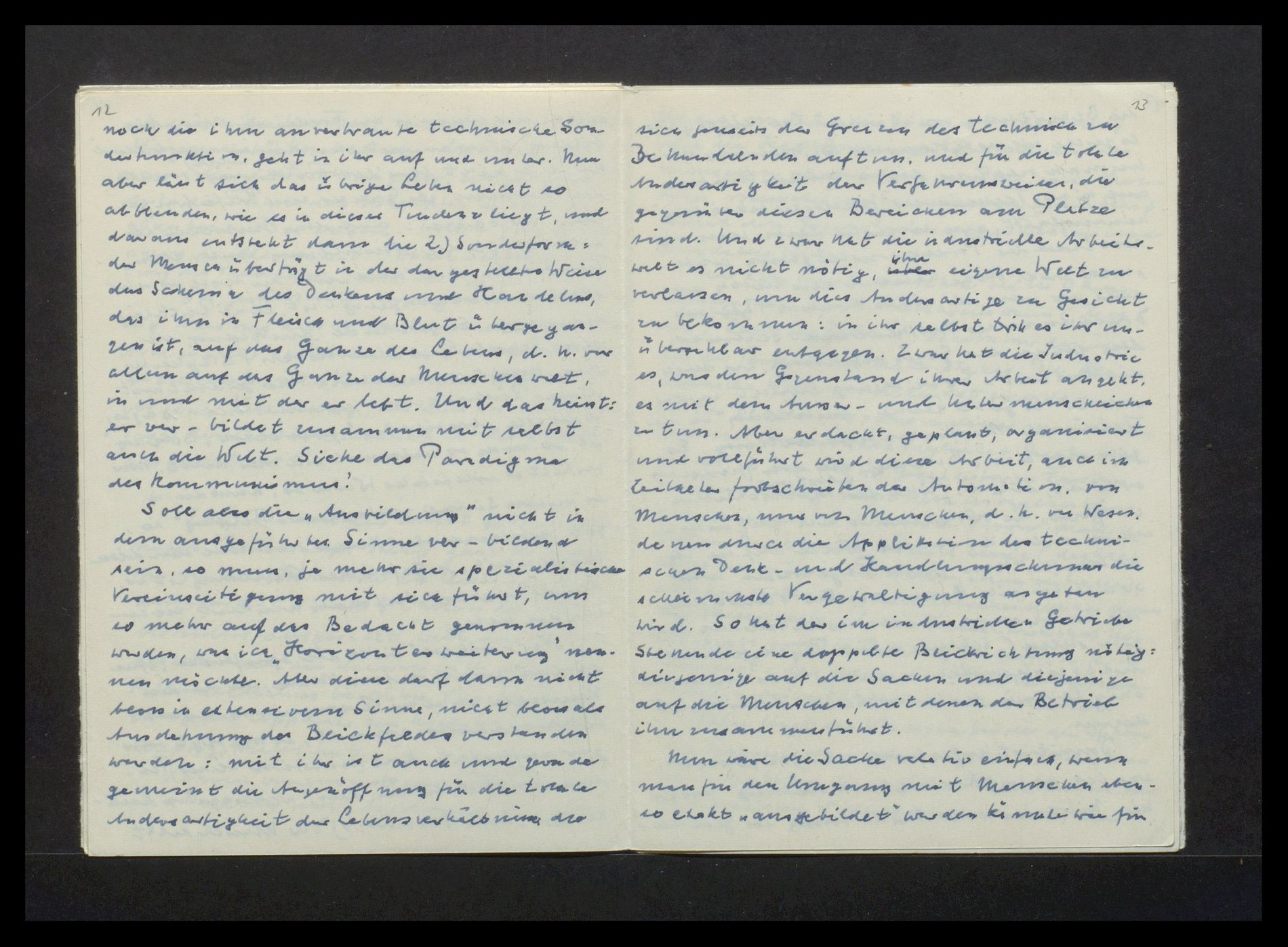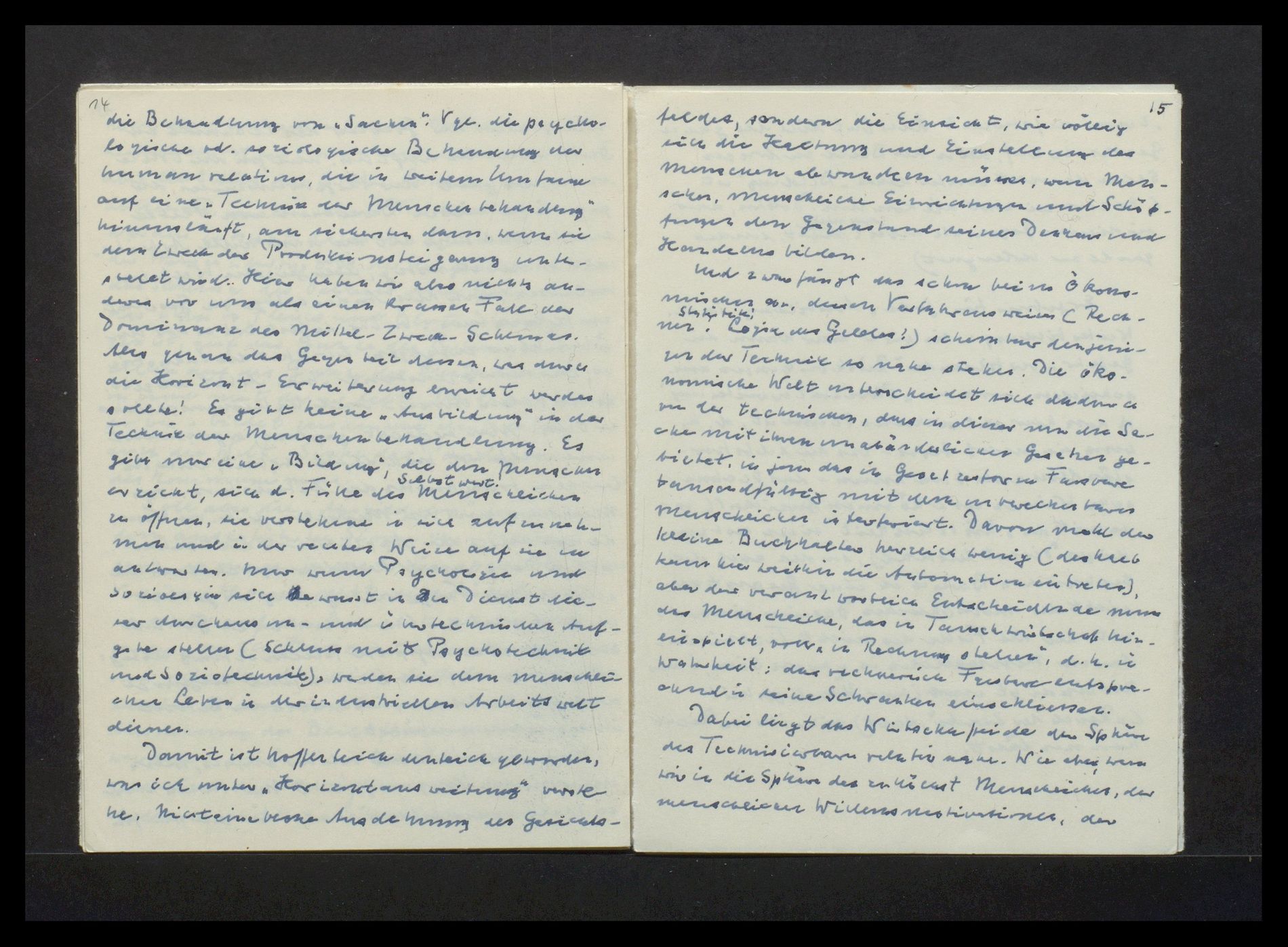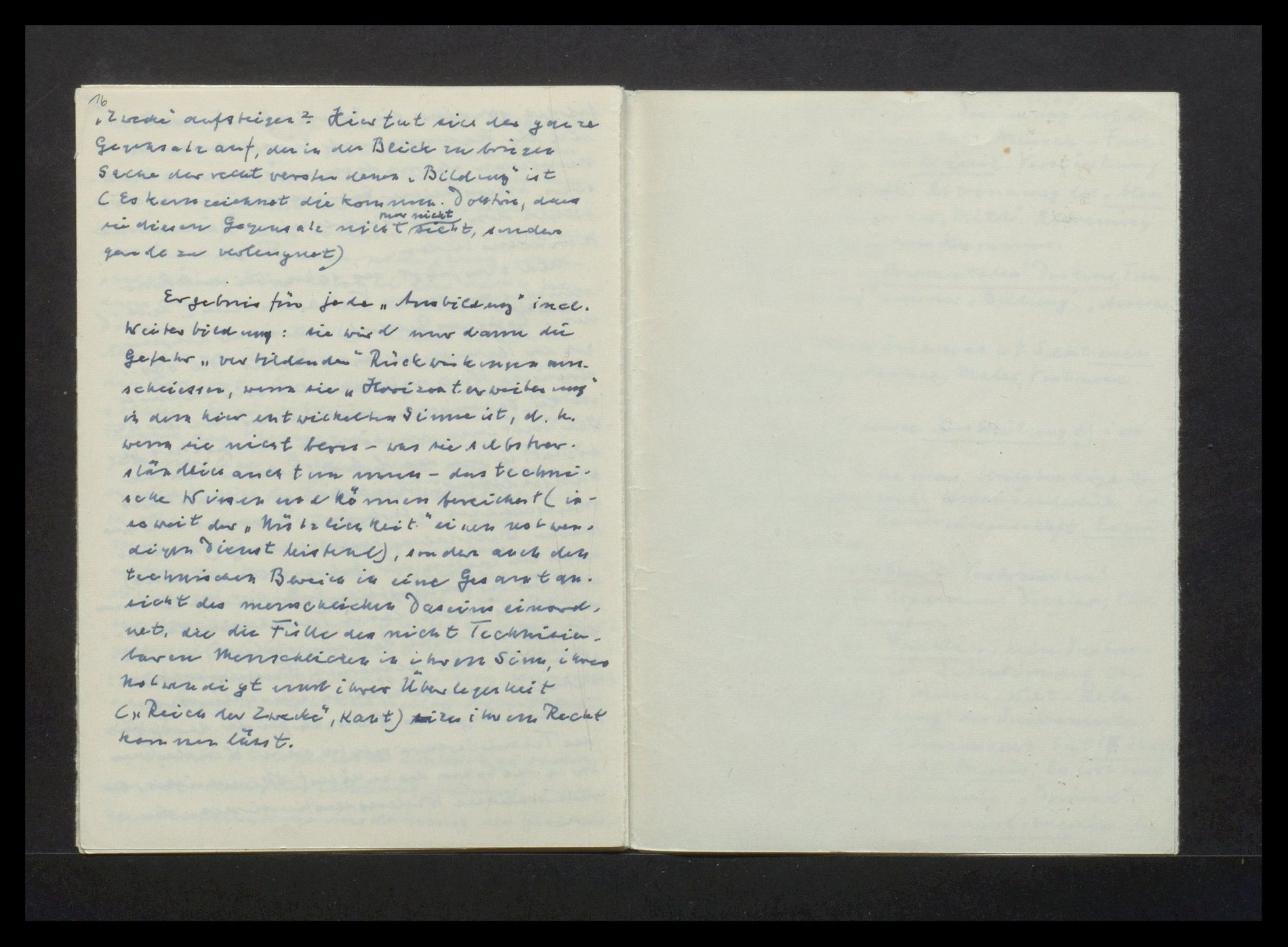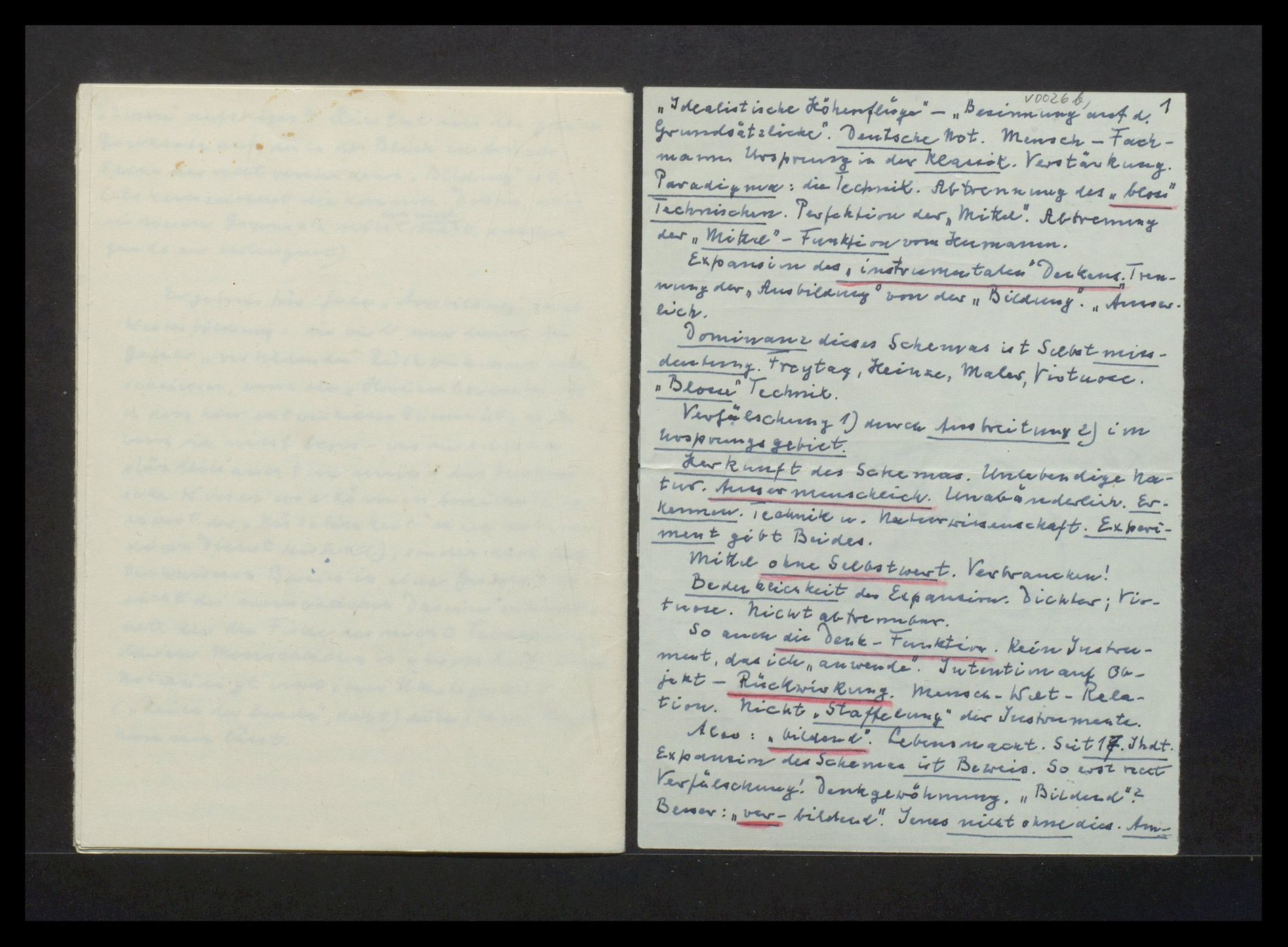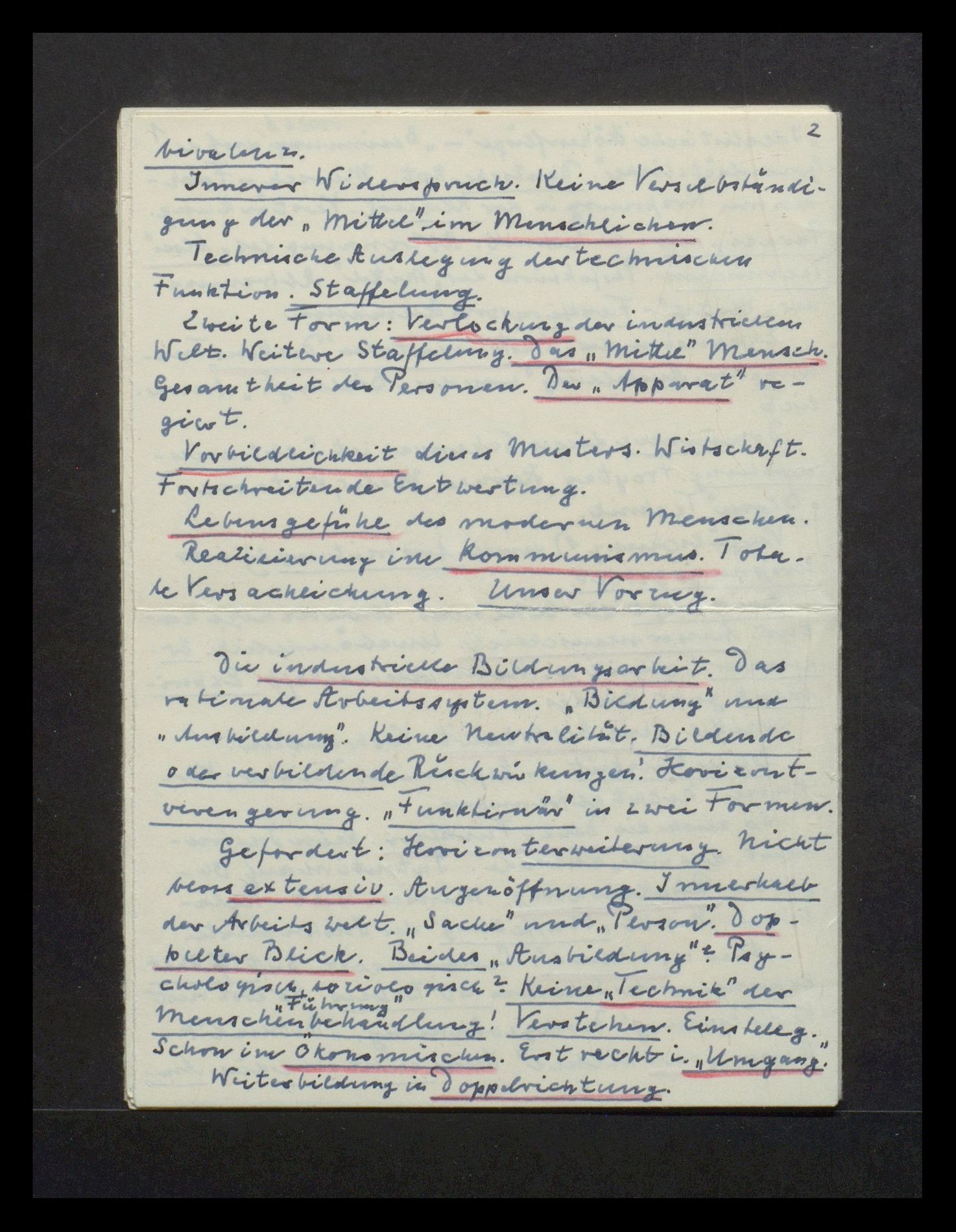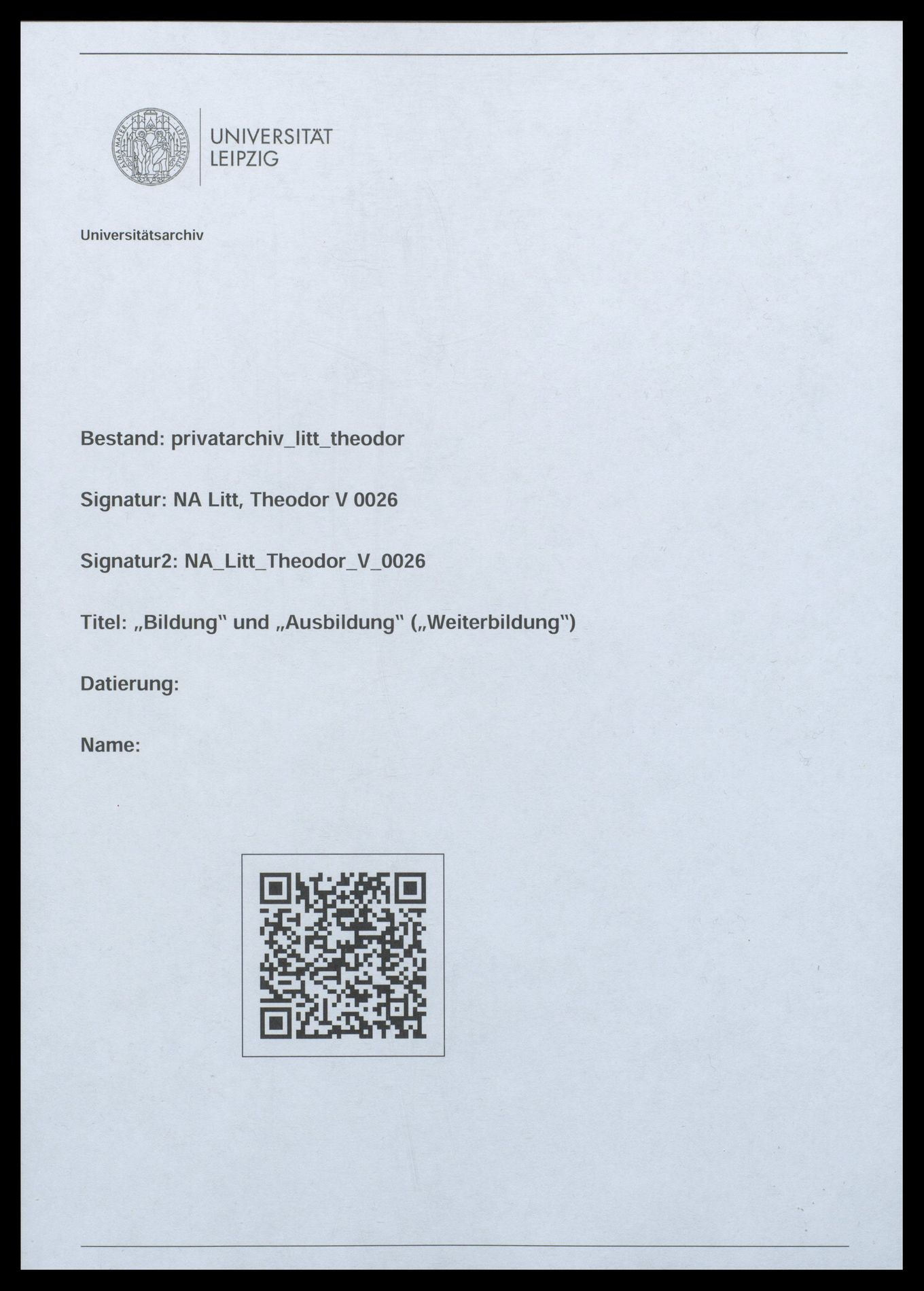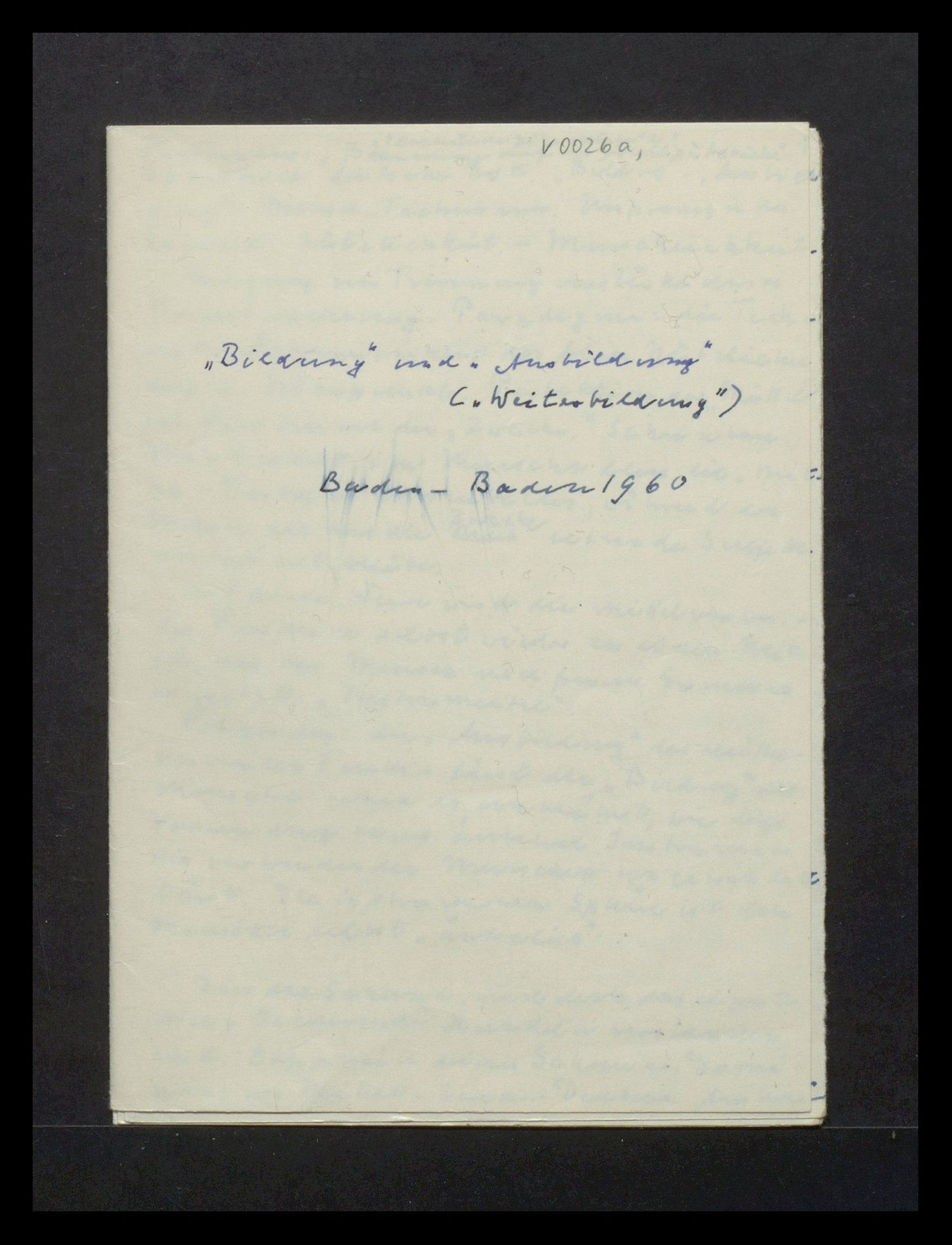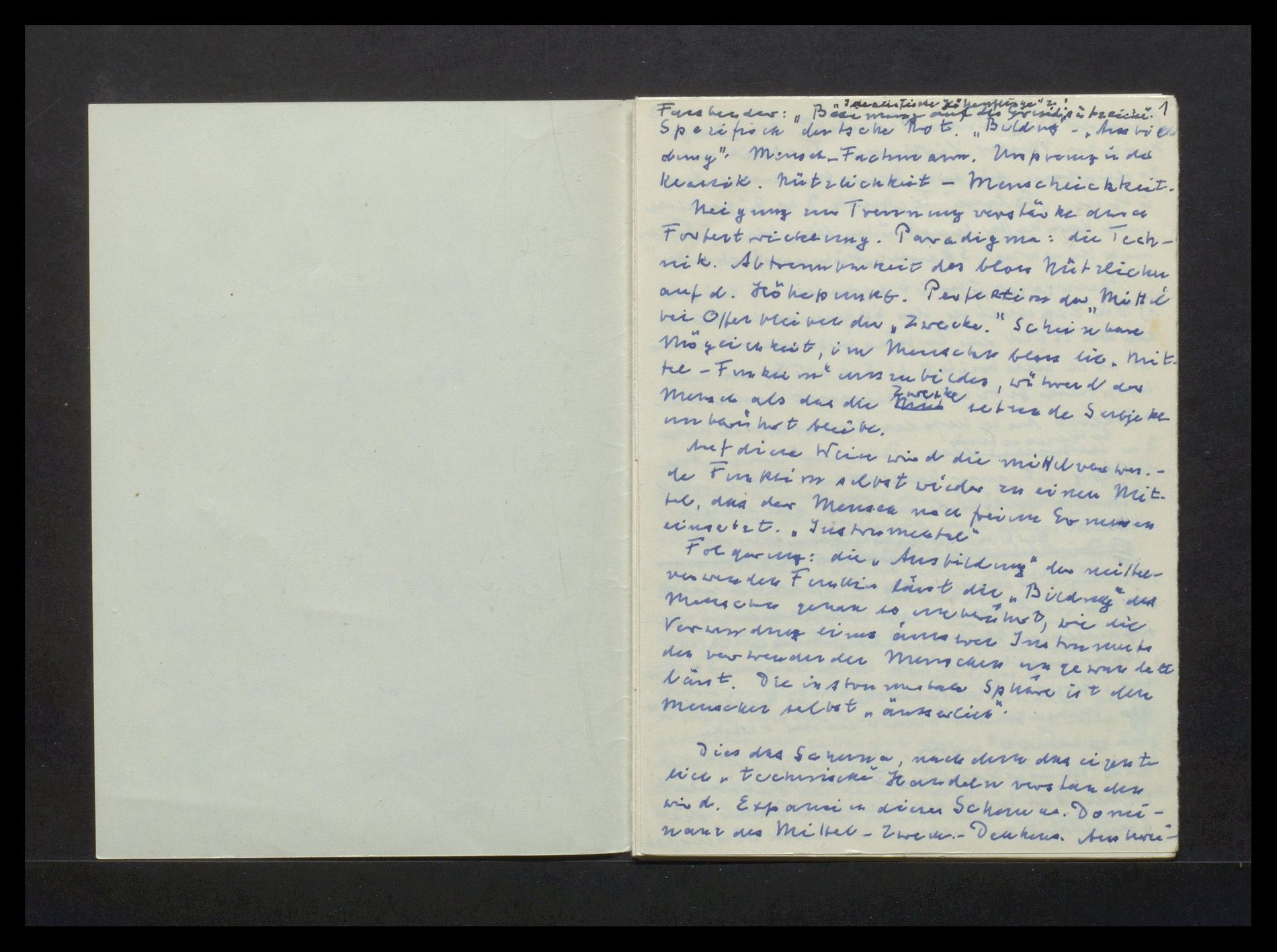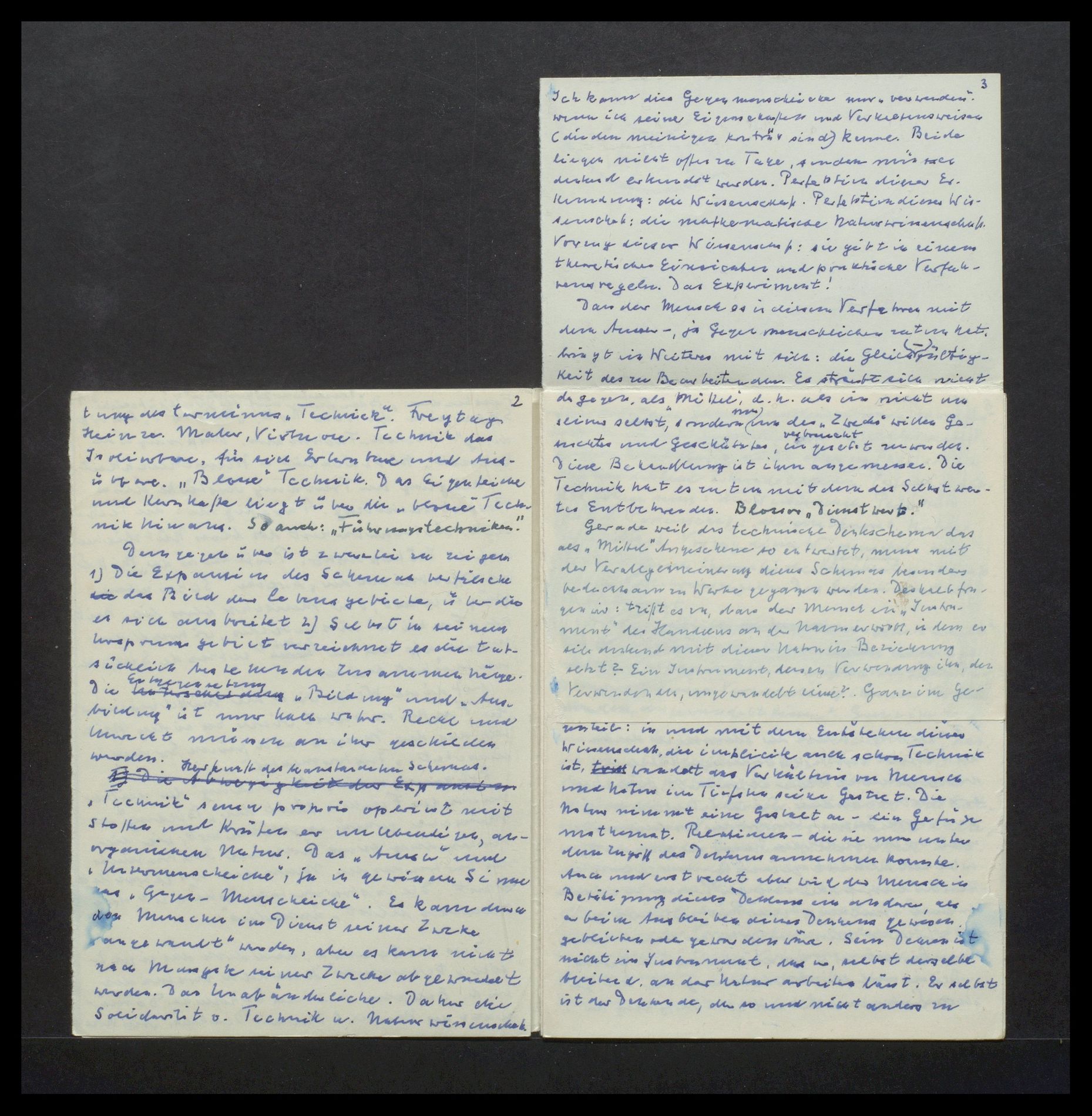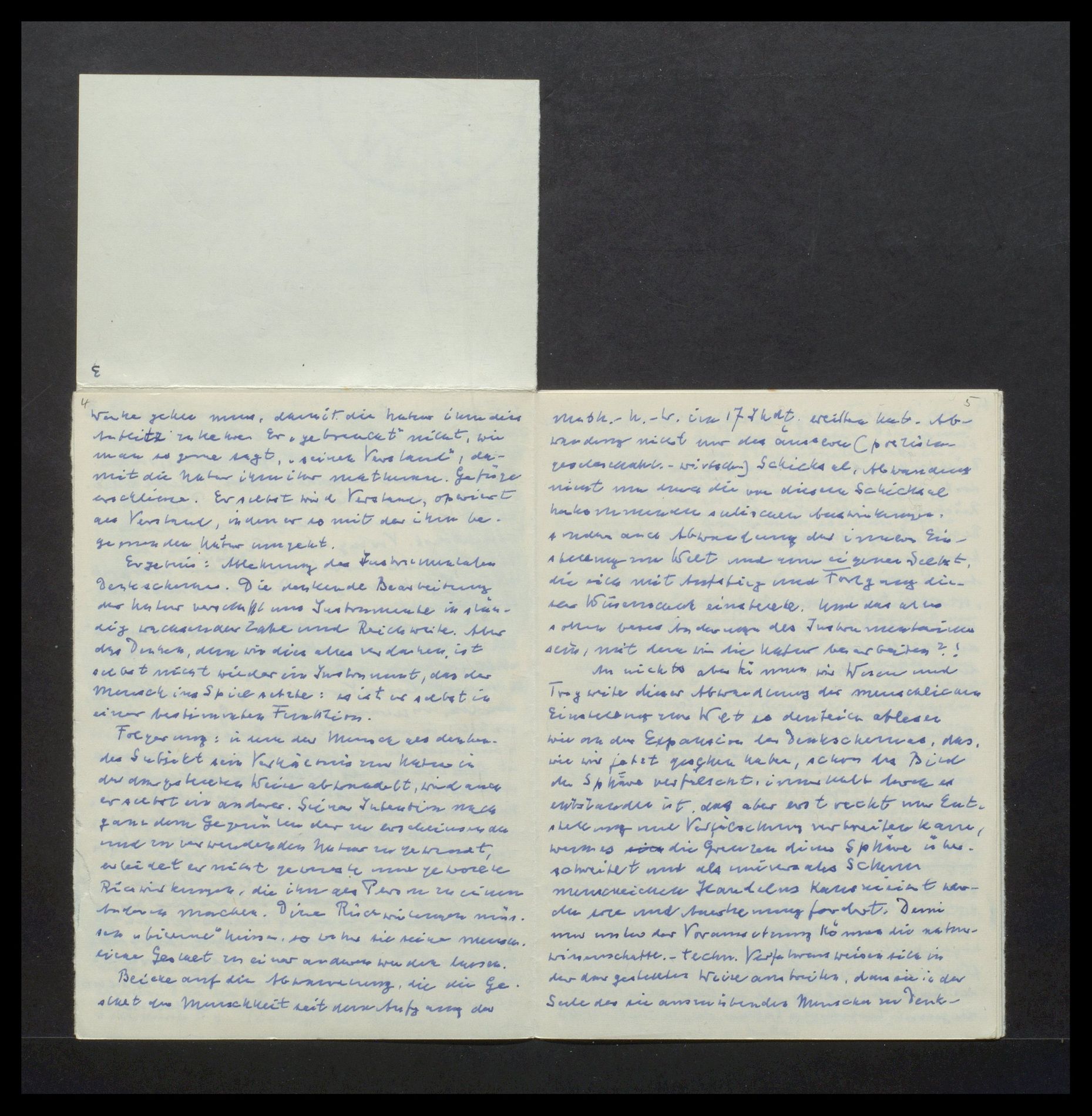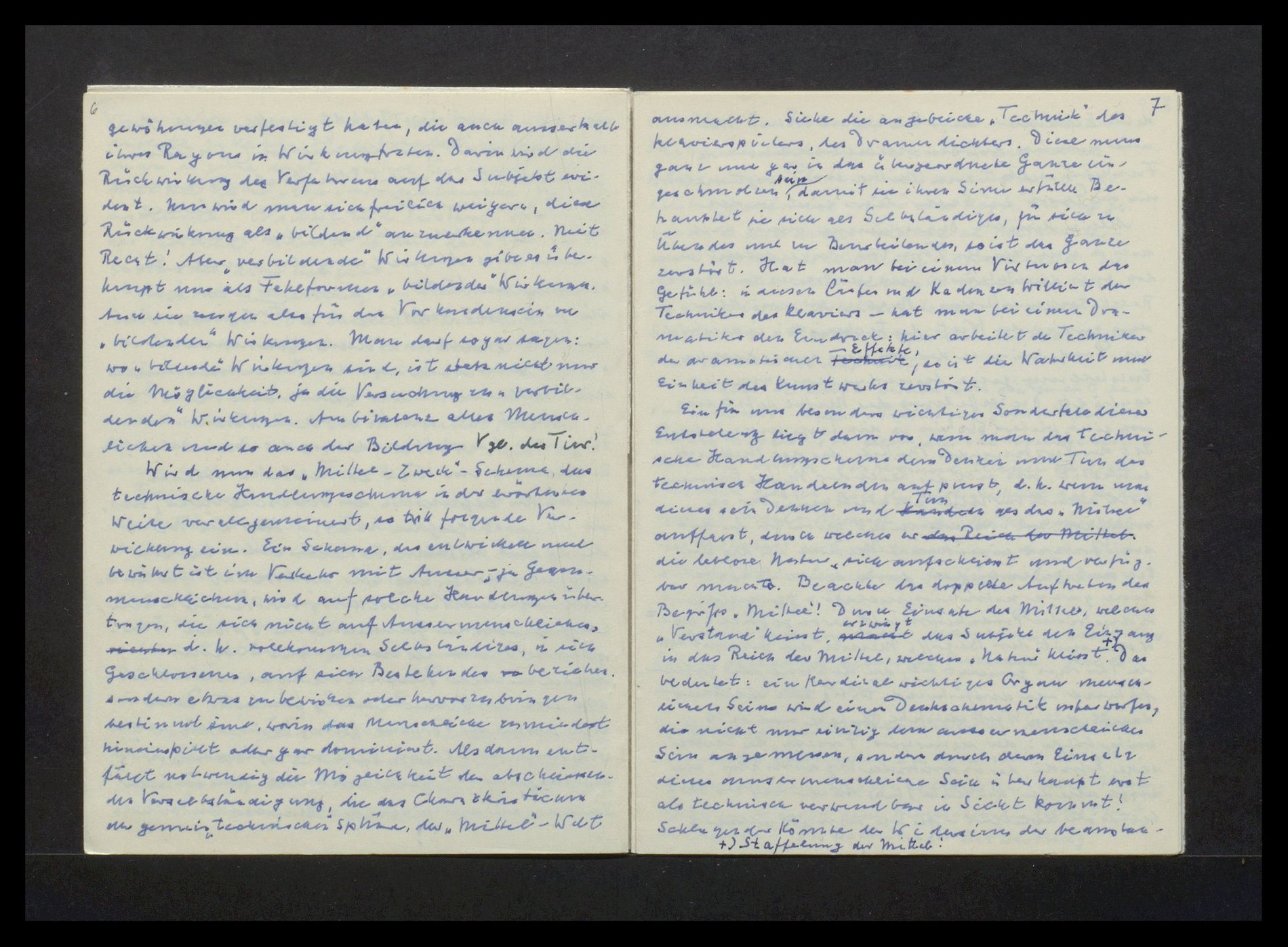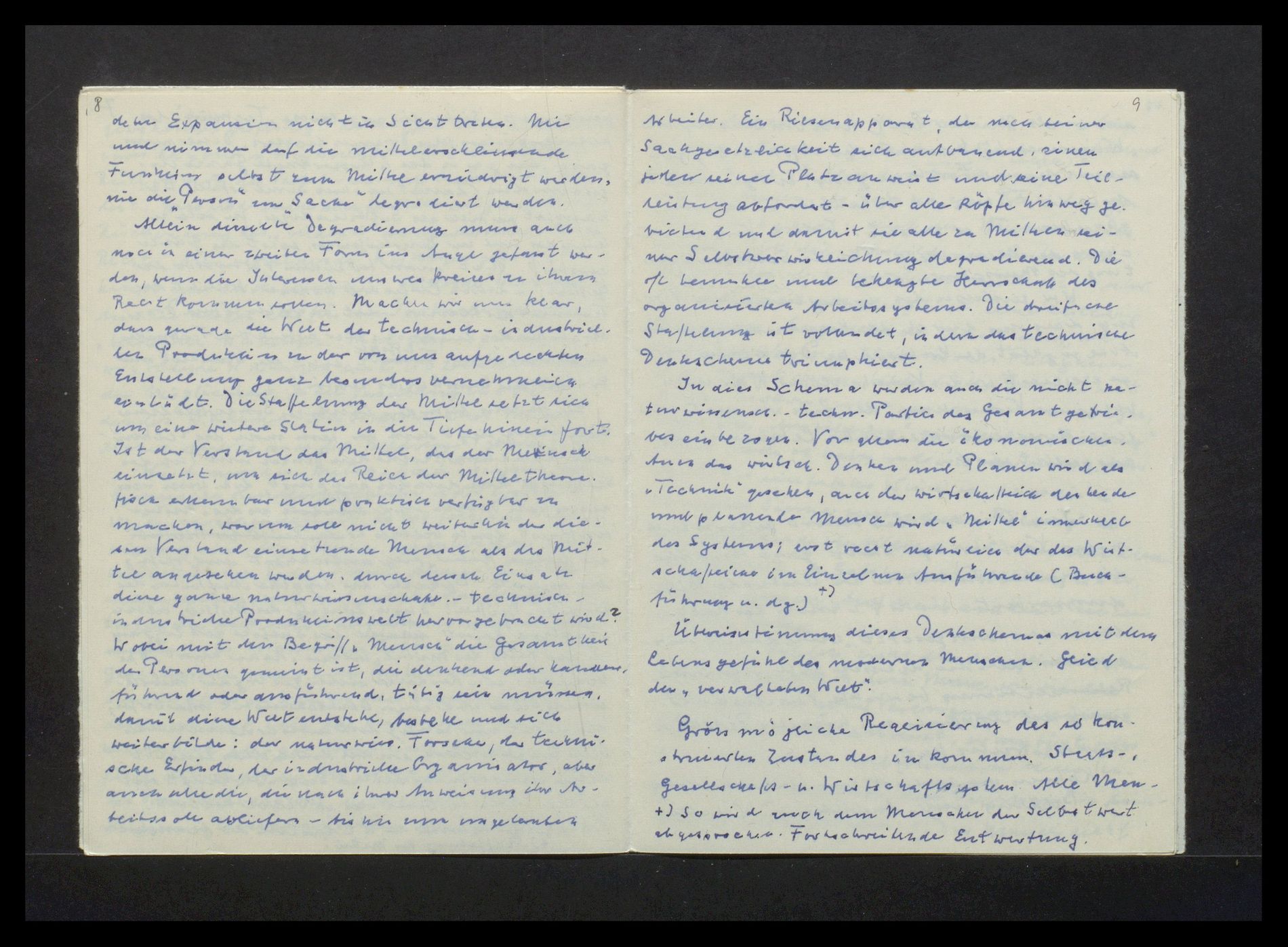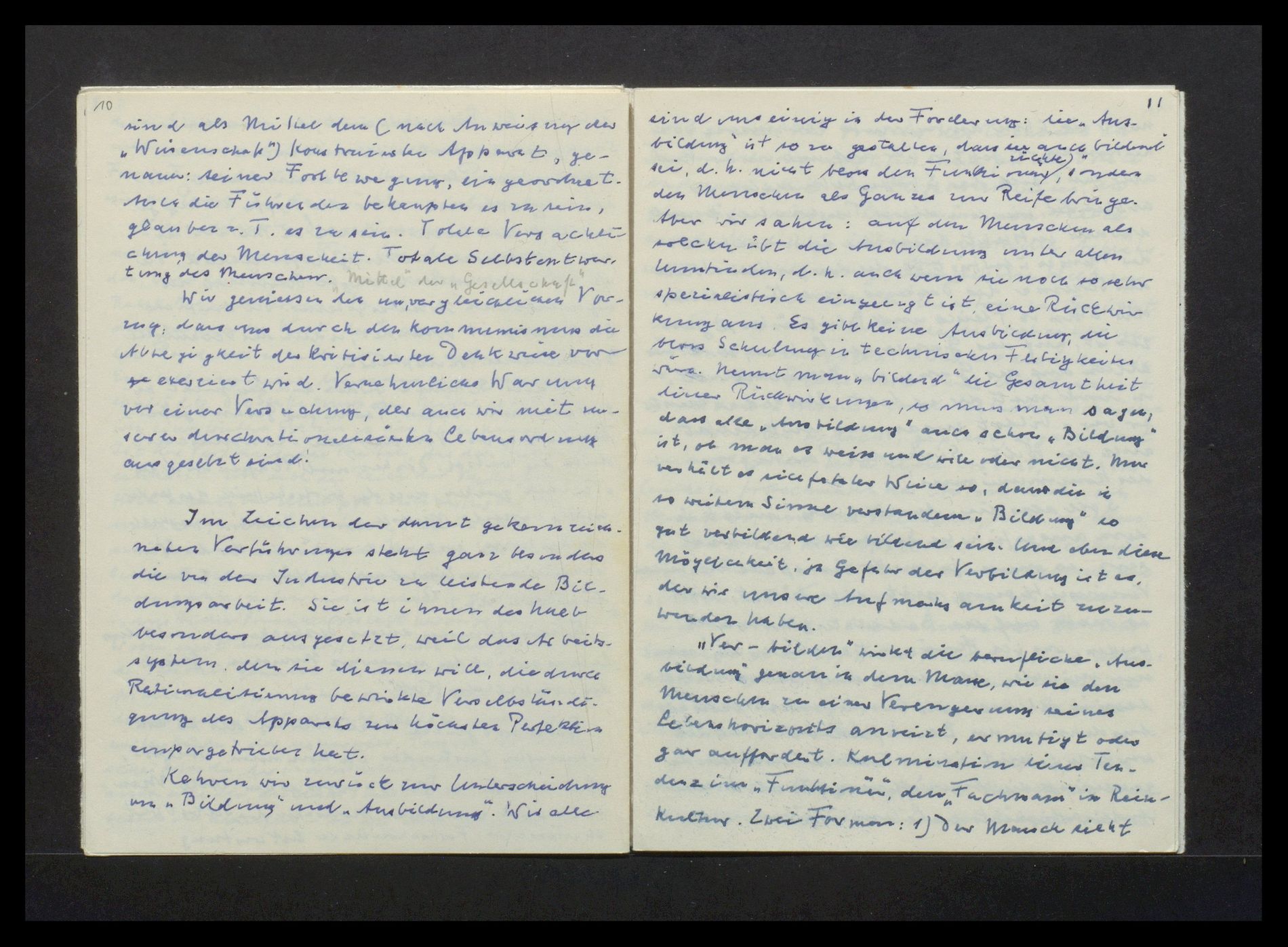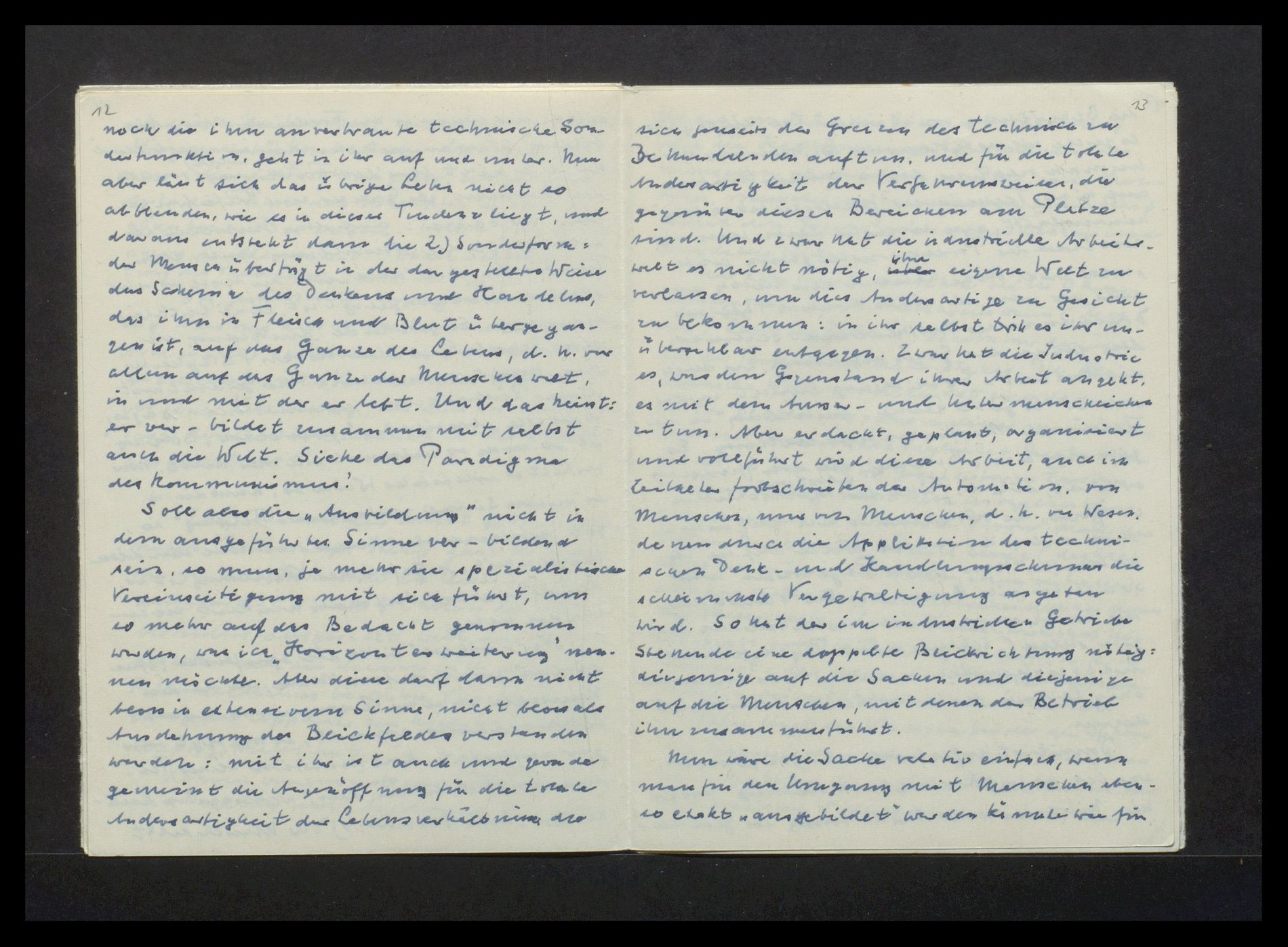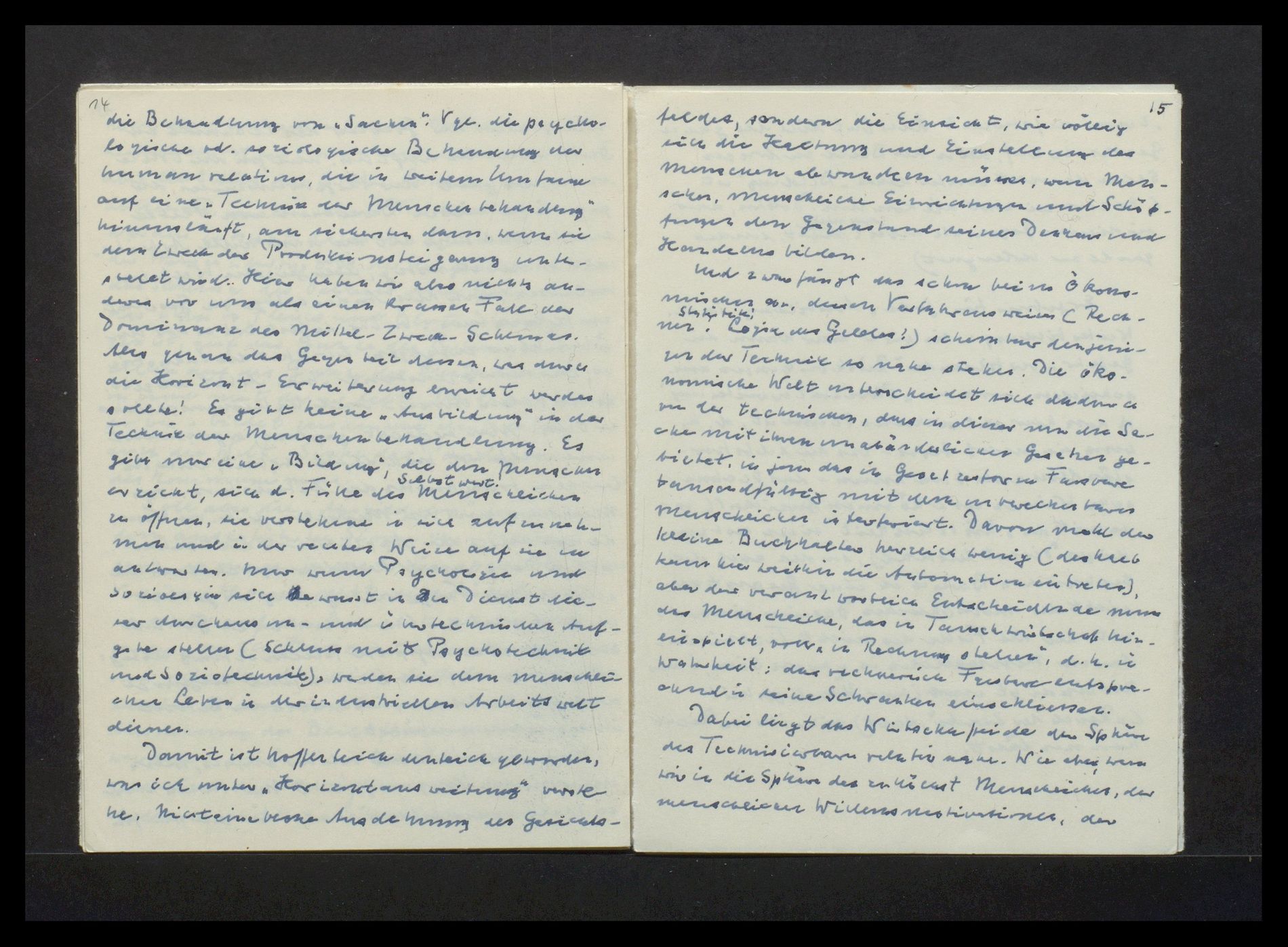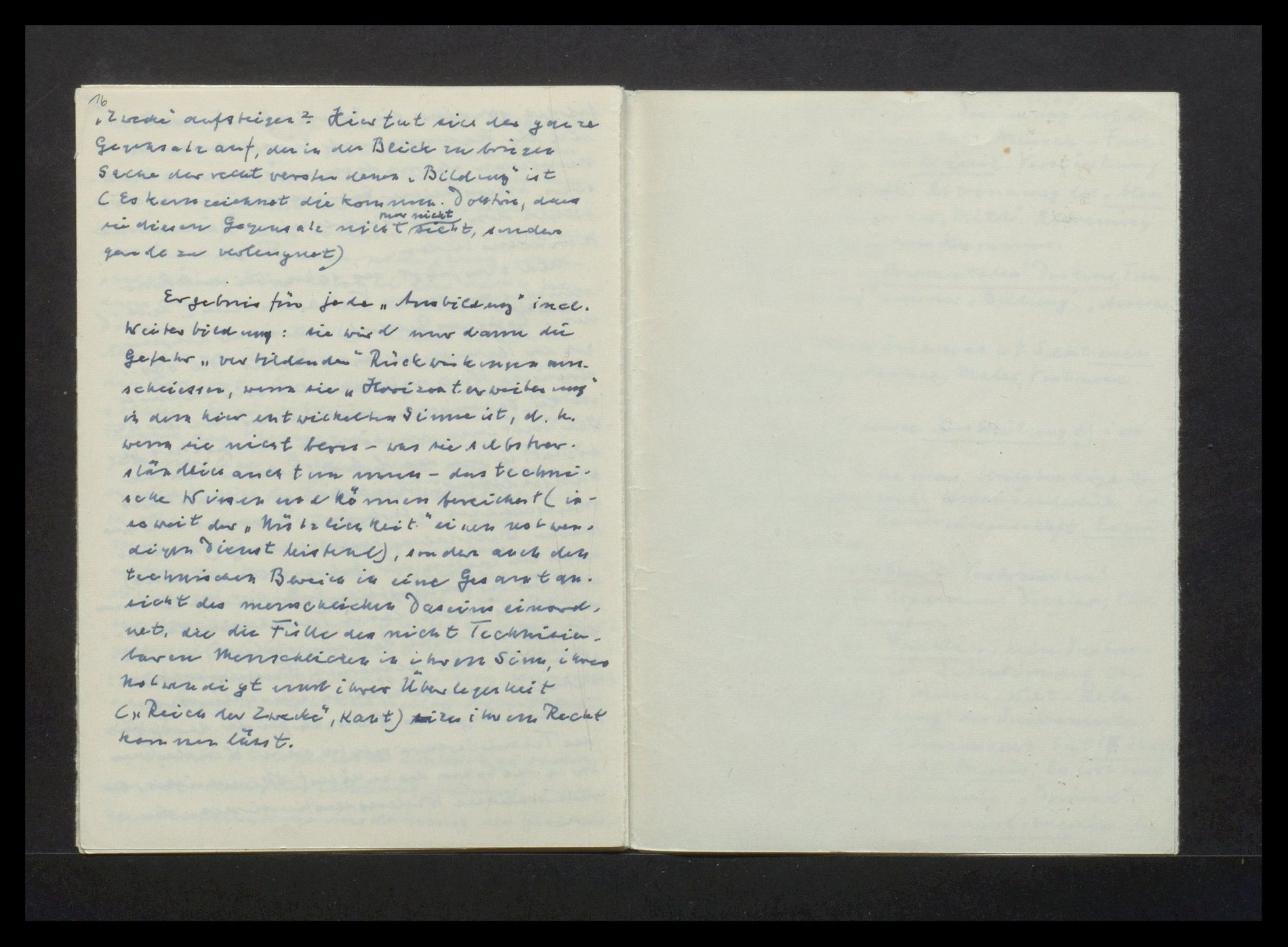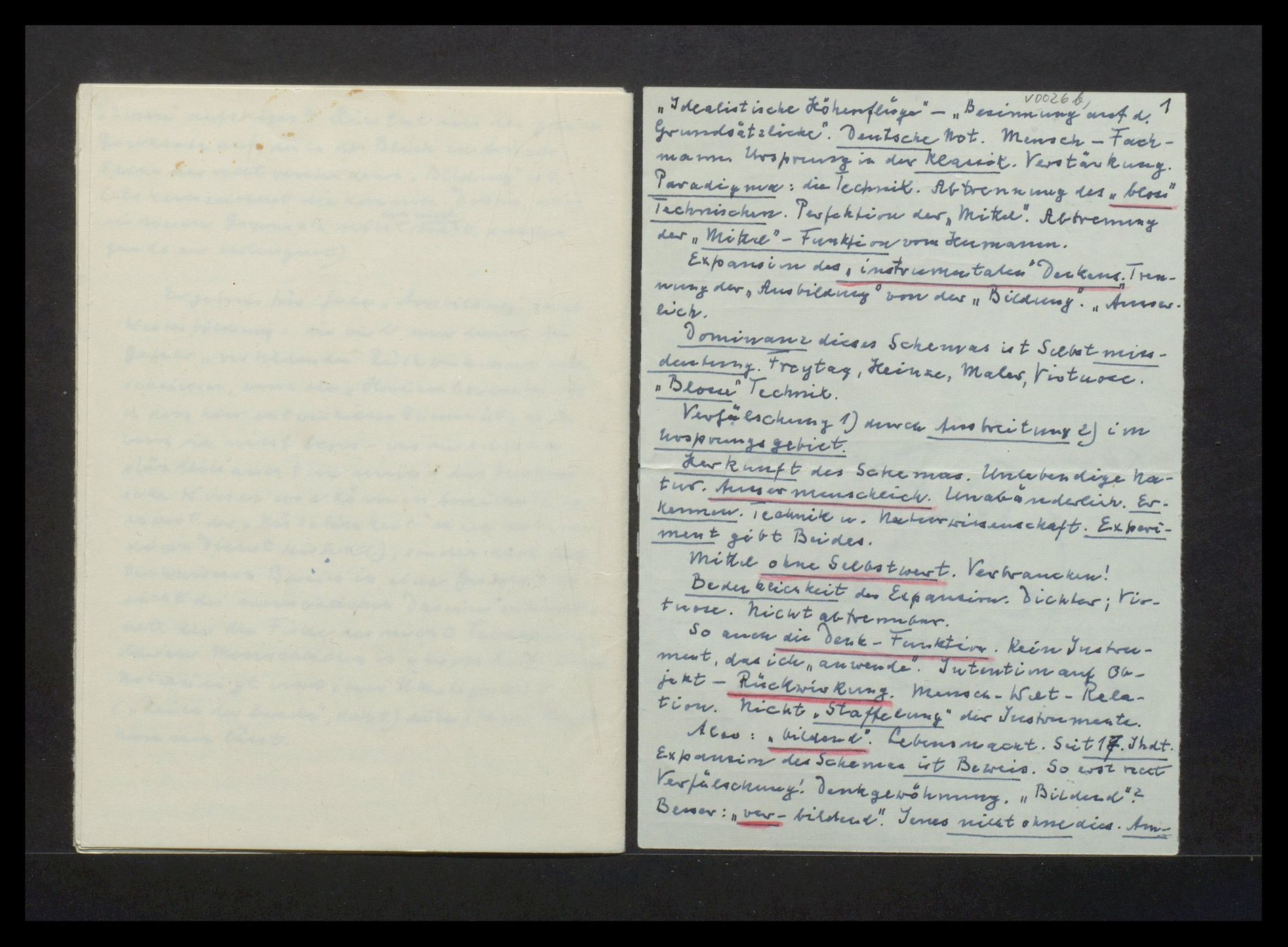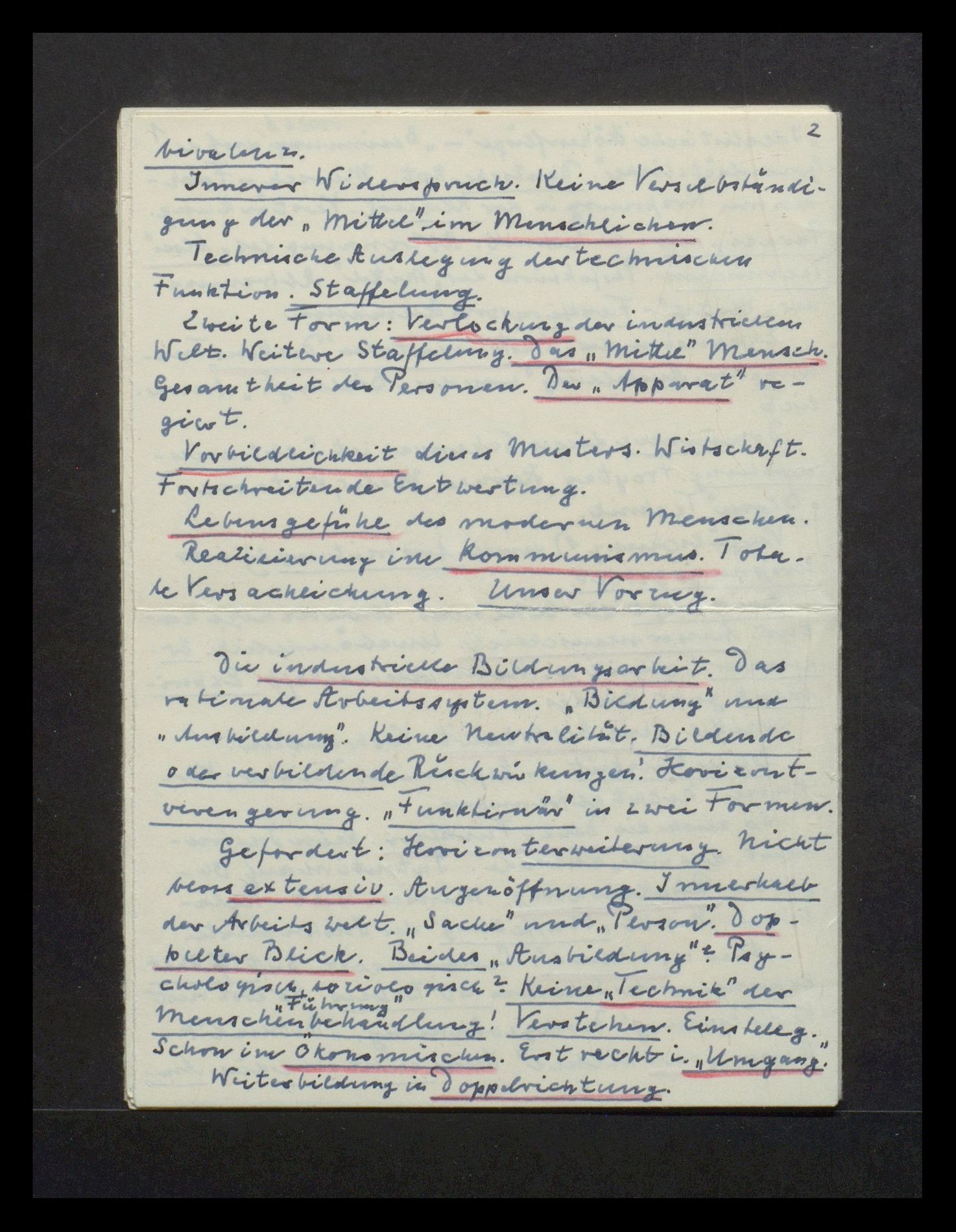| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0026a
1960
Titelseite
„Bildung“ und „Ausbildung“ („Weiterbildung“)
Baden-Baden 1960
1
„Idealistische Höhenflüge“?!
Fassbender: „Besinnung auf das Grundsätzliche“.
Spezifisch deutsche Art. „Bildung“ – „Ausbil-
dung“. Mensch – Fachmann. Ursprung in der
Klassik. Nützlichkeit – Menschlichkeit.
Neigung zur Trennung verstärkt durch
Fortentwicklung. Paradigma: die Tech-
nik. Abtrennbarkeit des bloss Nützlichen
auf d. Höhepunkt. Perfektion der „Mittel“
bei Offenbleiben der „Zwecke“. Scheinbare
Möglichkeit, im Mensch bloss die „Mit-
tel-Funktion“ umzubilden, während der
Mensch, als das die Zwecke setzende Subjekt
unberührt bleibt.
Auf diese Weise wird die mittelwerden-
de Funktion selbst wieder zu einem Mit-
tel, das der Mensch nach freiem Ermessen
einsetzt. „Instrumental“
Folgerung: die „Ausbildung“ der mittel-
verwendenden Funktion lässt die „Bildung des
Menschen genau so unberührt, wie die
verwendung eines äusseren Instruments
den verwendenden Menschen ungewandelt
lässt. Die instrumentale Sphäre ist den
Menschen selbst „äusserlich“.
Dies das Schema, nach dem das eingent-
lich „technische“ Handeln verstanden
wird. Expansi dieses Schemas. Domi-
nanz des Mittel-ZWeck-Denkens. Ausbrei-
2
tung des terminus „Technik“. Freytag.
Heinze. Maler, Virtuose. Technik das
Isolierbare, für sich Erlernbare und Aus-
übbare. „Blosse“ Technik. Das Eigentliche
und Kernhafte liegt über die „blosse“ Tech-
nik hinaus. So auch: „Führungstechniken“.
Demgegenüber ist zweierlei zu zeigen
1) Die Expansion des Schemas verfälscht
das Bild der Lebensgebiete, über die
es sich ausbreitet 2) Selbst in seinem
Ursprungsgebiet verzeichnet es die tat-
sächlich bestehenden Zusammenhänge.
Entgegensetzung
Die Unterscheidung „Bildung und „Aus-
bildung“ ist nur halb wahr. Recht und
Unrecht müssen an ihr geschieden
werden.
Herkunft des beanstandeten Schemas.
I) Die Abhängigkeit der Expansion
„Technik“ operiert mit
Stoffen und Kräften er unlebendigen, an-
organischen Natur. Das „“ und
„Unmenschliche“, ja in gewissem Sinne
das „Gegen-Menschliche“. Es kann durch
den Menschen im Dienst seiner Zwecke
umgewandelt werden, aber es kann nicht
nach Massgabe seiner Zwecke abgewandelt
werden. Das Unabänderliche. Daher die
Solidarität v. Technik u. Naturwissenschaft.
3
Ich kann dies Gegenmenschliche nur „verwenden“,
wenn ich seine Eigenschaften und Verhaltensweisen
(die den meinigen konträr sind) kenne. Beide
liegen nicht offen zu Tage, sondern müssen
deutend erkundet werden. Perfektion dieser Er-
kundung: die Wissenschaft. Perfektion dieser Wis-
senschaft: die mathematische Naturwissenschaft.
Vorzug dieser Wissenschaft: sie gibt in einem
theoretischen Einsichten und praktische Verfah-
rensregeln. Das Experiment!
Dass der Mensch es in deisem Verfahren mit
dem Ausser-, ja Gegenmenschlichen zu tun hat,
bringt ein Weiteres mit sich: die Gleich-gültig-
keit des zu Bearbeitenden. Es sträubt sich nicht
dagegen, als „Mittel“, d.h. als im nicht um
seiner selbst, sondern nur um des „Zwecks“ willen Ge-
verbraucht
suchtes und Geschätztes, eingesetzt zu werden.
Diese Behandlung ist ihm angemessen. Die
Technik hat es zu tun it dem den Selbstwer-
tes Entbehrenden. Blosser „Dienstwert“.
Gerade weil das technische Denkschema das
als „Mittel“ Angesehene so entwertet, muss mit
der Verallgemeinerung dieses Schemas besonders
bedachtsam zu Werke gegangen werden. Deshalb fra-
gen wir: trifft es zu, dass der Mensch ein „Instru-
ment“ des Handelns an der Natur erwirbt, in dem er
sich <....> mit dieser Natur in Beziehung
setzt? Ein Instrument, dessen Verwendung ihn, den
Verwendenden, umgewandelt <....>? Ganz im Ge-
genteil: in und mit dem Entstehen dieser
Wissenschaft, die implicite auch schon Technik
ist, tritt wandelt das Verhältnis von Mensch
und Natur im Tiefsten seiner Gestalt. Die
Natur nimmt eine Gestalt an – ein Gefüge
mathemat. Relationen – die sie nun unter
dem Zugriff des annehmen konnte.
Auch und erst recht aber wird der Mensch in
Betätigung dieses Denkens ein anderer, als
er beim Ausbleiben dieses Denkens gewesen,
geblieben oder geworden wäre. Sein Denken ist
nicht ein Instrument, das er, selbst derselbe
bleibend, an der Natur arbeiten lässt. Er selbst
ist der Denkende, der so und nicht anders zu
4
Werke gehen muss, damit die Natur ihm dies
Anblitz zu kehren Er „gebraucht“ nicht, wie
man es gerne sagt, „seinen Verstand“, da-
mit die Natur ihm ihr mathemat. Gefüge
erschliesse. Er selbst wird Verstand, operiert
als Verstand, in den er so mit der ihm be-
gegnenden Natur umgeht.
Ergebnis: Ablehnung des Instrumentalen
Denkschemas. Die denkende Bearbeitung
der Natur verschafft uns Instrumente in stän-
dig wachsender Zahl und Reichweite. Aber
das Denken, dem wir dies alles verdanken, ist
selbst nicht wieder ein Instrument, das der
Mensch ins Spiel setzte: es ist er selbst in
einer bestimmten Funktion.
Folgerung: in dem der Mensch als denken-
des Subjekt sein Verhältnis zur Natur in
der Weise abwandelt, wird auch
er selbst ein anderer. Seiner Intention nach
ganz dem Gegenüber der zu erschliessenden
und zu verwendenden Natur zu gewandt,
erleidet er nicht gewusste und gewollte
R+ckwirkungen, die ihn als Person zu einem
Anderen machen. Diese Rückwirkungen müs-
sen „Bildend“ heissen, so <...> sie seine mensch-
liche Gestalt zu einer anderen werden lassen.
Blicke auf die , die die Ge-
stalt der Menschheit seit dem Aufgang der
5
math.-N.-W. im 17. Jhdt. erlitten hat. Ab-
wendung nicht nur des äusseren (politisch-
gesellschaftl.-wirtsch.) Schicksal, Abwendung
nimt man durch die von diesem Schicksal
herkommenden seelischen Auswirkungen.
sondern auch Abwandung der inneren Ein-
stellung zur Welt und zum eigenen Selbst,
die sich mit Aufstieg und Fortgang die-
ser Wissenschaft einstellte. Und das alles
sollen bloss Änderungen des Instrumentarillen
sein, mit dem wir die Natur bearbeiten?!
An nichts aber können wir Wesen und
Tragweite dieser Abwandlung der menschlichen
Einstellung zur Welt so deutlich ablesen
wie an der Expansion des Denkschemas, das,
wie wir jetzt gesehen haben, schon das Bild
der Sphäre verfälscht, innerhalb <...> es
entstanden ist, das aber erst recht nur Ent-
stellung und Verfälschung verbreiten kann,
wenn es die Grenzen dieser Sphäre über-
schreitet und als universales Schema
menschlichen Handelns wer-
den soll und Anerkennung fordert. Denn
nur unter der Voraussetzung können die natur-
wissenschaftl.-techn. Verfahrensweisen sich in
der dargestellten Weise ausbreiten, dass sie in der
Seele der sie auszuübenden Menschen zu Denk-
6
gewöhnungen verfestigt haben, die auch ausserhalb
ihres in Wirkung treten. Darin wird die
Rückwirkung des Verfahrens auf das Subjekt evi-
dent. Nur wird man sich freilich weigern, diese
Rückwirkung als „bildend“ anzuerkennen. Mit
Recht! Aber „verbildende“ Wirkungen gibt es über-
haupt nur als Fehlformen „bildender“ Wirkungen.
Auch sie zeugen also für das Vorhandensein von
„bildenden“ Wirkungen. Man darf sogar sagen:
wo „bildende“ Wirkungen sind, ist stets nicht nur
die Möglichkeit, ja die Versuchung zu „verbil-
denden“ Wirkungen. Ambivalenz alles Mensch-
lichen und so auch der Bildung. Vgl. das Tier!
Wird nun das „Mittel-Zweck“-Schema, das
technische Handlungsschema in der erörterten
Weise verallgemeinert, so tritt folgende Ver-
wicklung ein. Ein Schema, das entwickelt und
bewährt ist im Verkehr mit Ausser- ja Gegen-
menschlichem, wird auf solche Handlungen über-
tragen, die sich nicht auf Aussermenschliches,
d.h. vollkommen Selbständiges, in sich
Geschlossenes, auf sich Bestehendes bezieht,
sondern etwas zu bewirken oder hervorzubringen
bestimmt sind, worin das Menschliche zumindest
hineinspielt oder gar dominiert. Als dann ent-
fällt notwendig die Möglichkeit der abschliessen-
den Verselbständigung, die das Charakteristicim
der gemein „technischen“ Sphäre, der „Mittel“-Welt
7
ausmacht. Siehe die angebliche „Technik“ des
Klavierspielers, des Dramendichters. Diese muss
ganz und gar in das übergeordnete Ganze ein-
geschmolzen sein, damit sie ihren Sinn erfüllt Be-
hauptet sich sich als Selbständiges, für sich zu
Übendes und zu Beurteilendes, so ist das Ganze
zerstört. Hat man bei einem Virtuosen das
Gefühl: in diesen Läufen und Kadenzen brilliert der
Techniker des Klaviers – hat man bei einem Dra-
matiker den Eindruck: hier arbeitet der Techniker
der dramatischen Effekte, so ist die Wahrheit und
Einheit des Kunstwerkes zerstört.
Ein für uns besonders wichtiger Sonderfall dieser
Entstellung liegt dann vor, wenn man das Techni-
sche Handlungsschema dem Denken und Tun des
technisch Handelnden aufprent, d.h. wenn man
dieses sein Denekn und Tun als das „Mittel“
auffasst, durch welches er das Reich der Mittel
die leblose Natur sich aufschliesst und verfüg-
bar machte. Beachte das doppelte Auftreten des
Begriffs „Mittel“! Durch Einsatz des Mittels, welches
„Verstand“ heisst, erzwingt das Subjekt den Eingang
in das Reich der Mittel, welches „Natur“ heisst. +) Das
bedeutet: ein kardinalwichtiges Organ mensch-
lichen Seins wird einer Denkschematik unterworfen,
die nicht nur <....ig> dem aussermenschlichen
Sein angemessen, sondern durch deren Einsatz
dieses aussermenschliche Sein überhaupt erst
als technisch verwendbar in Sicht kommt!
Schlagender könnte der Widersinn der beanstan-
+) Staffelung der Mittel:
8
deten Expansion nicht in Sicht treten. Nie
und nimmer darf die mittelerschliessende
Funktion selbst zum Mittel erniedrigt werden,
nie die „Person“ zur Sache degradiert werden.
Allein dieselbe Degradierung muss auch
noch in einer zweiten Form ins Auge gefasst wer-
den, wenn die Interessen unseres Kreises zu ihrem
Recht kommen sollen. Machen wir uns klar,
dass gerade die Welt der technisch-industriel-
len Produktion zu der von uns aufgedeckten
Entstellung ganz besonders vernehmlich
einlädt. Die Staffelung der Mittel setzt sich
um eine weitere Station in die Tiefe hinein fort.
Ist der Verstand das Mittel, das der Mensch
einsetzt, um sich das Reich der Mittel theore-
tisch erkennbar und praktisch verfügbar zu
machen, warum soll nicht weiterhin der die-
sen Verstand einsetzende Mensch als das Mit-
tel angesehen werden, durch dessen Einsatz
diese ganze naturwissenschaftl.-technisch-
industrielle Produktonswelt hervorgebracht wird?
Wobei mit dem Begriff „Mensch“ die Gesamtheit
der Personen gemeint ist, die denkend oder handelnd,
führend oder ausführend, tätig sein müssen,
damit diese Welt entstehe, bestehe und sich
weiterbilde: der naturwiss. Forscher, der techni-
sche Erfinder, der industrielle Organisator, aber
auch alle die, die nach ihrer Anweisung ihr Ar-
beitssoll abliefern – bis hin zum ungelernten
9
Arbeiter. Ein Riesenapparat, der nach seiner
Sachgesetzlichkeit sich aufbauend, einen
jeden seiner Platz anweist und seine Teil-
leistung abfordert – über alle Köpfe hinweg ge-
bietend und damit sie alle zu Mitteln sei-
ner Selbstverwirklichung degradierend. Die
oft bemerkte undbeklagte Herrschaft des
organisierten Arbeitssystems. Die dreifache
Staffelung ist vollendet, in dem das technische
Denkschema triumphiert.
In dies Schema werden auch die nicht na-
turwissensch.-techn. Partien des Gesamtgetrie-
bes einbezogen. Vor allem die ökonomischen.
Auch das wirtsch. Denken und Planen wird als
„Technik“ gesehen, auch der wirtschaftlich denkende
und planende Mensch wird „Mittel“ innerhalb
des Systems; erst recht natürlich der das Wirt-
schaftliche im Einzelnen Ausführende (Buch-
führung u.dg.) +)
Übereinstimmung dieses Denkschemas mit dem
Lebensgefühl des mordernen Menschen. Glied
der „verwalteten Welt“.
mögliche Realisierung des so kon-
struierten Zustandes im kommen. Staats-,
Gesellschafts- u. Wirtschaftssystem. Alle Men-
+) So wird auch dem Menschen der Selbstwert
abgesprochen. Fortschreitende Entwertung.
10
sind als Mittel dem (nach Anweisung der
„Wissenschaft“9 konstruierten Apparat, ge-
nauer: seiner Fortbewegung, eingeordnet.
Auch die Führenden behaupten es zu sein,
glauben z.T. es zu sein. Totale Versachli-
chung der Menschheit. Totale Selbstentwer-
tung des Menschen. „Mittel“ der „Gesellschaft“
Wir geniessen den unvergleichlichen Vor-
zug: das uns durch den Kommunismus die
Abhängigkeit der kritisierten Denkweise vor-
exerziert wird. Vernehmliche Warnung
vor einer Versuchung, der auch wir mit un-
serer durchrationalisierten Lebensordnung
ausgesetzt sind!
Im Zeichen der damit gekennzeich-
neten Verführungen steht ganz besonders
die von der Industrie zu leistende Bil-
dungsarbeit. Sie ist ihnen deshalb
besonders ausgesetzt, weil das Arbeits-
system, dem sie dienen will, die durch
Rationalisierung bewirkte Verselbständi-
gung des Apparats zur höchsten Perfektion
emporgetrieben hat.
Kehren wir zurück zur Unterscheidung
von „Bildung“ und „Ausbildung“. Wir alle
11
sind uns einig in der Forderung: die „aus-
bildung“ ist so zu gestalten, dass sie auch „bildend“
sei, d.h. nicht bloss den Funktionär züchte, sondern
den Menschen als Ganzes zur Reife bringe.
Aber wir sahen: auf den Menschen als
solchen übt die Ausbildung unter allen
Umständen, d.h. auch wenn sie noch so sehr
spezialistisch eingelegt ist, eine Rückwir-
kung aus. Es gibt keine Ausbildung, die
bloss Schulung in technischen Fertigkeiten
wäre. Nennt man „bildend“ die Gesamtheit
dieser Rückwirkungen, so muss man sagen,
dass alle „Ausbildung“ auch schon „Bildung“
ist, ob man es weiss und will oder nicht. Nur
verhält es sich fataler Weise so, dass die in
so weitem Sinne verstandene „Bildung“ so
gut verbildend wie bildend sein. Und aber diese
Möglichkeit, ja Gefahr der Verbildung ist es,
der wir unsere Aufmekrsamkeit zuzu-
wenden haben.
„Ver-bilden“ <....> die berufliche !Aus-
bildung“ genau in dem Masse, wie sie den
Menschen zu einer Verengung seines
Lebenshorizonts anreizt, ermutigt oder
gar auffordert. Kulmination dieser Ten-
denz im „Funktionär“, dem „Fachmann“ in Rein-
kultur. Zwei Formen: 1) Der Mensch sieht
12
noch die ihm anvertraute technische Son-
derfunktion, geht in ihr auf und unter. Nun
aber lässt sich das übrige Leben nicht so
abblenden, wie es in dieser Tendenz liegt, und
daraus entsteht dann die 2) Sonderform =
der Mensch überträgt in der dargestellten Weise
das Schema des Denkens und Handelns,
das ihm in Fleisch und Blut übergegan-
gen ist, auf das Ganze des Lebens, d.h. vor
allem auf das Ganze der Menschenwelt,
in und mit der er lebt. Und das heisst:
er ver-bildet zusammen mit selbst
auch die Welt. Siehe das Paradigma
des Kommunismus!
Soll also die „Asubildung“ nicht in
dem ausgeführten Sinne ver-bildend
sein, so muss, je mehr sie spezialistische
Vereinseitigung mit sich führt, um
so mehr auf den Bedacht genommen
werden, was ich „Horizonterweiterung“ nen-
nen möchte. Aber diese darf dann nicht
bloss in extensivem Sinne, nicht bloss als
Ausdehnung des Blickfeldes verstanden
werden: mit ihr ist auch und gerade
gemeint die Augenöffnung für die totale
Andersartigkeit der Lebensverhältnisse die
13
sich jenseits der Grenzen des technisch zu
Behandelnden auftun, und für die totale
Andersartigkeit der Verfahrensweisen, die
gegenüber diesen Bereichen am Platze
sind. Und zwar hat die industrielle Arbeiter-
welt es nicht nötig, ihre eigene Welt zu
verlassen, um dies Andersartige zu Gesicht
zu bekommen: in ihr selbst tritt es ihr un-
übersehbar entgegen. Zwar hat die Industrie
es, was den Gegenstand ihrer Arbeit angeht,
es mit dem Ausser- und Untermenschlichen
zu tun. Aber erdacht, geplant, organisisert
und vollführt wird diese Arbeit, auch im
Zeitalter fortschreitender Automation, von
Menschen, nur von Menschen, d.h. von Wesen,
denen durch die Applikation des Techni-
schen Denk- und Handlungsschemas die
schlimmste Vergewaltigung angetan
wird. So hat der im industriellen Getriebe
Stehende eine doppelte Blickrichtung nötig:
diejenige auf die Sachen und diejenige
auf die Menschen, mit denen der Betrieb
ihn zusammenführt.
Nun wäre die Sache relativ einfach, wenn
man für den Umgang mit Menschen eben-
so exakt „ausgebildet“ werden könnte wie für
14
die Behandlung von „Sachen“. Vgl. die psycho-
logische od. soziologische Behamdlung der
human relationen, die in weitem Umfange
auf eine „Technik der Menschenbehandlung“
hinausläuft, am sichersten dann, wenn sie
dem Zweck der Produktionssteigerung unter-
stellt wird. Hier haben wir also nichts an-
deres vor uns als einen krassen Fall der
Dominanz des Mittel-Zweck-Schemas.
Also genau das Gegenteil dessen, was durch
die Horizont-Erweiterung erreicht werden
sollte! Es gibt keine „Ausbildung“ in der
Technik der Menschenbehandlung. Es
gibt nur eine „Bildung“, die den Menschen
Selbstwert.
erzieht, sich d. Fülle des Menschlichen
zu öffnen, sie verstehend in sich aufzuneh-
men und in der rechten Weise auf sie zu
antworten. Nur wenn Psychologie und
Soziologie sich bewusst in den Dienst die-
ser <....>- und übertechnischen Auf-
gabe stellen (Schluss mit Psychotechnik
und Soziotechnik), werden sie dem menschli-
chen Leben in der industriellen Arbeitswelt
dienen.
Damit ist hoffentlich deutlich geworden,
was ich unter „Horizontausweitung“ verste-
he. Nicht eine blosse Ausdehnung des Gesichts-
15
feldes, sondern die Einsicht, wie völlig
sich die Haltung und Einstellung des
Menschen abwandeln müssen, wenn Men-
schen, menschliche Einrichtungen und Schöp-
fungen den Gegenstand seines Denkens und
Handelns bilden.
Und zwar fängt das schon beim Ökono-
mischen an, dessen Verfahrensweisen (Rech-
Statistik!
nen! Login des Geldes!) scheinbar denjeni-
gen der Technik so nahe stehen. Die öko-
nomische Welt unterscheidet sich dadurch
von der technischen, dass in dieser nur die Sa-
che mit ihren unabänderlichen Gesetzen ge-
bietet, in jene das in Gesetzesform Fassbare
tausendfältig mit dem unberechenbaren
Menschlichen . Davon merkt der
kleine Buchhalter herzlich wenig (deshalb
kann hier weithin die Automation eintreten),
aber der verantwortlich Entscheidende nimmt
das Menschliche, das in Tauschwirtschaft hin-
einspielt, voll „in Rechnung stellen“, d.h. in
Wahrheit: das rechnerische Fassbare entspre-
chend in seine Schranken einschliessem.
Dabei liegt das Wirtschaftliche der Sphäre
des Technisierbaren relativ nahe. Wie aber, wenn
wir in die Sphäre des zuhöchst Menschlichen, der
menschlichen Willensmotivationen, der
16
„Zwecke“ aufsteigen? Hier tut sich der ganze
Gegensatz auf, der in den Blick zu bringen
Sache der recht verstandenen „Bildung“ ist
(Es kennzeichnet die kommun. Doktrin, dass
sie diesem Gegensatz nicht nur nicht sieht, sondern
geradezu verleugnet)
Ergebnis für jede „Ausbildung“ incl.
Weiterbildung: sie wird nur dann die
Gefahr „verbildender“ Rückwirkungen aus-
schliesen, wenn sie „Horizonterweiterung“
in dem hier entwickelten Sinne ist, d.h.
wenn sie nicht bloss – was sie selbstver-
ständlich auch tun muss – das techni-
sche Wissen und Können bereichert ( inso-
weit der „Nützlichkeit“ einen notwen-
digen Dienst leistend), sondern auch den
technischen Bereich in eine Gesamtan-
sicht des menschlichen Daseinss einord-
net, die die Fülle des nicht Technisier-
baren Menschlichen in ihren Sinn, ihrer
Notwendigkeit und ihrer Überlegenheit
(„Reich der Zwecke“, Kant) zu ihrem Recht
kommen lässt.
V 0026b
1
„Idealistische Höhenflüge“ – „Besinnung auf d.
Grundsätzliche“. Deutsch Not. Mensch – Fach-
mann. Ursprung in der Klassik. Verstärkung.
Paradigma: die Technik. Abtrennung des „bloss“
Technischen. Perfektion der „Mittel“. Abtrennung
der „Mittel“-Funktion vom Humanen.
Expansion des „instrumentalen“ Denkens. Tren-
nung der „Ausbildung“ von der „Bildung“. „Äusser-
lich.
Dominanz diese Schemas ist Selbstmiss-
deutung. Freytag, Heinze, Maler, Virtuose.
„Blosse“ Technik.
Verfälschung 1) durch Ausbreitung 2) im
Ursprungsgebiet.
Herkunft des Schemas. Unlebendige Na-
tur. Aussermenschlich. Unabänderlich. Er-
kennen. Technik u. Naturwissenschaft. Experi-
ment gibt Beides.
Mittel ohne Selbstwert. Verbrauchen!
Bedenklichkeit der Expansion. Dichter; Vir-
tuose. Nichtabtrennbar.
So auch die Denk-Funktion. Kein Instru-
ment, das ich „anwende“. Intention auf Ob-
jekt – Rückwirkung. Mensch-Welt-Rela-
tion. Nicht „Staffelung“ der Instrumente.
Also: „bildend“. Lebensmacht. Seit 17. Jhdt.
Expansion des Schemas ist Beweis. So erst recht
Verfälschung! Denkgewöhnung. „Bildend“?
Besser: „ver-bildend“. Jenes nicht ohne dies. Am-
2
bivalenz.
Innerer Widerspruch. Keine Verselbständi-
gung der „Mittel“ im Menschlichen.
Technische Auslegung der technischen
Funktion. Staffelung.
Zweite Form: Verlockung der industriellen
Welt. Weitere Staffelung. Das „Mittel“ Mensch.
Gesamtheit der Personen. Der „Apparat“ re-
giert.
Vorbildlichkeit dieses Musters. Wirtschaft.
Fortschreitende Entwertung.
Lebensgefühle des modernen Menschen.
Reduzierung im Kommunismus. Tota-
le Versachlichung. Unser Vorzug.
Die industrielle Bildungsarbeit. Das
rationale Arbeitssystem. „Bildung“ und
„Ausbildung“. Keine Neutralität. Bildende
oder verbildende Rückwirkungen! Horizont-
verengung. „Funktionär“ in zwei Formen.
Gefordert: Horizonterweiterung. Nicht
bloss extensiv. Augenöffnung. Innerhalb
der Arbeitswelt. „Sache“ und „Person“. Dop-
pelter Blick. Beides „Ausbildung“? Psy-
chologisch, soziologisch? Keine „Technik“ der
„Führung“
Menschenbehandlung! Verstehen. Einstellg.
Schon im Ökonomischen. Erst recht im „Umgang“.
Weiterbildung in Doppelrichtung. |