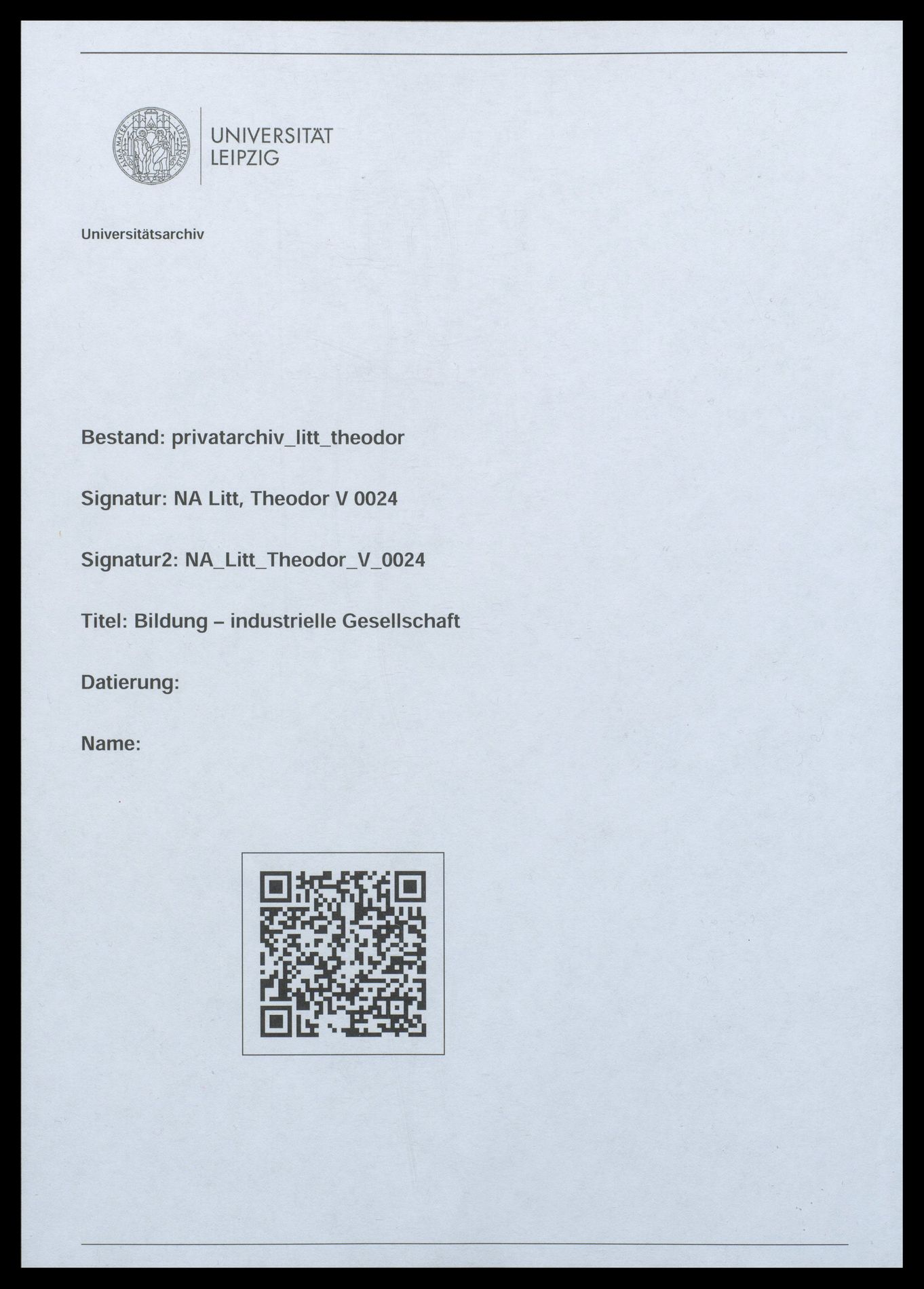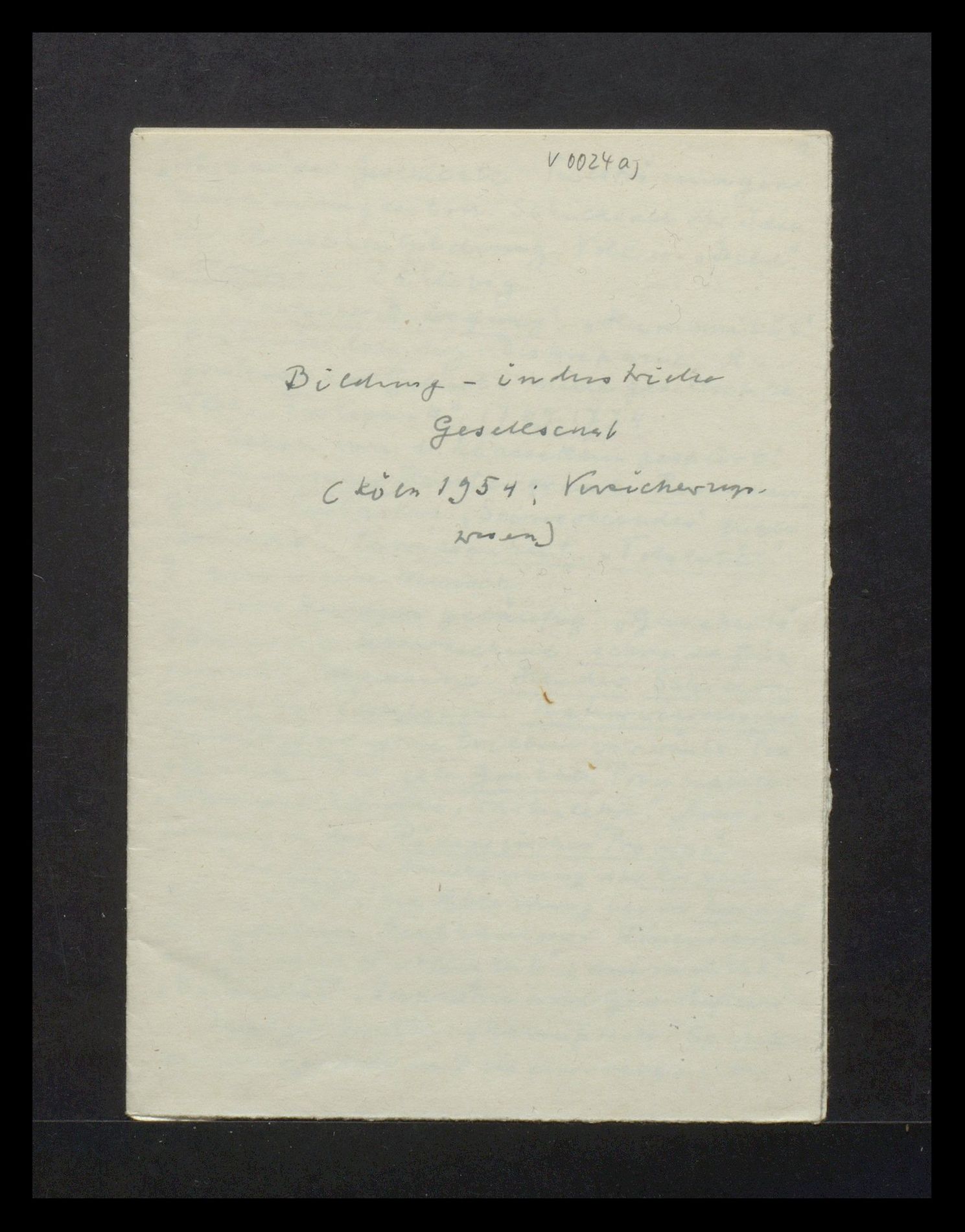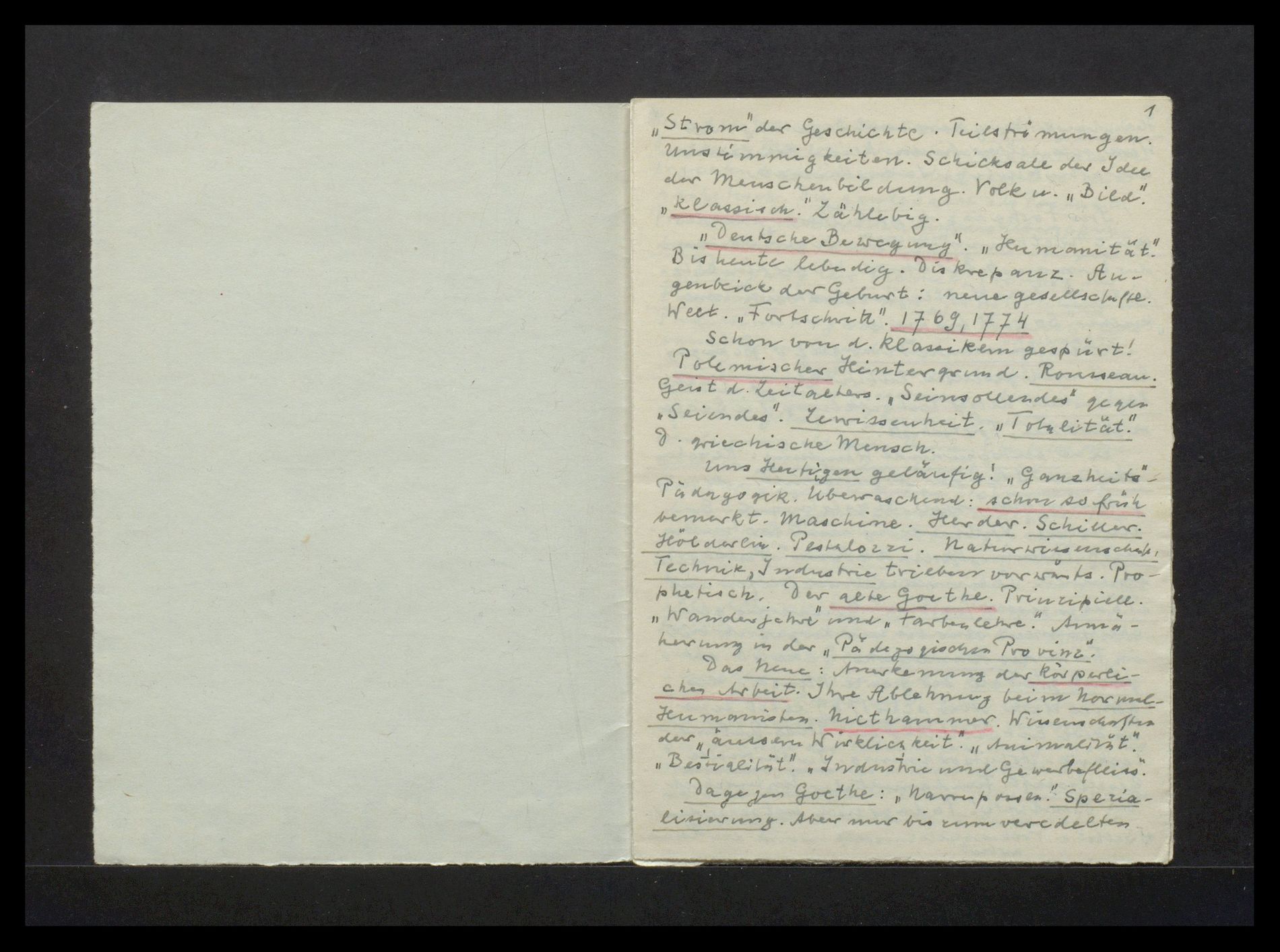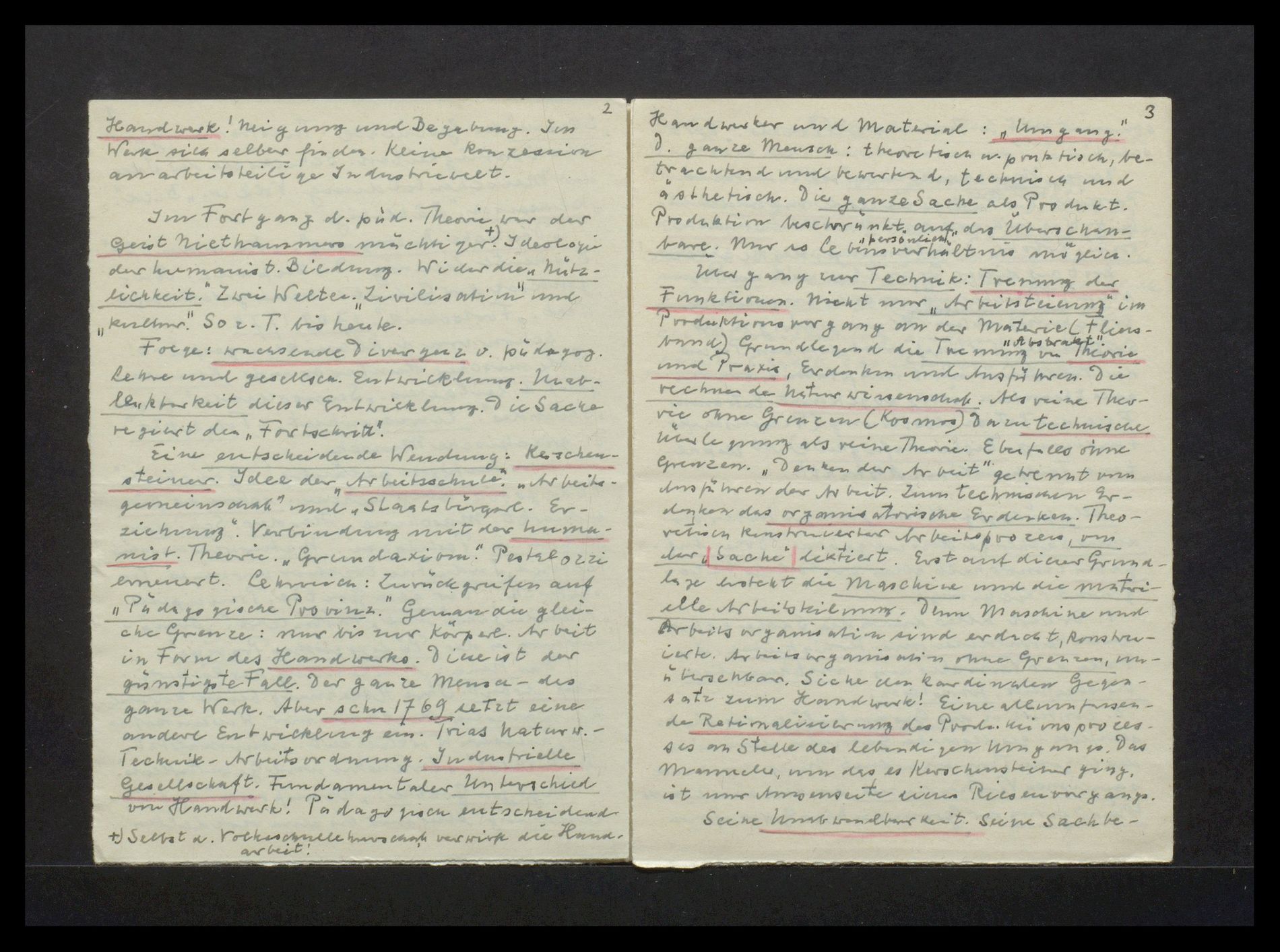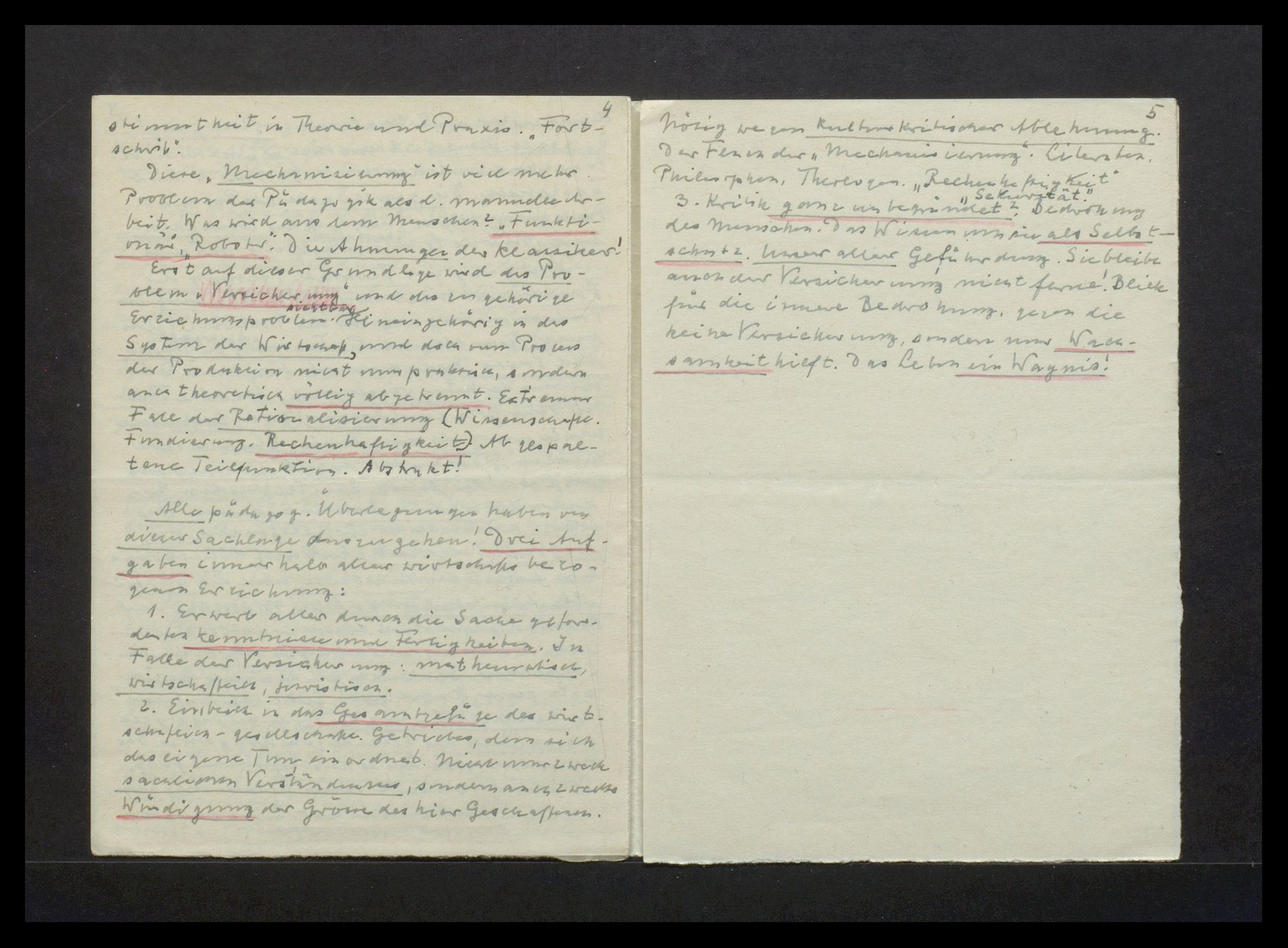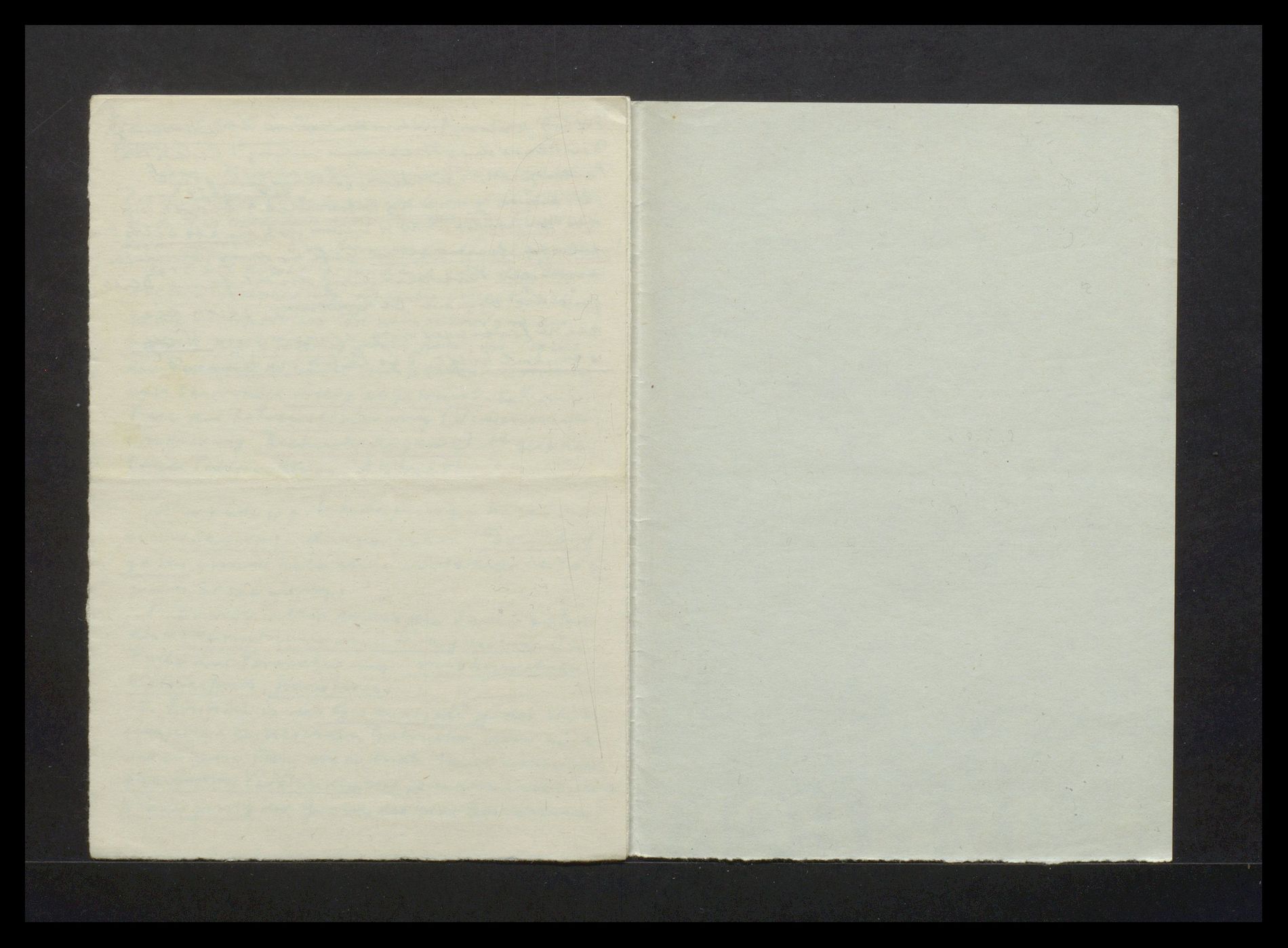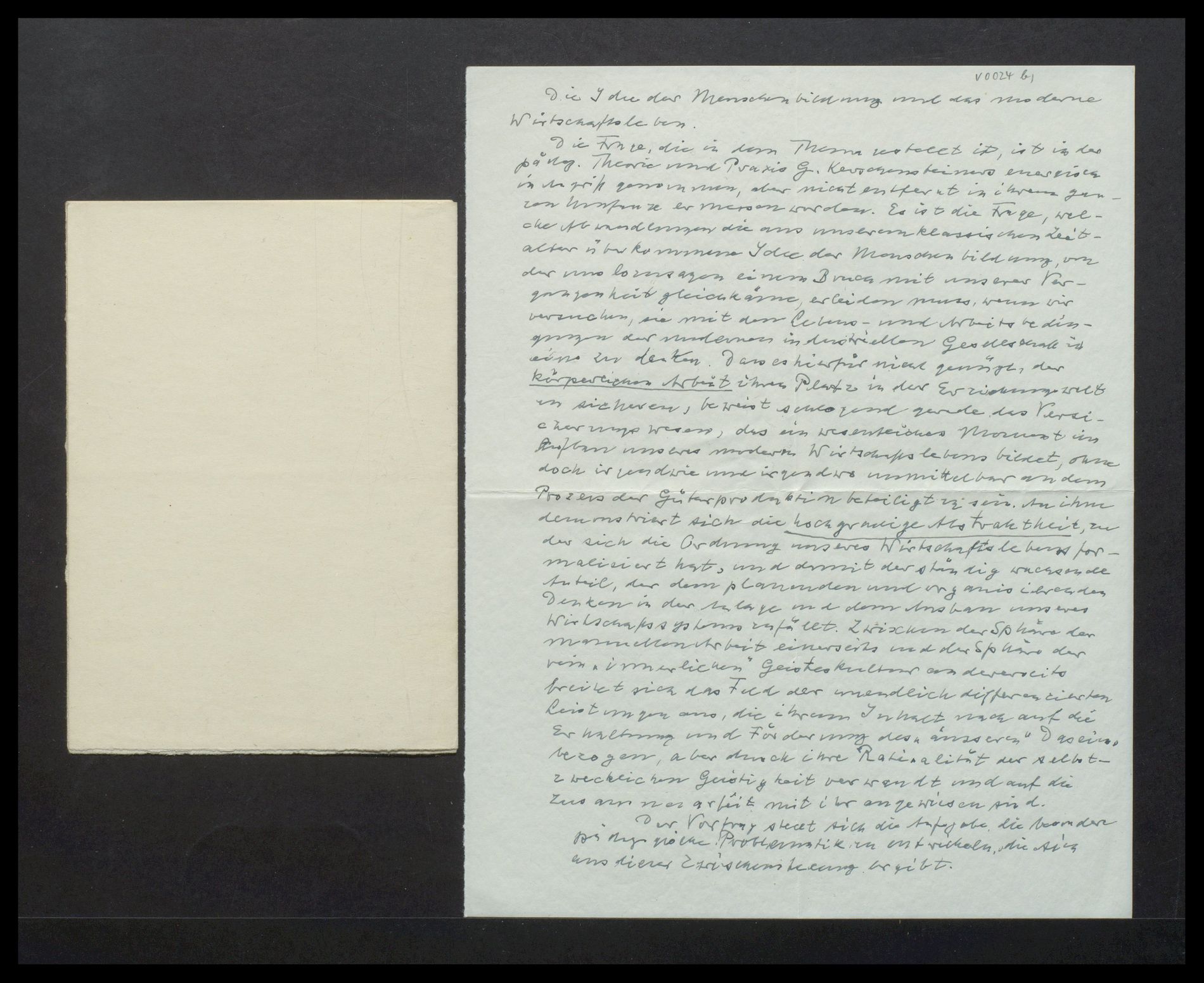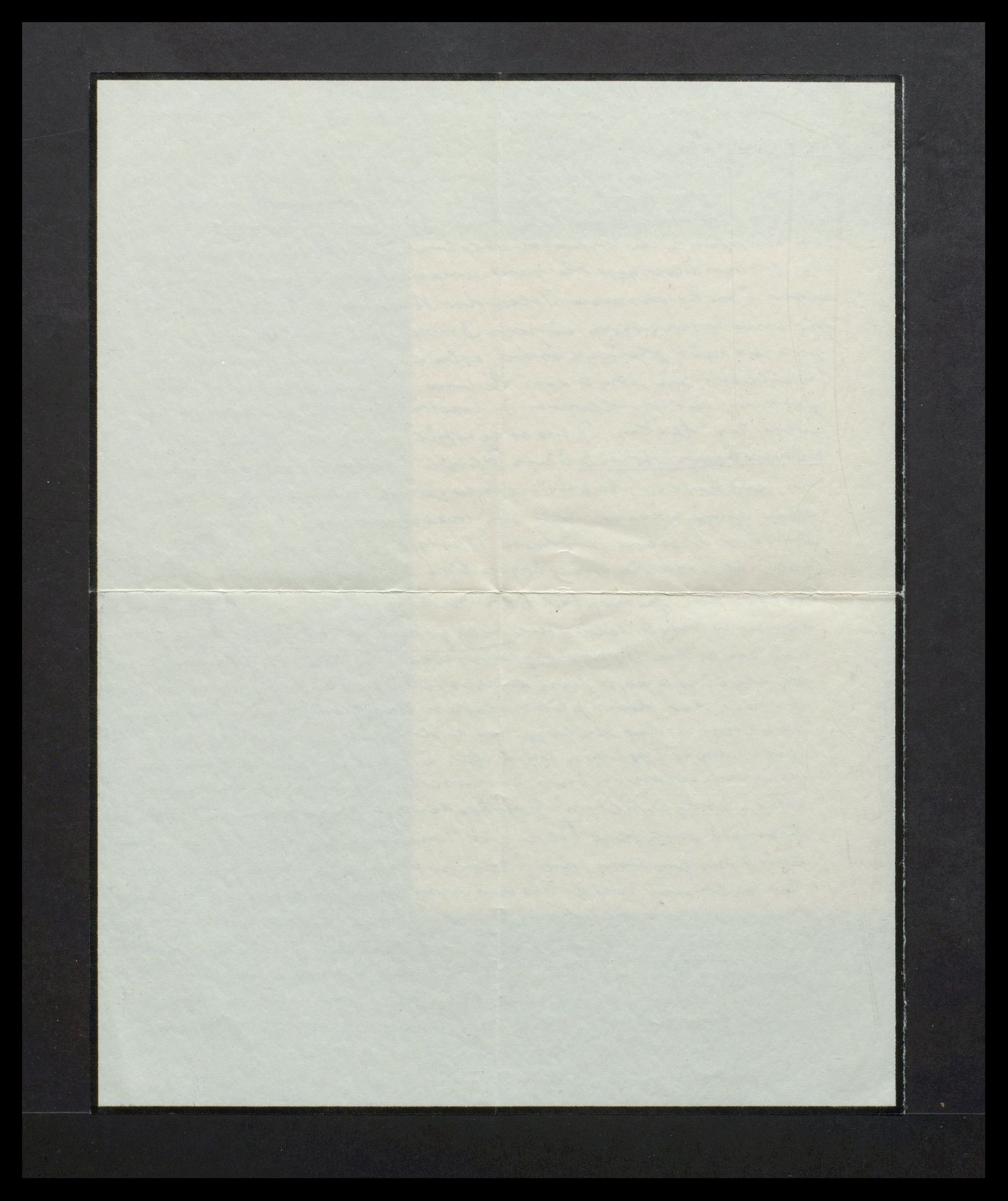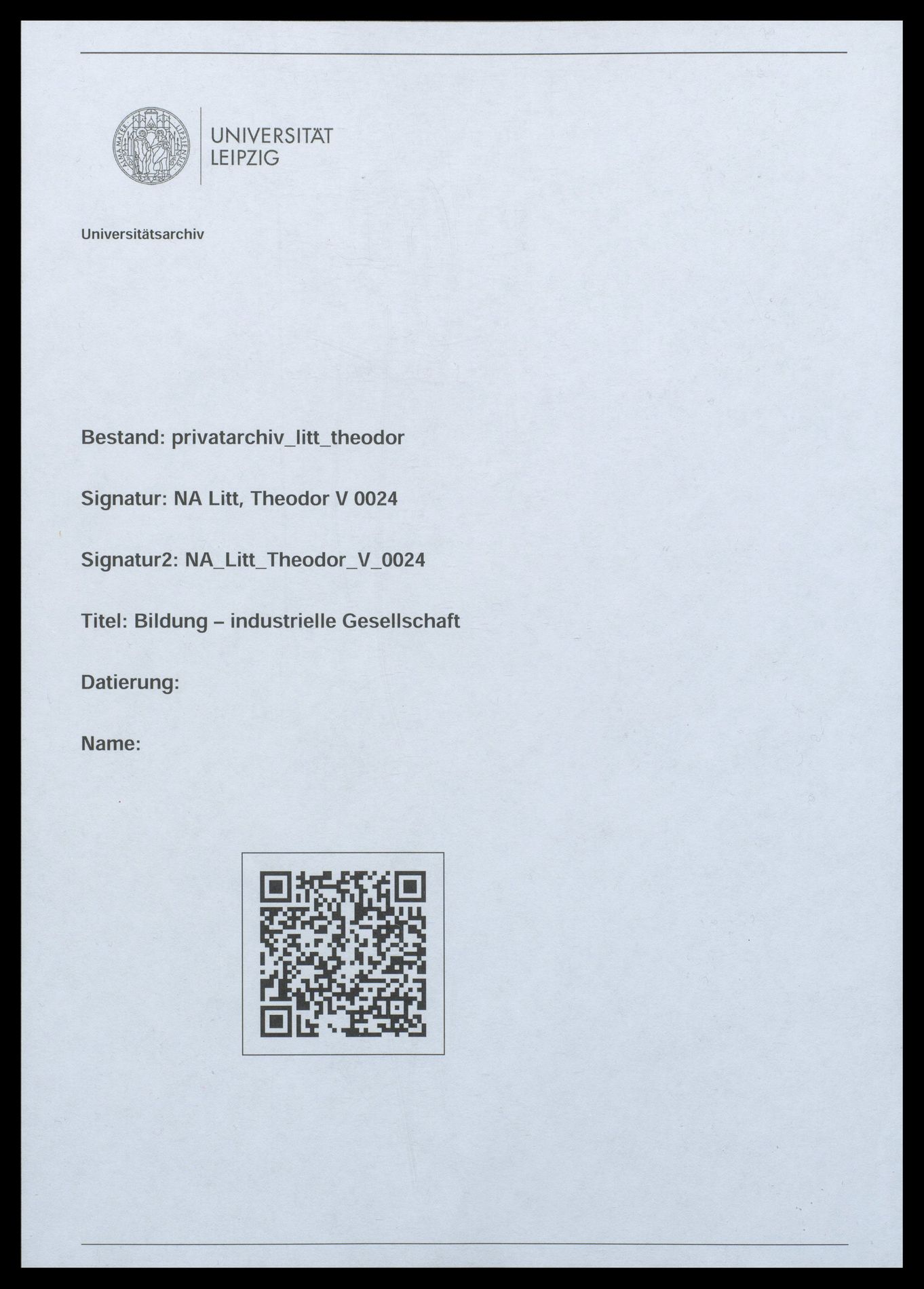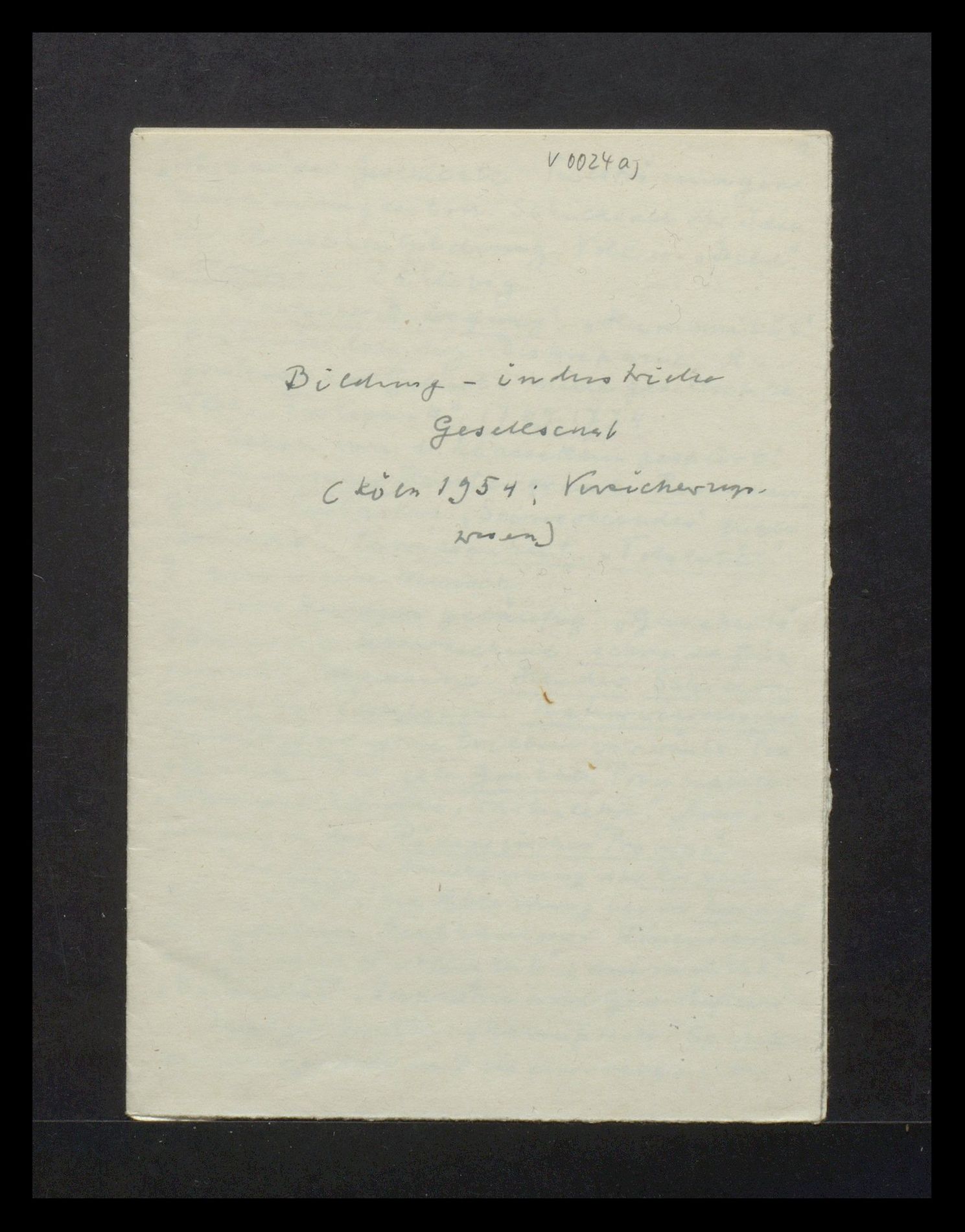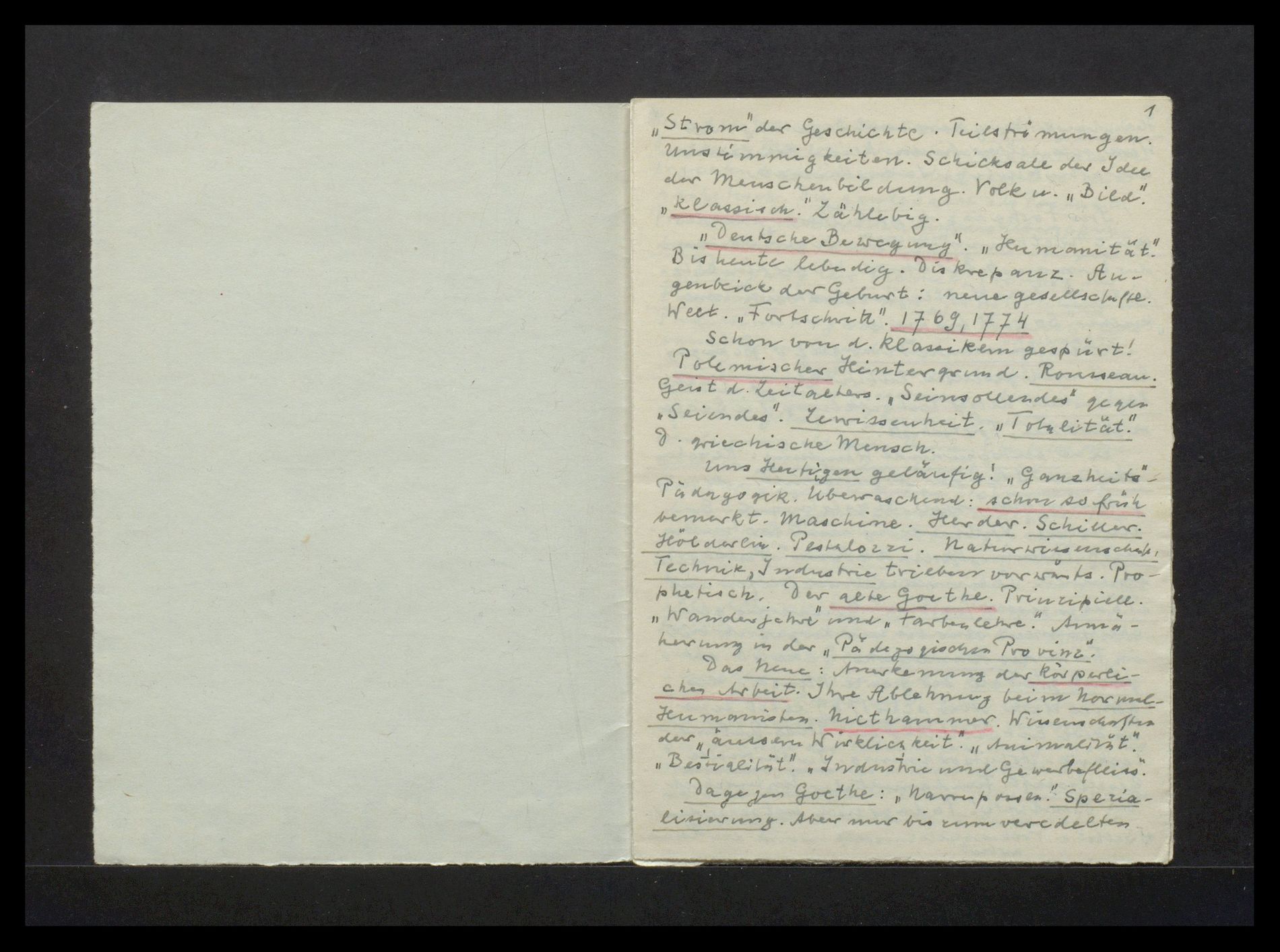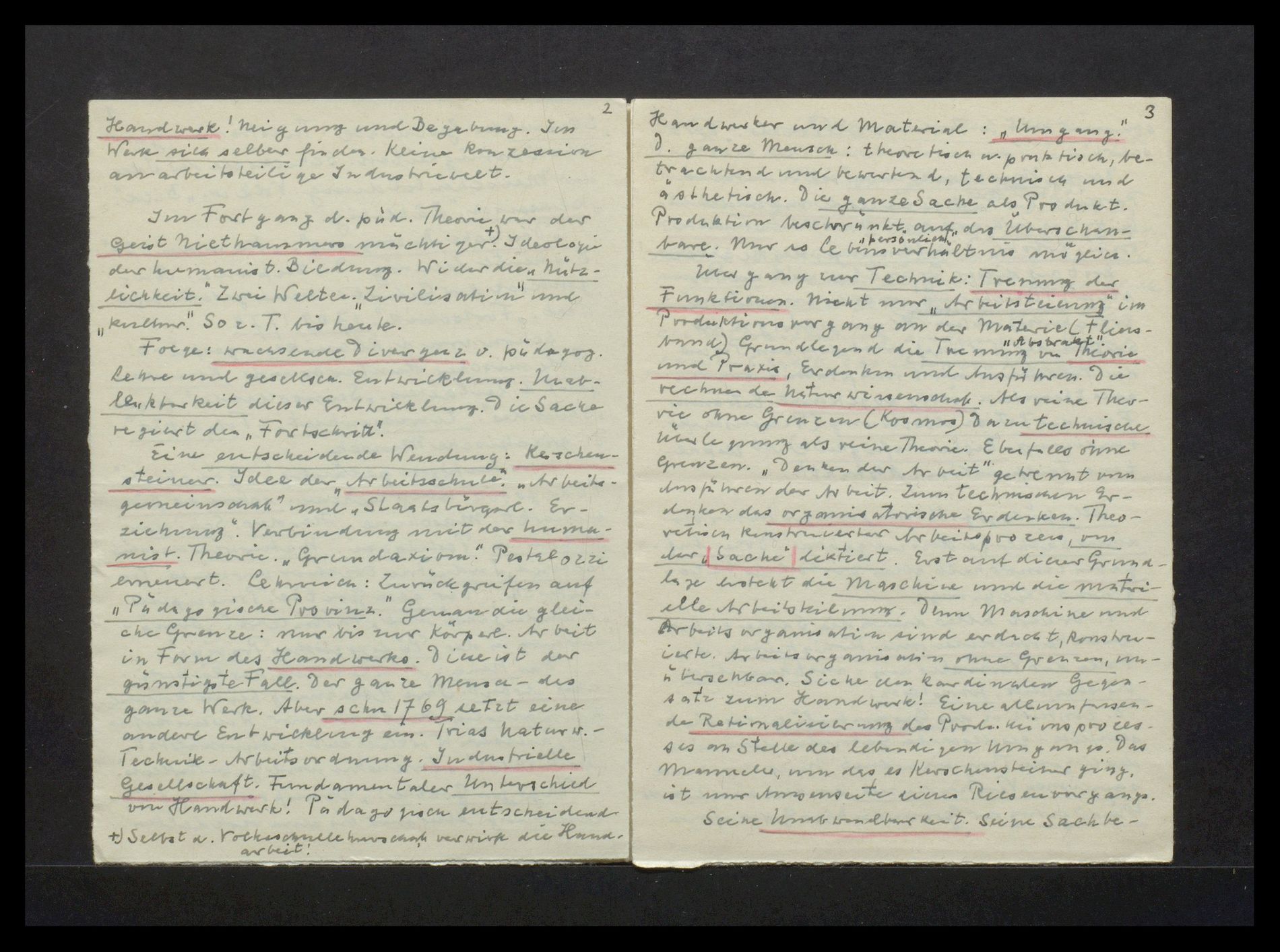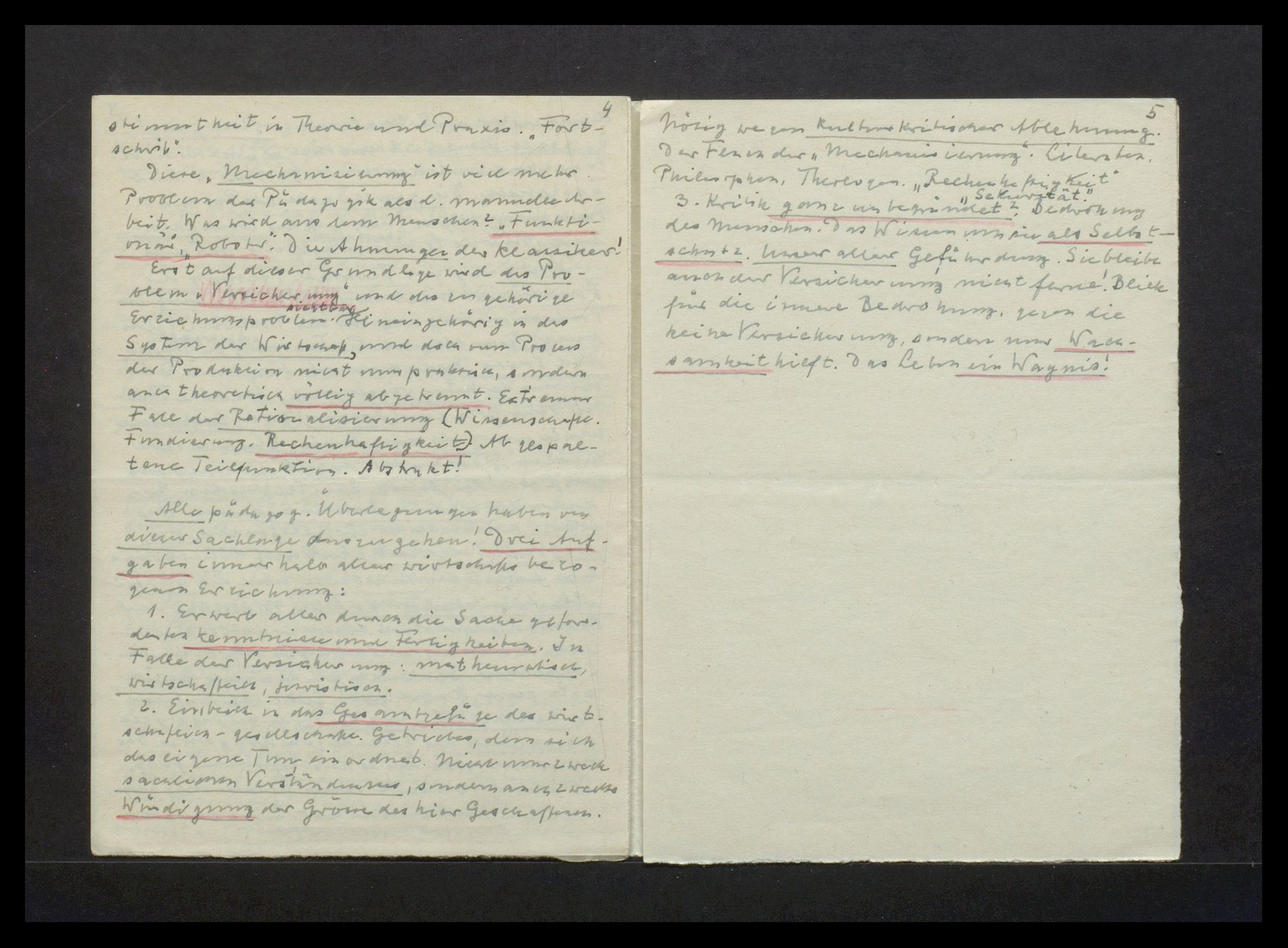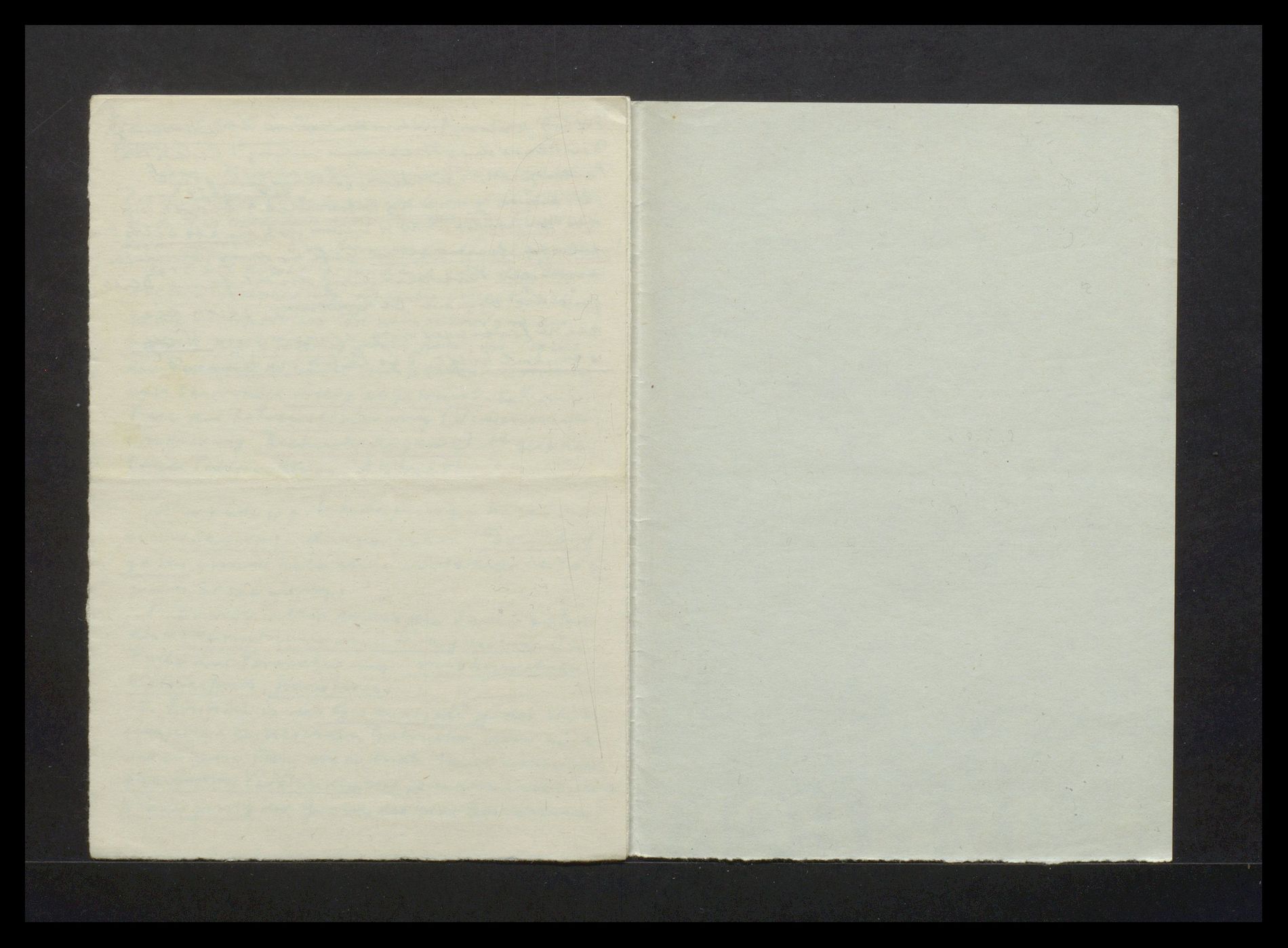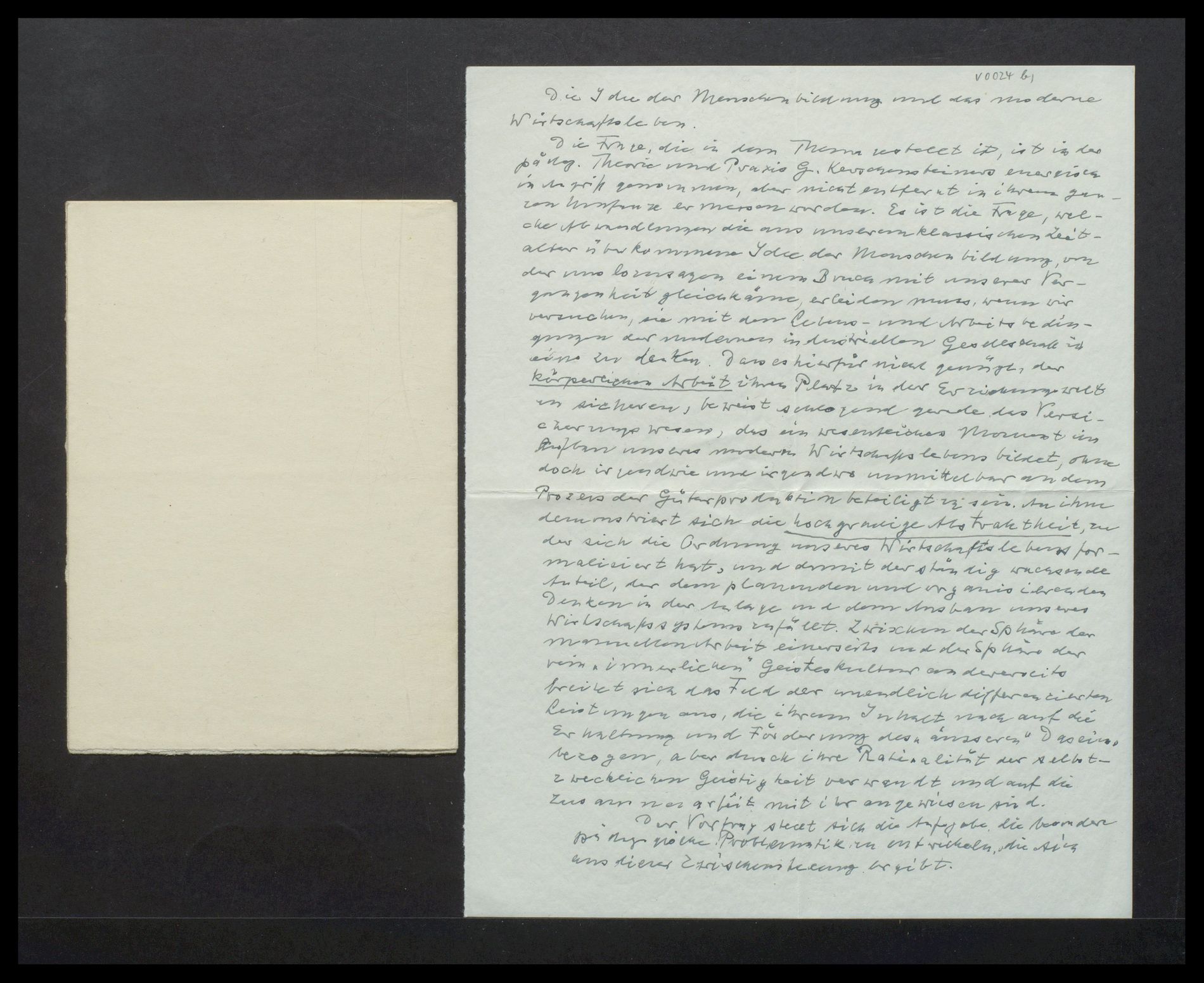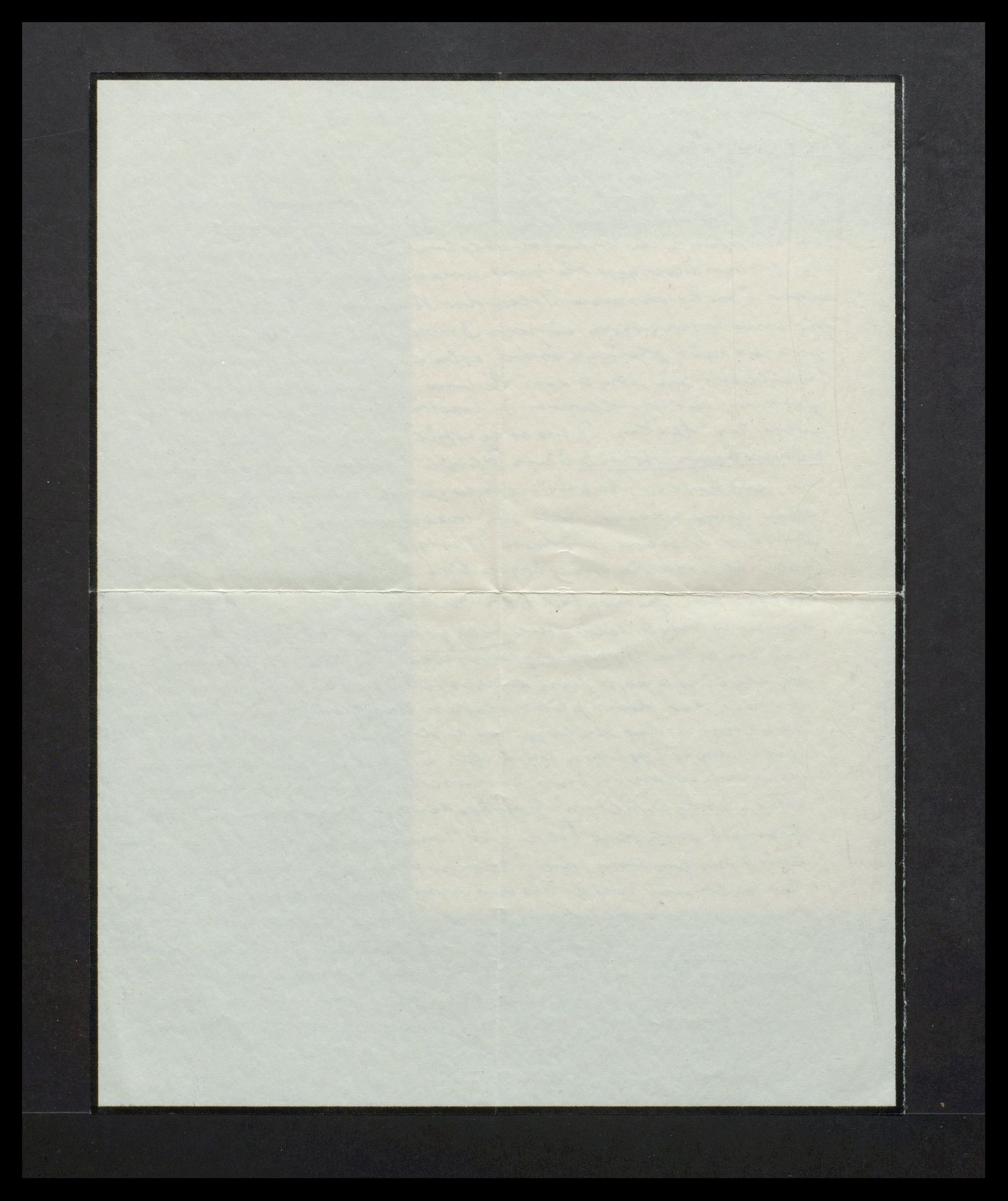| Bemerkungen | auf ehemalige Findkartei:
Bildung – industrielle Gesellschaft (in: Das Problem der Menschbildung ehedem und heute -1951-); Dokumentenabschrift: V 0024a
1954
Titelseite
Bildung – industrielle Gesellschaft
(Köln 1954; Versicherungswesen)
1
„Strom“ der Geschichte. Teilströmungen.
Unstimmigkeiten. Schicksale der Idee
der Menschenbildung. Volk u. „Bild“.
„Klassisch.“ Zählebig.
„Deutsche Bewegung“. „Humanität“.
Bis heute lebendig. Diskrepanz. Au-
genblick der Geburt: neue gesellschaftl.
Welt. „Fortschritt“. 1769, 1774
Schon von d. Klassikern gespürt!
Polemischer Hintergrund. Rousseau.
Geist d. Zeitalters. „Seinsollendes“ gegen
„Seiendes“. Zerrissenheit. „Totalität.“
D. griechische Mensch.
Uns Heutigen geläufig! „Ganzheits“-
Pädagogik. Überraschend: schon so früh
bemerkt. Maschine. Herder. Schiller.
Hölderlin. Pestalozzi. Naturwissenschaft,
Technik, Industrie trieben vorwärts. Pro-
phetisch. Der alte Goethe. Prinzipiell.
„Wanderjahre“ und „Farbenlehre“. Annä-
herung in der „Pädagogischen Provinz“.
Das Neue: Anerkennung der körperli-
chen Arbeit. Ihre Ablehnung beim Normal-
Humanisten. Niethammer. Wissenschaften
der „äusseren Wirklichkeit“. „Animalität“.
„Bestialität“. „Industrie und Gewerbefleiss“.
Dagegen Goethe: „Narrenpossen.“ Spezia-
lisierung. Aber nur bis zum veredelten
2
Handwerk! Neigung und Begabung. Im
Werk sich selber finden. Keine Konzession
an arbeitsteilige Industriewelt.
Im Fortgang d. päd. Theorie war der
Geist Niethamers mächtiger. +) Ideologie
der humanist. Bildung. Wider die „Nütz-
lichkeit.“ Zwei Welten. „Zivilisation“ und
„Kultur“. So z. T. bis heute.
Folge: wachsende Divergenz v. pädagog.
Lehre und gesellsch. Entwicklung. Unab-
lenkbarkeit dieser Entwicklung. Die Sache
regiert den „Fortschritt“.
Eine entscheidende Wendung: Kerschen-
steiner. Idee der „Arbeitsschule“. „Arbeits-
gemeinschaft“ und „Staatsbürgerl. Er-
ziehung“. Verbindung mit der huma-
nist. Theorie. „Grundaxiom“. Pestalozzi
erneuert. Lehrreich: Zurückgreifen auf
„Pädagogische Provinz“. Genau die glei-
che Grenze: nur bis zur körperl. Arbeit
in Form des Handwerks . Diese ist der
günstigste Fall. Der ganze Mensch – das
ganze Werk. Aber schon 1769 setzt eine
andere Entwicklung ein. Trias Naturw. –
Technik – Arbeitsordnung. Industrielle
Gesellschaft. Fundamentaler Unterschied
vom Handwerk! Pädagogisch entscheidend
+) Selbst d. Volksschullehrerschaft verwirft die Hand-
arbeit
3
Handwerker und Material: „Umgang“.
D. ganze Mensch: theoretisch u. praktisch, be-
trachtend und bewertend, technisch und
ästhetisch. Die ganze Sache als Produkt.
Produktion beschränkt auf das Überschau-
„persönlich“
bare. Nur so Lebensverhältnis möglich.
Übergang zur Technik: Trennung der
Funktionen. Nicht nur „Arbeitsteilung“ im
Produktionsvorgang an der Materie (Fliess-
„Abstrakt“.
band) Grundlegend die Trennung von Theorie
und Praxis, Erdenken und Ausführen. Die
rechnende Naturwissenschaft. Als reine Theo-
rie ohne Grenzen (Kosmos) Dazu technische
Überlegung als reine Theorie. Ebenfalls ohne
Grenzen. „Denken der Arbeit“ getrennt vom
Ausführen der Arbeit. Zum technischen Er-
denken das organisatorische Erdenken. Theo-
retisch konstruierter Arbeitsprozess, von
der „Sache“ diktiert. Erst auf dieser Grund-
lage ersteht die Maschine und die materi-
elle Arbeitsteilung. Denn Maschine und
Arbeitsorganisation sind erdacht, konstru-
ierte. Arbeitsorganisation ohne Grenzen, un-
übersehbar. Siehe den kardinalen Gegen-
satz zum Handwerk! Eine allumfassen-
de Rationalisierung des Produktionsprozes-
ses an Stelle des lebendigen Umgangs. Das
Manuelle, um das es Kerschensteiner ging,
ist nur Aussenseite eines Riesenvorgangs.
Seine Unabwendbarkeit. Seine Sachbe-
4
stimmtheit in Theorie und Praxis. „Fort-
schritt“.
Diese „Mechanisierung“ ist viel mehr
Problem der Pädagogik als d. manuellen Ar-
beit. Was wird aus dem Menschen? „Funkti-
onär, Roboter“. Die Ahnungen der Klassiker!
Erst auf dieser Grundlage wird das Pro-
blem „Versicherung“ und das zugehörige
Erziehungsproblem sichtbar. Hineingehörig in das
System der Wirtschaft, und doch vom Prozess
der Produktion nicht nur praktisch, sondern
auch theoretisch völlig abgetrennt. Extremer
Fall der Rationalisierung. (Wissenschaftl
Fundierung, Rechenhaftigkeit) Abgespal-
tene Teilfunktion. Abstrakt!
Alle pädagog. Überlegungen haben von
dieser Sachlage auzugehen! Drei Auf-
gaben innerhlab aller wirtschaftsbezo-
genen Erziehung:
1. Erwerb aller durch die Sache gefor-
derten Kenntnisse und Fertigkeiten. Im
Falle der Versicherung: mathematisch,
wirtschaftlich, juristisch.
2. Einblick in das Gesamtgefüge des wirt-
schaftlich-gesellschaftl. Getriebes, dem sich
das eigene Tun einordnet. Nicht nur zweck
sachlichen , sondern auch zwecks
Würdigung der Grösse des hier Geschaffenen.
5
Nötig wegen kulturkritischer Ablehnung.
Der Fluch der „Mechanisierung“. Literaten,
Philosophen, Theologen. „Rechenhaftigkeit“
„Sekurität.“
3. Kritik ganz unbegründet? Bedrohung
des Menschen. Das Wissen um sie als Selbst-
schutz. Unser aller Gefährdung. Sie bleibt
auch der Versicherung nicht ferne! Blick
für die innere Bedrohung. gegen die
keine Versicherung, sondern nur Wach-
samkeit hilft. Das Leben ein Wagnis!
V 0024b
undatiert
Die Idee der Menschenbildung und das moderne
Wirtschaftsleben.
Die Frage, die in dem Thema gestellt ist, ist in der
pädag. Theorie und Praxis G. Kerschensteiners energisch
in Angriff genommen, aber nicht entfernt in ihrem gan-
zen Umfange ermessen worden. Es ist die Frage, wel-
che Abwandlungen die aus unserem klassischen Zeit-
alter überkommene Idee der Menschenbildung, von
der uns loszusagen einem Bruch mit unserer Ver-
gangenheit gleichkäme, erleiden muss, wenn wir
versuchen, sie mit den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der modernen industriellen Gesellschaft in
eins zu denken. Dass es hierfür nicht genügt, der
körperlichen Arbeit ihren Platz in der Erziehungswelt
zu sicheren, beweist schlagend gerade das Versi-
cherungswesen, das ein wesentliches Moment im
Aufbau unseres modernen Wirtschaftslebens bildet, ohne
doch irgendwie und irgendwo unmittelbar an dem
Prozess der Güterproduktion beteiligt zu sein. An ihm
demonstriert sich die hochgradige Abstraktheit, zu
der sich die Ordnung unseres Wirtschaftslebens for-
malisiert hat, und damit der ständig wachsende
Anteil, der dem planenden und organisierenden
Denken in der Anlage und dem Ausbau unseres
Wirtschaftssystems zufällt. Zwischen der Sphäre der
manuellen Arbeit einerseits und der Sphäre der
rein „innerlichen“ Geisteskultur andererseits
breitet sich das Feld der unendlich differenzierten
Leistungen aus, die ihrem Inhalt nach auf die
Erhaltung und Förderung des „äusseren“ Daseins
bezogen, aber durch ihre Rationalität der selbst-
zwecklichen Geistigkeit verwandt und auf die
Zusammenarbeit mit ihr angewiesen sind.
Der Vortrag stellt sich die Aufgabe, die besondere
pädagogische Problematik zu entwickeln, die sich
aus dieser Zwischenstellung ergibt. |