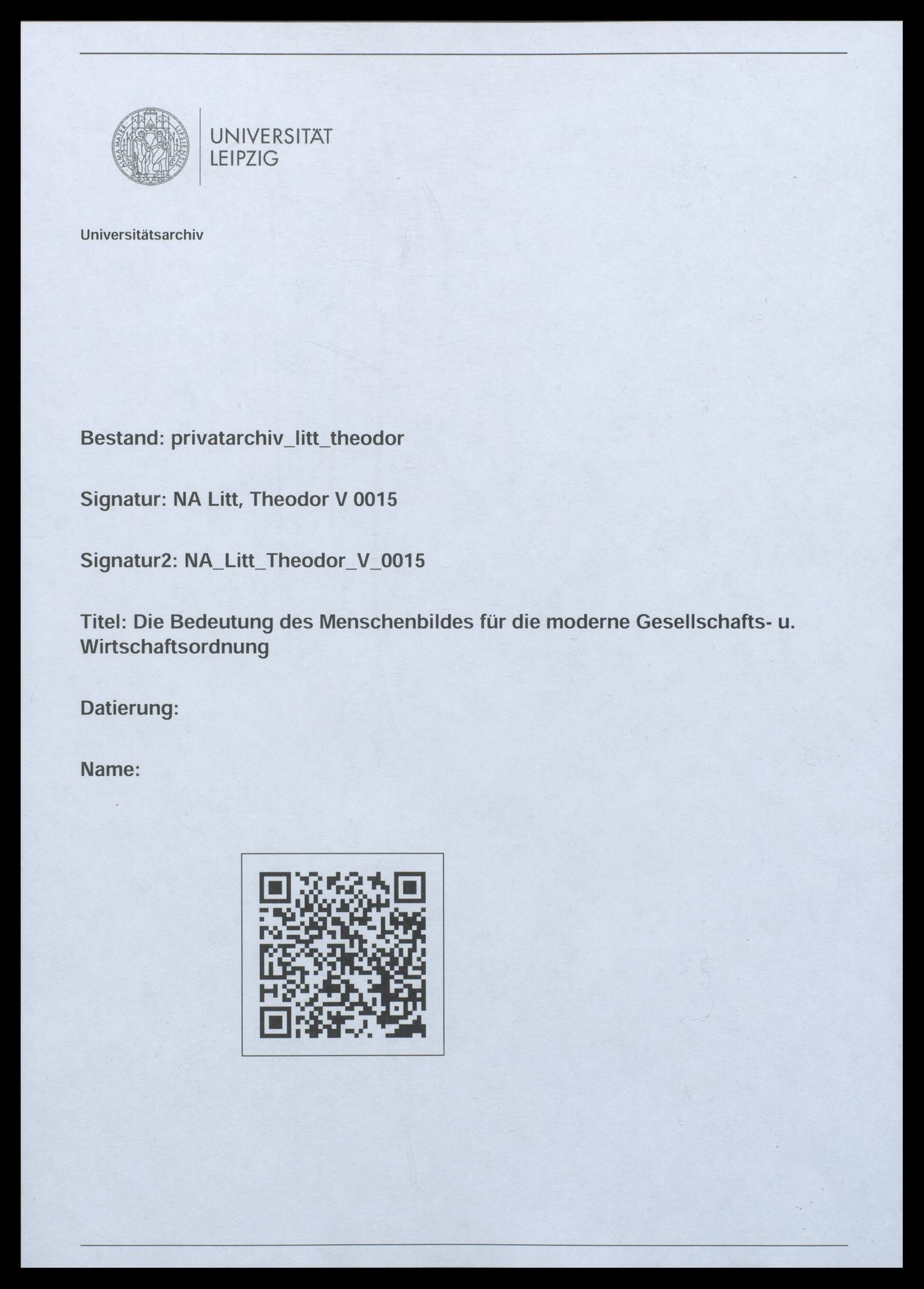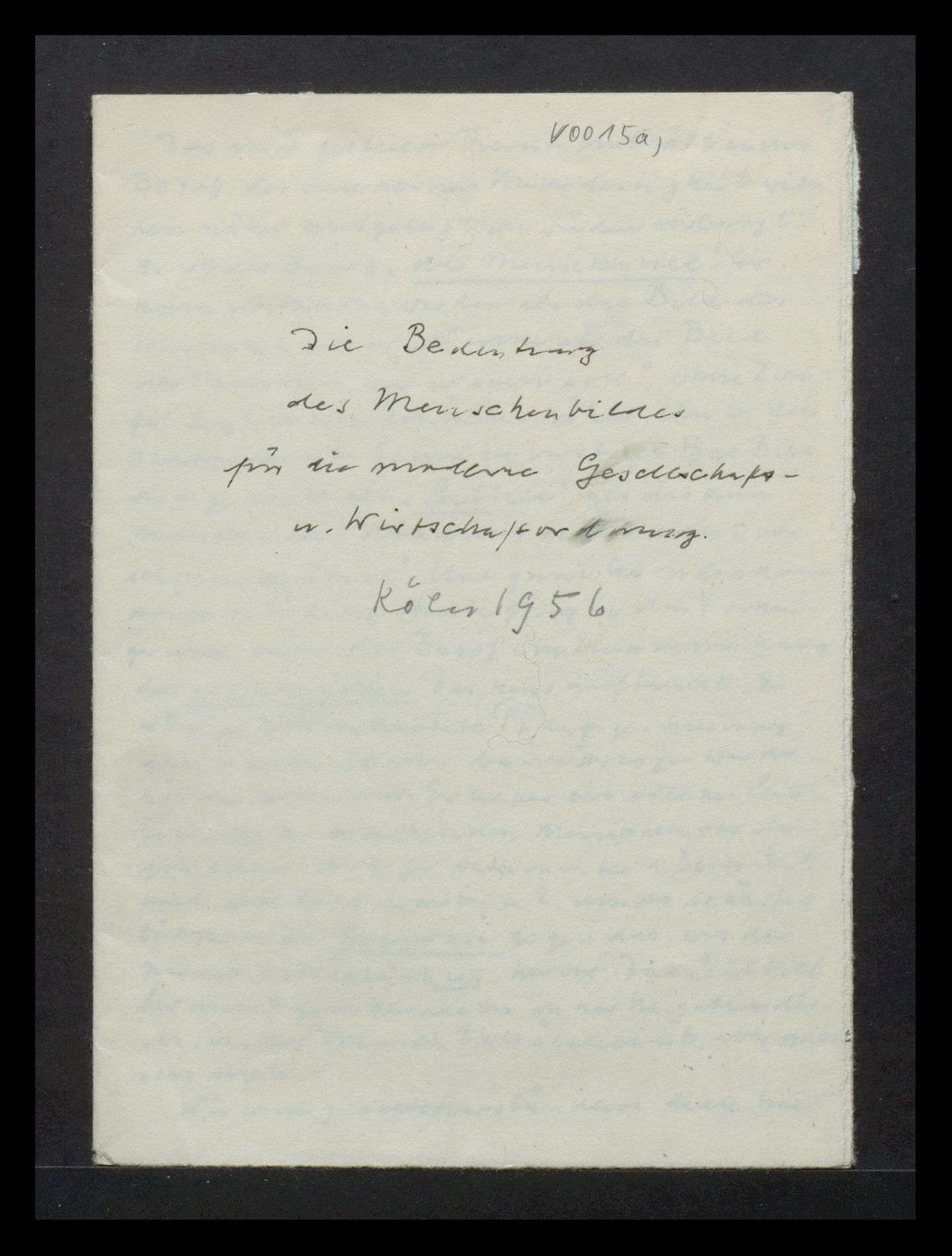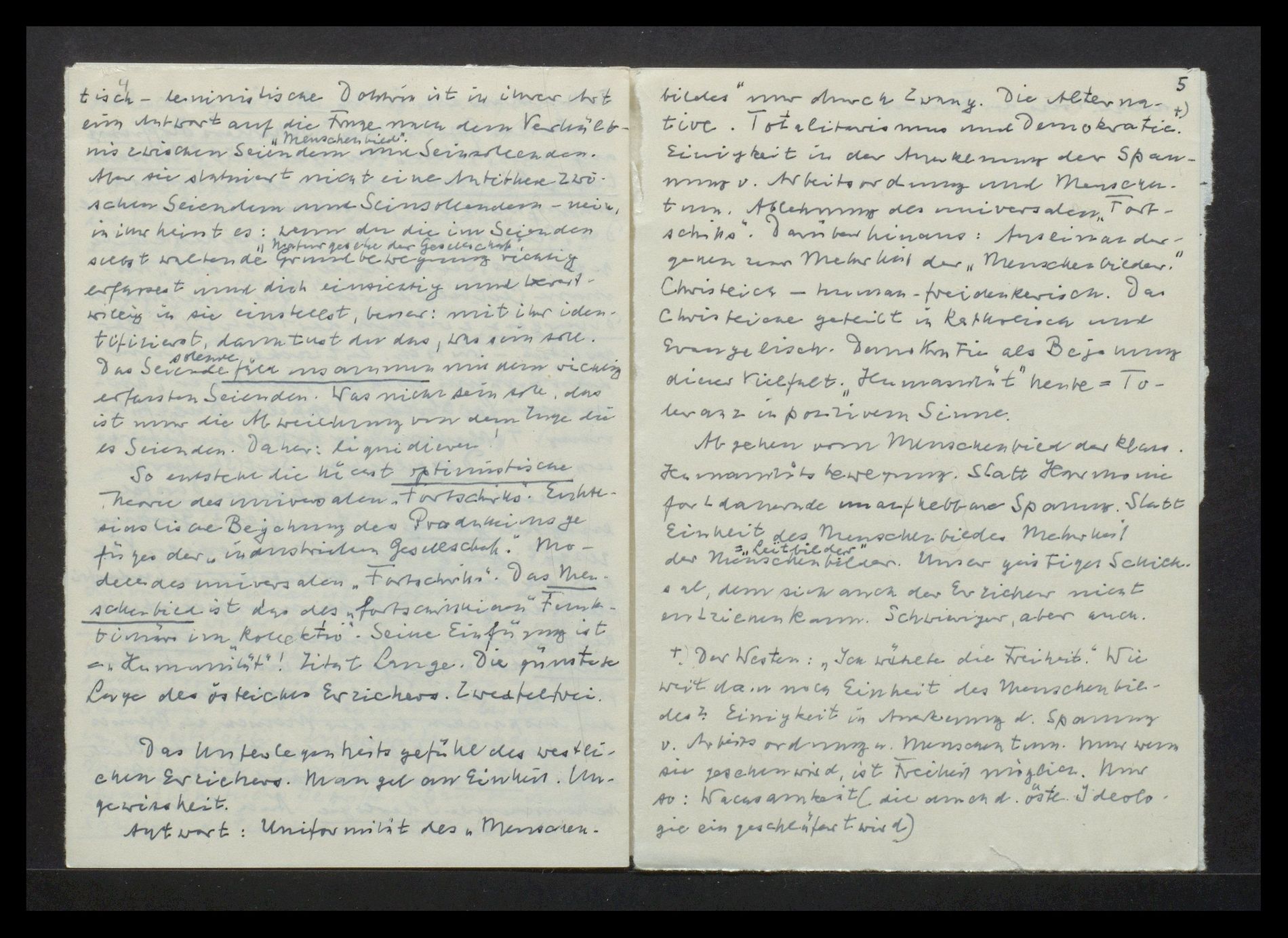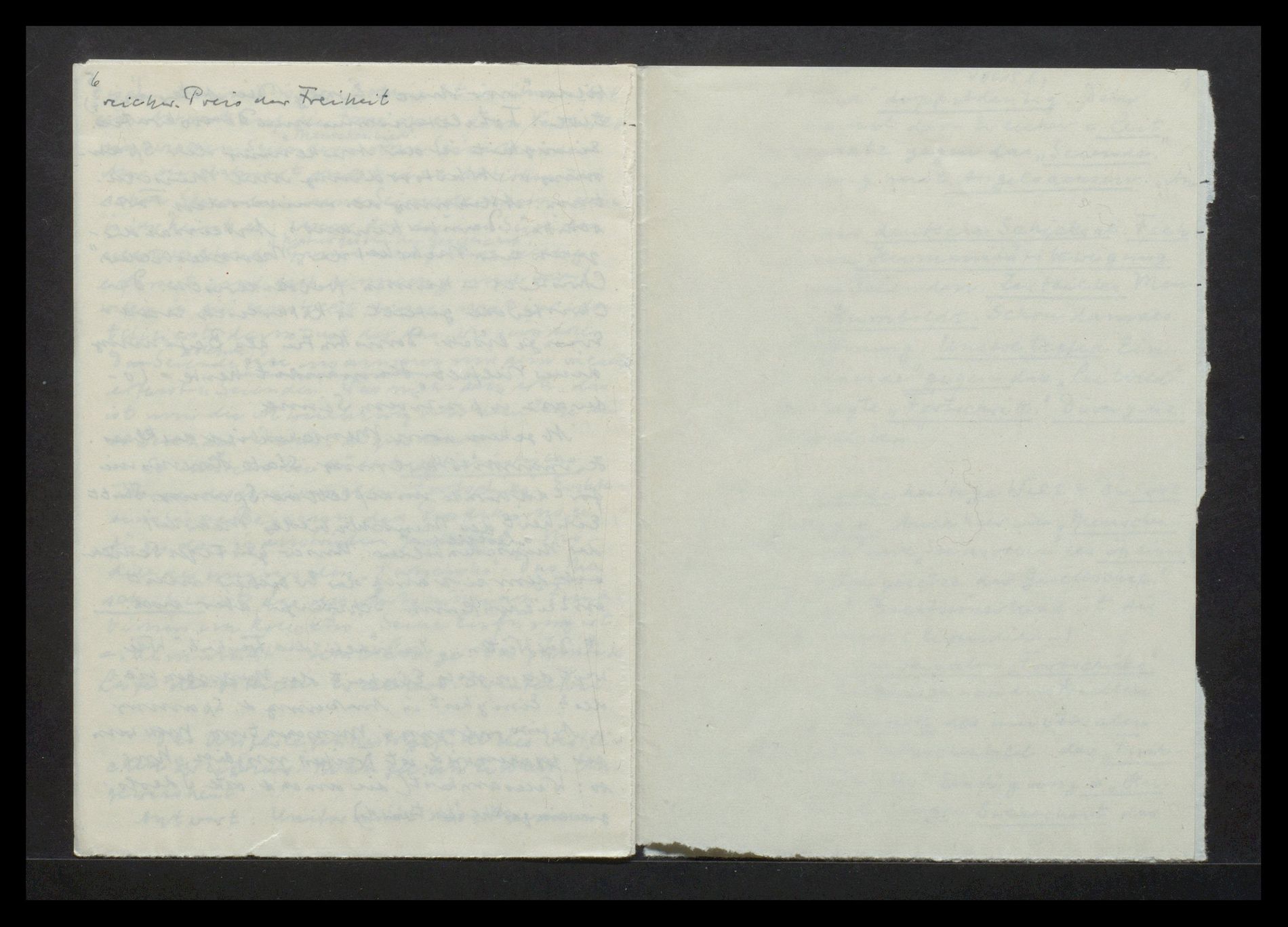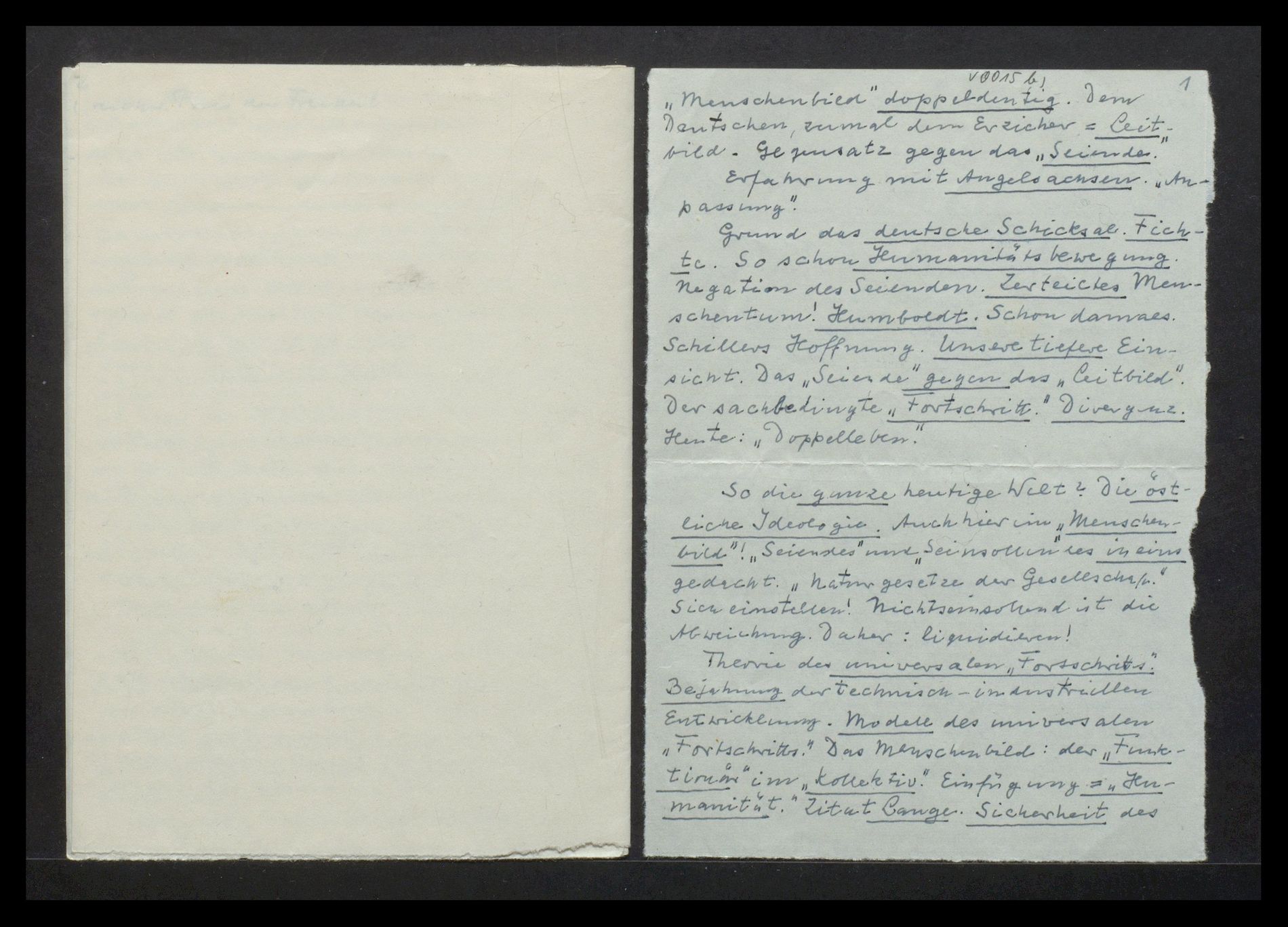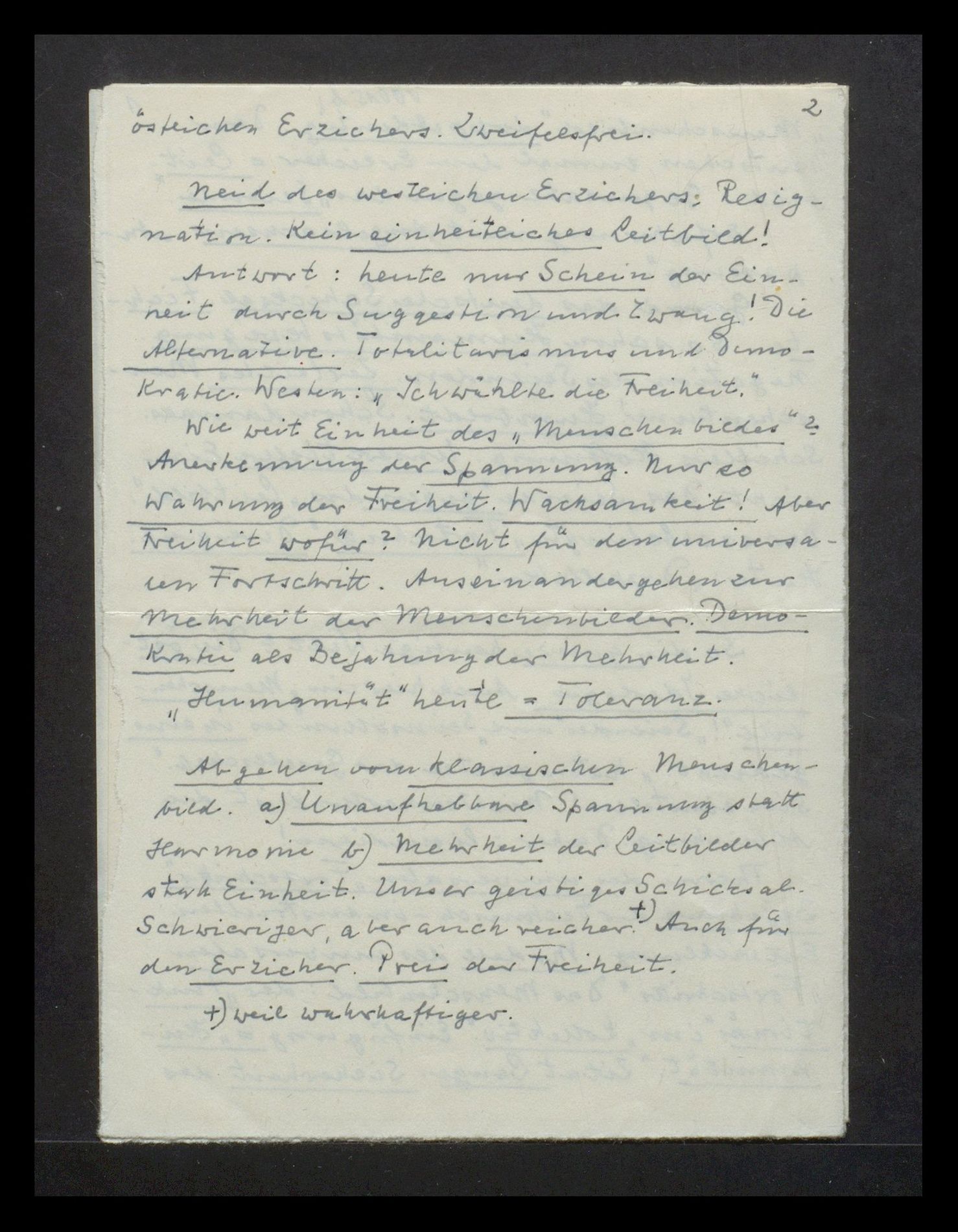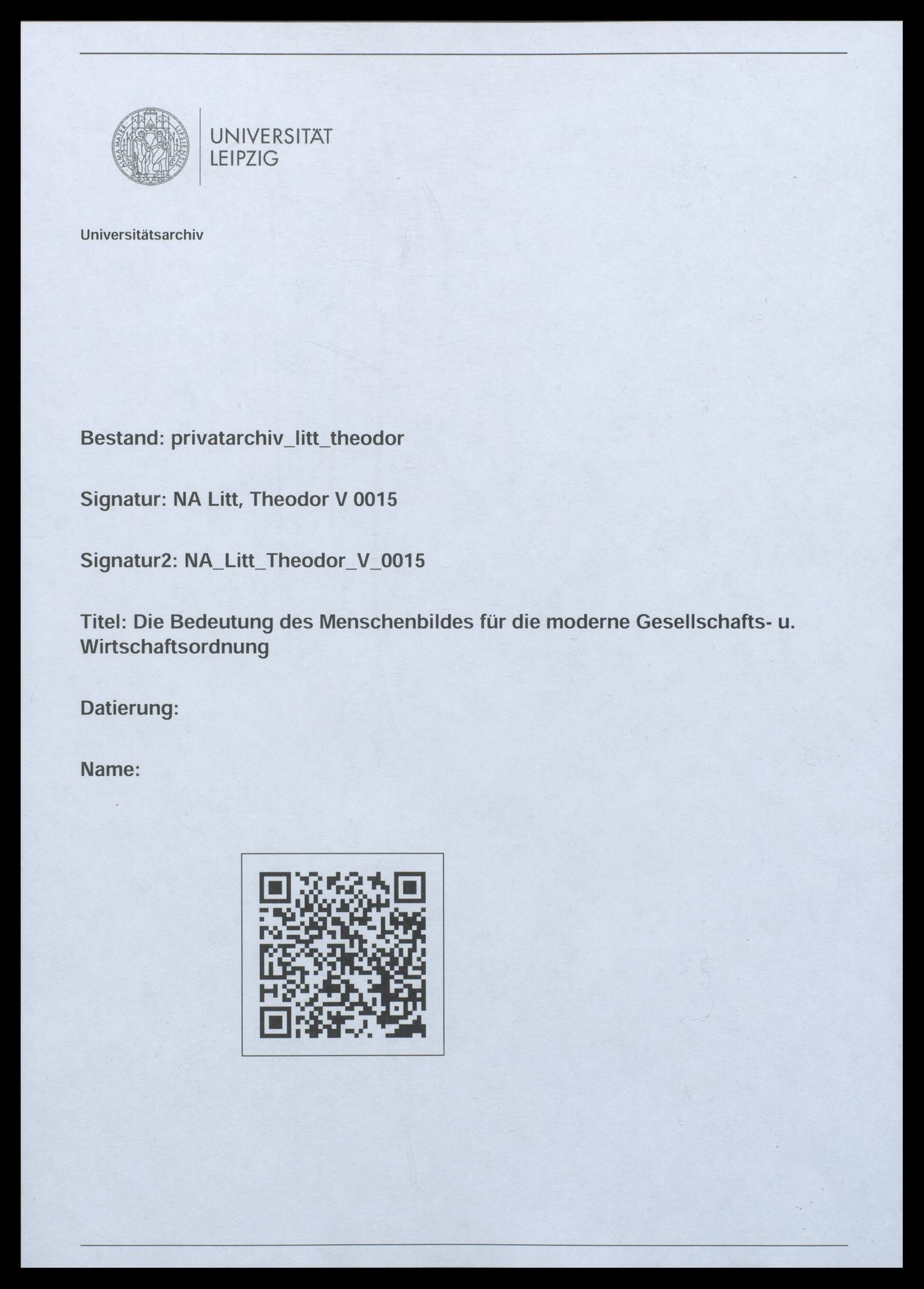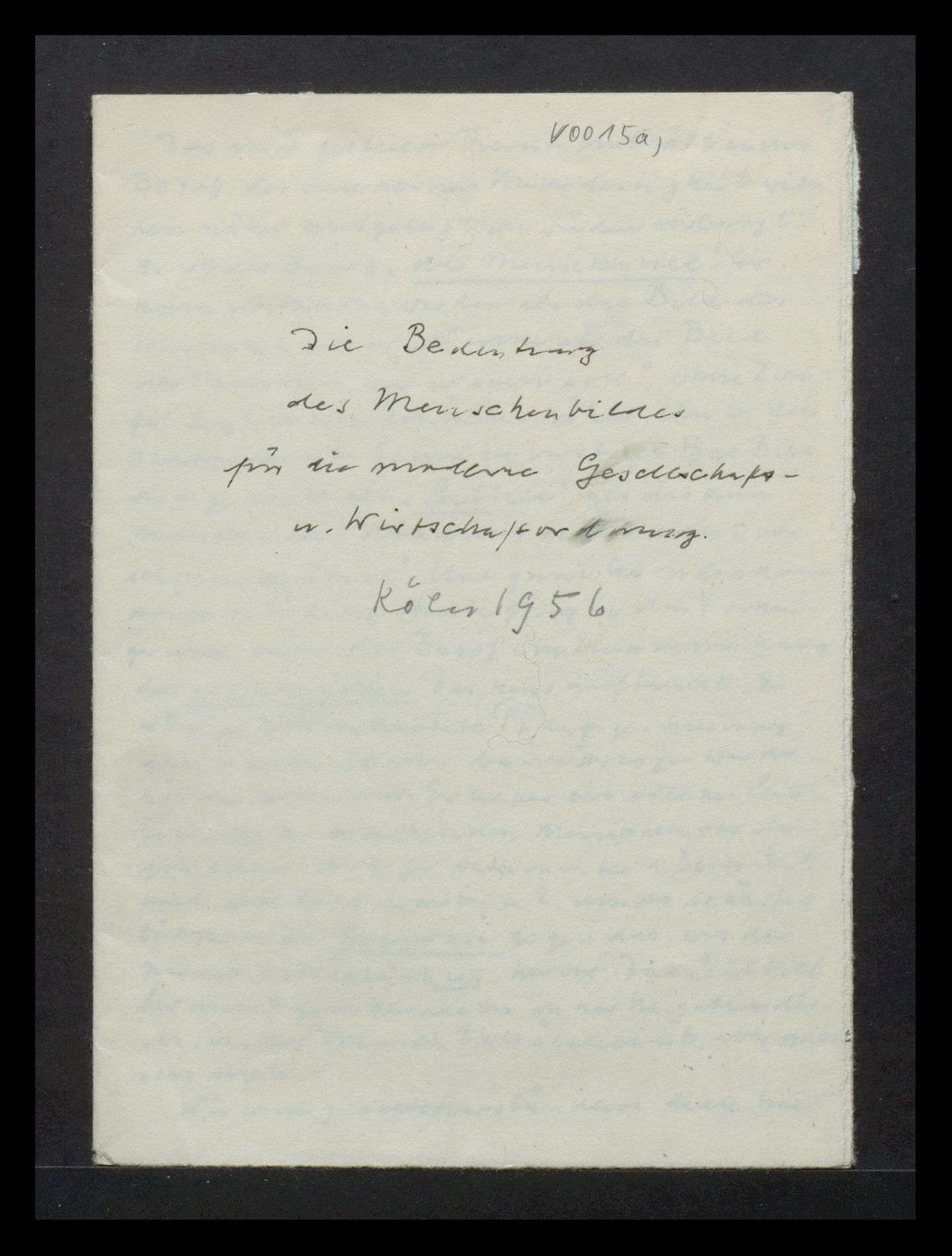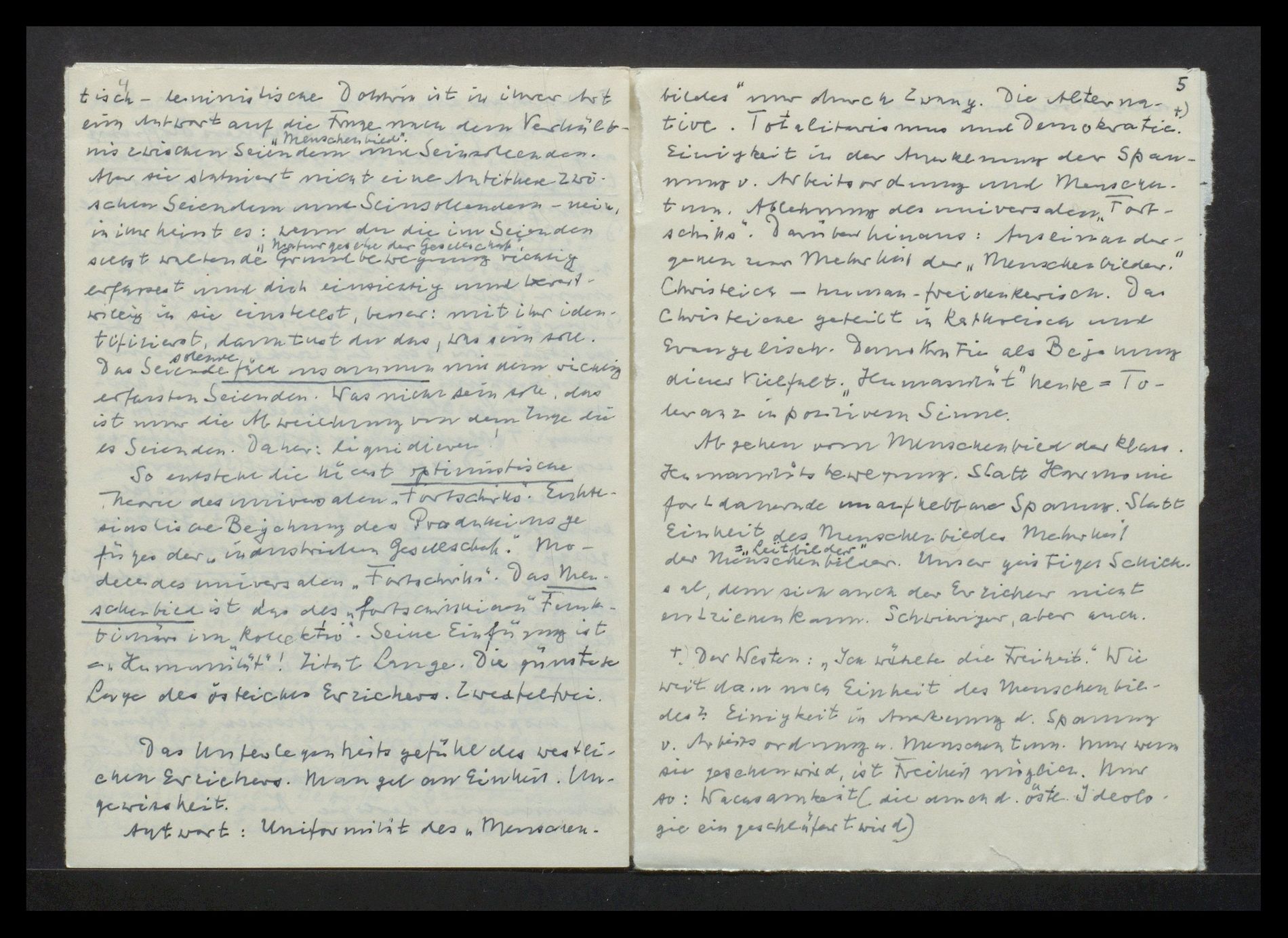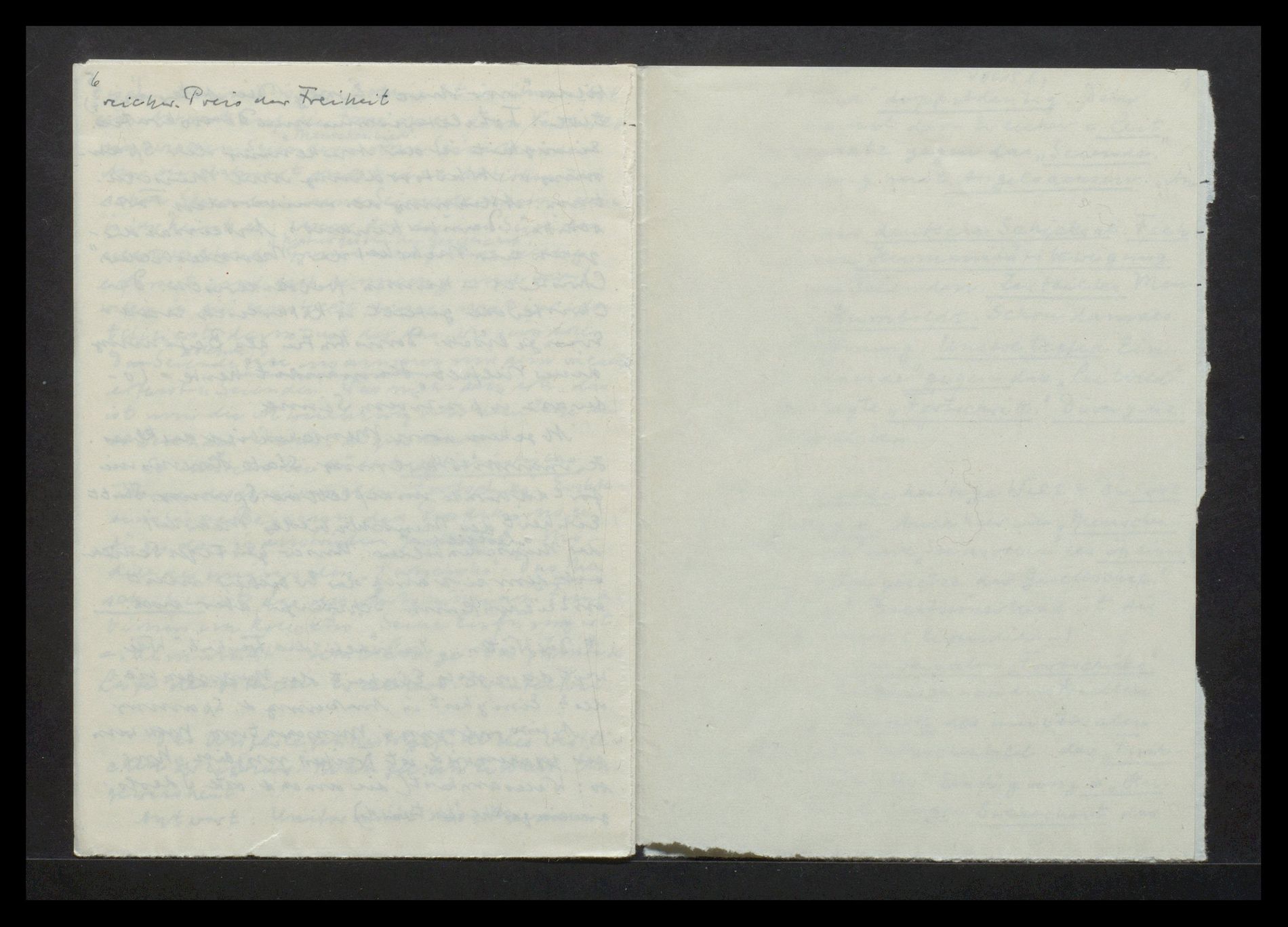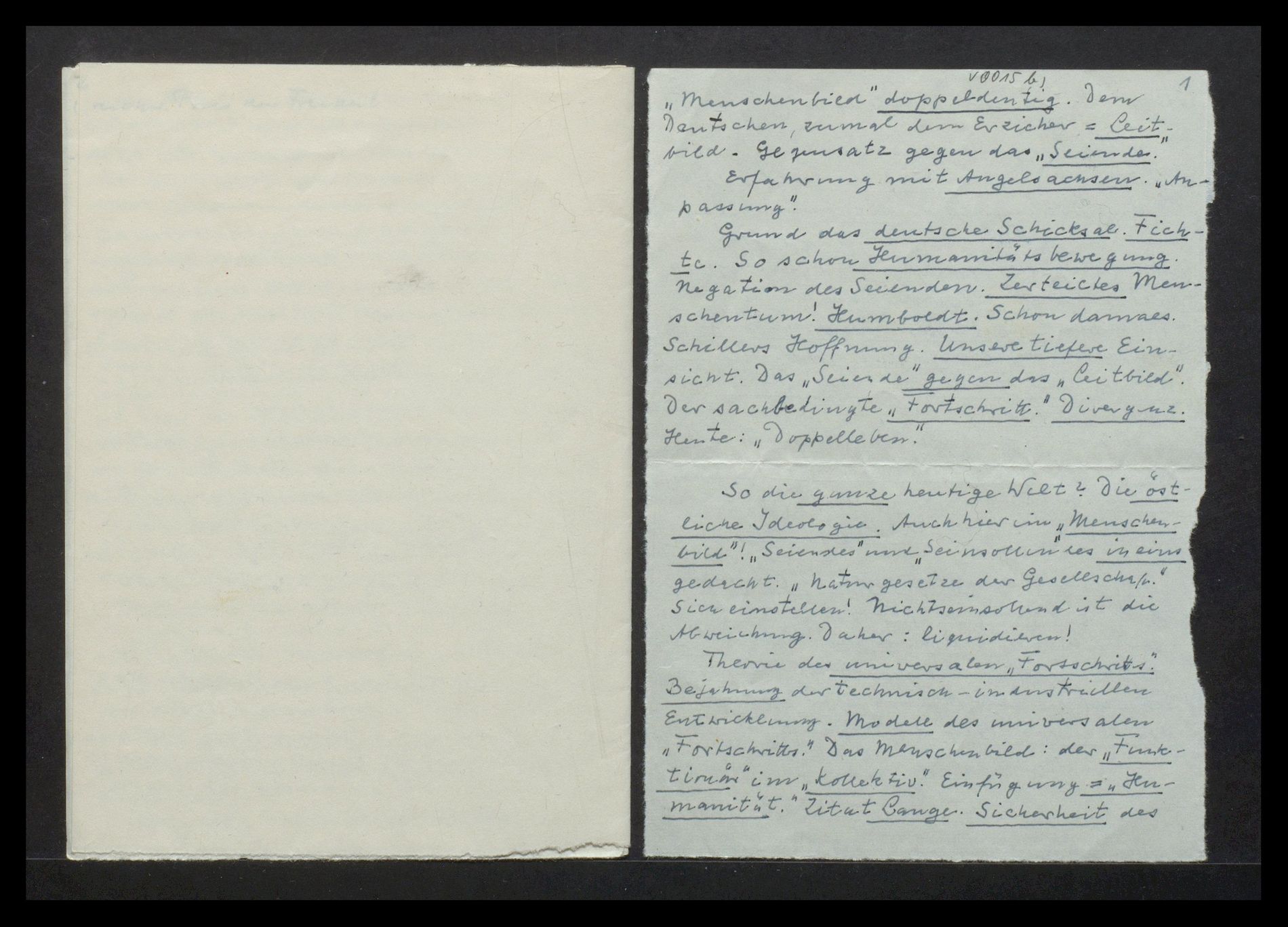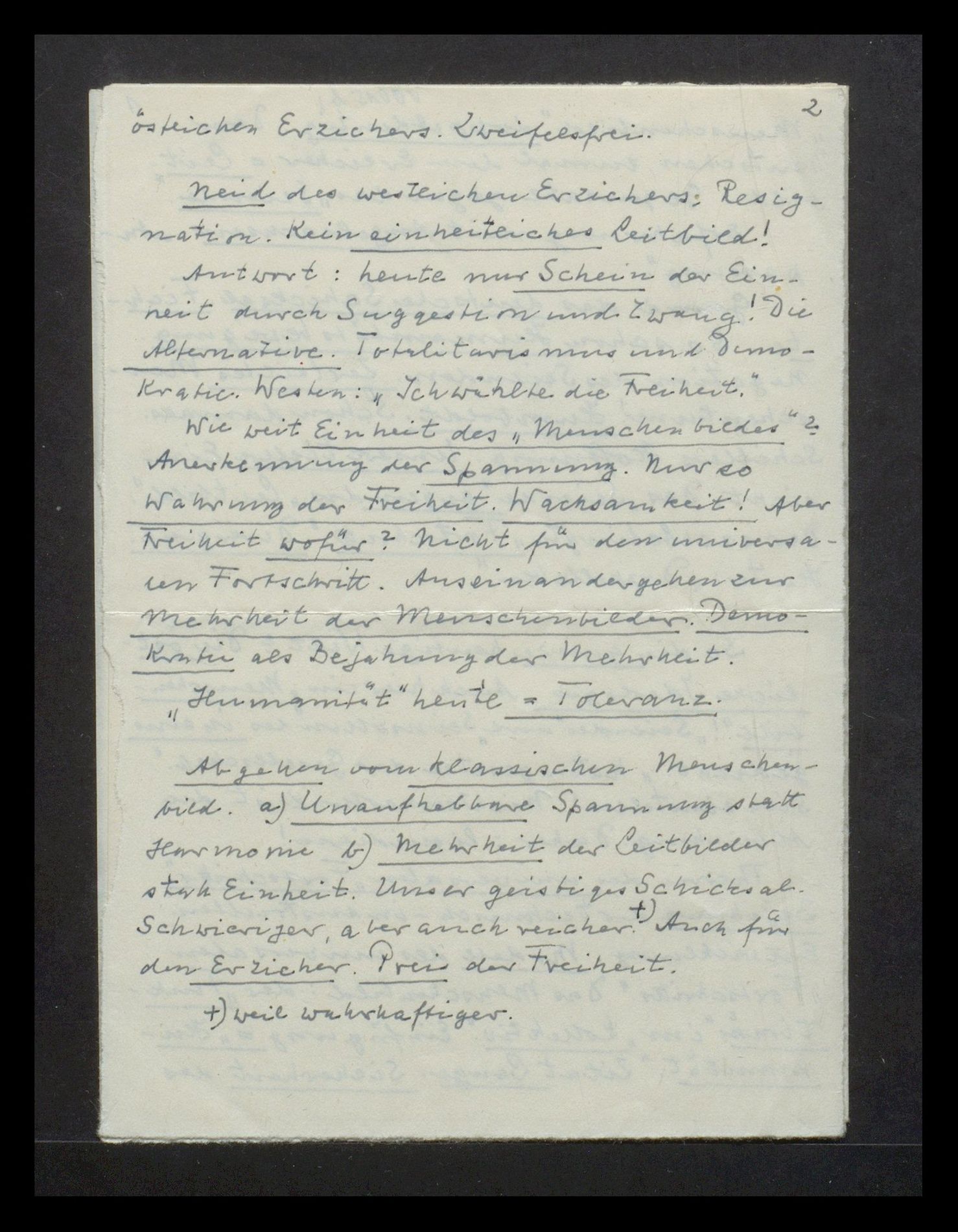| Bemerkungen | auf alter Verzeichnungskarte:
Die Bedeutung des Menschenbildes für die moderne Gesellschafts- u. Wirtschaftsordnung.
Köln 1956
(in: Das Problem der Menschenbildung ehedem und heute
1951); Dokumentenabschrift: V 0015a
Köln 1956
Titelblatt
Die Bedeutung des Menschenbildes für die moderne Gesellschafts- u. Wirtschaftsordnung.
Köln 1956
1
Das mir gestellte Thema enthält einen
Begriff, der um seiner Mehrdeutigkeit wil-
len näher ausgelegt zu werden verlangt.
Es ist der Begriff „das Menschenbild“. Er
kann verstanden werden als das Bild des
Menschen, wie er „ist“, und als das Bild
des Menschen, wie er „sein soll“. Ohne zwei-
fel liegt es uns Deutschen näher, ihn in dem
zweitgenannten sinne zu verstehen, Das Bild
wird gedacht als „Leitbild“, als das dem
Menschen als Vollendung seiner selbst vor-
schwebenden „Ideal“. Und ganz besonders dann
sich diese Auslegung in den Vorder-
grund, wenn der Begriff im Zusammenhang
des erzieherischen Denkens auftaucht. Es
ist eine weitverbreitete Pädagogenmeinung,
dass überhaupt nur dann erzogen werden
könne, wenn dem Erzieher ein solches Leit-
bild des zu erziehenden Menschen vor Au-
gen stehe. Und je bestimmter dieses Leit-
bild sich herausarbeitet, um so schärfer
tritt auch der Gegensatz gegen das, was der
Mensch tatsächlich ist, hervor. Das Leitbild
formiert sich geradezu in der Negation des-
sen, was der Mensch tatsächlich ist, aber nicht
sein sollte.
Wie wenig selbstverständlich diese her-
2
vorhebende Accentuierung dessen, was „sein
soll“ tatsächlich ist, das ist mir nie so
deutlich geworden wie in den zahlreichen
Unterredungen und Verhandlungen, die in
der Nachkriegszeit die deutschen und
die angelsächsischen Vertreter von Theorie
und Praxis der Erziehung zusammen-
geführt haben. Das angelsächsische Aus-
gehen von dem was „ist“. Empiristische Denk-
gewöhnung und zutrauen zu der Güte
des Gegebenen. Kein antithetisch auf-
gestelltes Leitbild. „Anpassung“ (ad-
justment“)
Grund dieser Verschiedenheit: das
deutsche Schicksal. Fichte. Aber schon
vorher: Humanitätsbewegung. Das
Humanittätsideal ist geboren in der Auf-
lehnung wider den Geist oder viel mehr
Ungeist der Epoche. Es gewinnt geradezu
seine Profilierung durch Negation des
Seienden. Von Winckelmann bis Hölder-
lin u. Pestalozzi: das geteilte gespaltene
Menschentum. Humboldts Grundbegriffe
als Antithetische Begriffe. Schon bei Herder,
Schiller: d. Fluch der Arbeitsteilung.
3
Schon damals, in den Anfängen der „in-
dustriellen Gesellschaft“. Schillers Hoffnung
auf neue, höhere „Humanität“. Unsere
tiefere Einsicht: ein unabwendbares u.
unaufhaltsam fortschreitendes Schicksal.
Das „Seiende“ setzt sich unwiderstehlich
gegen das „Seinsollende“, d. i. das „hu-
mane“ Leitbild durch! Die zunehmende
Divergenz zwischen der Faktizität der
gesellsch.-wirtsch. Entwicklung und
dem immer noch festgehaltenen „hu-
manen“ Leitbild. Doppelte Buchfüh-
rung. Fortlebend im heutigen Litera-
tentum. „Doppelleben.“ Seit St. George.
Allerdings: umfasst diese Darstel-
lung die ganze heutige Welt? Genauer
gesagt: die Gesamtheit derjenigen Völ-
ker, die die moderne arbeitsteilige industrie-
lle Ordnung zur Perfektion emporentwik-
kelt haben? Empfindet man allent-
halben den Widerspruch zwischen den An-
forderungen dieser Produktionsordnung und
den Ansprüchen, die der Mensch als Mensch
zu stellen hat? Die Antwort gibt der Blick
auf den Osten, genauer: auf die den Osten
beherrschende Ideologie. Auch die marxis-
4
tisch-leninistische Doktrin ist in ihrer Art
eine Antwort auf die Frage nach dem Verhält-
„Menschenbild“.
nis zwischen Seiendem und Seinsollenden.
Aber sie statuiert nicht eine Antithese zwi-
schen Seiendem und Seinsollendem – nein,
in ihr heisst es: wenn du die im Seienden
„Naturgesetze der Gesellschaft“.
selbst waltende Grundbewegung richtig
erfassest und dich einsichtig und bereit-
willig in sie einstellst, besser: mit ihr iden-
tifizierst, dann tust du das, was sein soll.
sollende
Das Seiende zusammen mit dem richtig
erfassten Seienden. Was nicht sein soll, das
ist die Abweichung von dem Zuge die
es Seienden. Daher liquidieren!
So entsteht die höchst optimistische
Theorie des universalen „Fortschritts“. Enthu-
siastische Bejahung des Produktionsge-
füges der „industrielen Gesellschaft“. Mo-
dell des universalen „Fortschritts“. Das Men-
schenbild ist das des „fortschrittlichen“ Funk-
tionärs im „Kollektiv“. Seine Einfügung ist
= „Humanität“! Zitat Lange. Die
Lage des östlichen Erziehers. Zweifelfrei.
Das Unterlegenheitsgefühl des westli-
chen Erzeihers. Mangel an Einheit. Un-
gewissheit.
Antwort: Uniformität des „Menschen-
5
bildes“ nur durch Zwang. Die Alterna-
tive. Totalitarismus und Demokratie. +)
Einigkeit in der Anerkennung der Span-
nung v. Arbeitsordnung und Menschen-
tum. Ablehnung des universalen „Fort-
schritts“. Darüber hinaus: Auseinander-
gehen zur Mehrheit der „Menschenbilder“.
Christlich – human - freidenkerisch. Das
Christliche geteilt in katholisch und
Evangelisch. Demokratie als Bejahung
einer Vielfalt. „Humanität“ heute = To-
leranz in positivem Sinne.
Abgesehen vom Menschenbild der klass.
Humanitätsbewegung. Statt Harmonie
fortdauernde unaufhebbare Spannung. Statt
Einheit des Menschenbildes Mehrheit
= „Leitbilder“
der Menschenbilder. Unser geistiges Schick-
sal, dem sich auch der Erzieher nicht
entziehen kann. Schwieriger, aber auch.
+) Der Westen: „Ich wählte die Freiheit“. Wie
weit darin noch Einheit des Menschenbil-
des? Einigkeit in Anerkennung d. Spannung
v. Arbeitsordnung u. Menschentum. Nur wenn
sie gesehen wird, ist Freiheit möglich. Nur
so: Wachsamkeit (die auch d. östl. Ideolo-
gie eingeschläfert wird)
6
reicher. Preis der Freiheit
V 0015b
1
“Menschenbild” doppeldeutig. Dem
Deutschen, zumal dem Erzieher = Leit-
bild. Gegensatz gegen das „Seiende“.
Erfahrung mit Angelsachsen. „An-
passung“.
Grund das deutsche Schicksal. Fich-
te. So schon Humanitätsbewegung.
Negation des Seienden. Zerteiltes Men-
schentum! Humboldt. Schon damals.
Schillers Hoffnung. Unsere tiefere Ein-
sicht. Das „Seiende“ gegen das „Leitbild“.
Der sachbedingte „Fortschritt“. Divergenz.
Heute: „Doppelleben“.
So die ganze heutige Welt? Die öst-
liche Ideologie. Auch hier ein „Menschen-
bidl“! „Seiendes“ und „Seinsollendes“ in eins
gedacht. „Naturgesetze der Gesellschaft.“
Sich einstellen! Nichtseinsollend ist die
Abweichung. Daher: liquidieren!
Theorie des universalen „Fortschritt“.
Bejahung der technisch- industriellen
Entwicklung. Modell des universalen
„Fortschritts“. Das Menschenbild: der „Funk-
tionär“ im „Kollektiv“. Einfügung =“Hu-
manität“. Zitat Lange. Sicherheit des
2
östlichen Erziehers. Zweifelsfrei.
Neid des westlichen Erziehers: Resig-
nation. Kein einheitliches Leitbild!
Antwort: heute nur Schein der Ein-
heit durch Suggestion und Zwang! Die
Alternative. Totalitarismus und Demo-
kratie. Westen: „Ich wählte die Freiheit.“
Wie weit Einheit des „Menschenbildes“?
Anerkennung der Spannung. Nur so
Wahrung der Freiheit. Wachsamkeit! Aber
Freiheit wofür? Nicht für den universa-
len Fortschritt. Auseinandergehen zur
Mehrheit der Menschenbilder. Demo-
kratie als Bejahung der Mehrheit.
„Humanität“ heute = Toleranz.
Abgehen vom klassischen Menschen-
bild. a) Unaufhebbare Spannung statt
Harmonie b) Mehrheit der Leitbilder
statt Einheit. Unser geistiges Schicksal.
Schwieriger, aber auch reicher. +) Auch für
den Erzieher. Preis der Freiheit.
+) weil wahrhaftiger. |