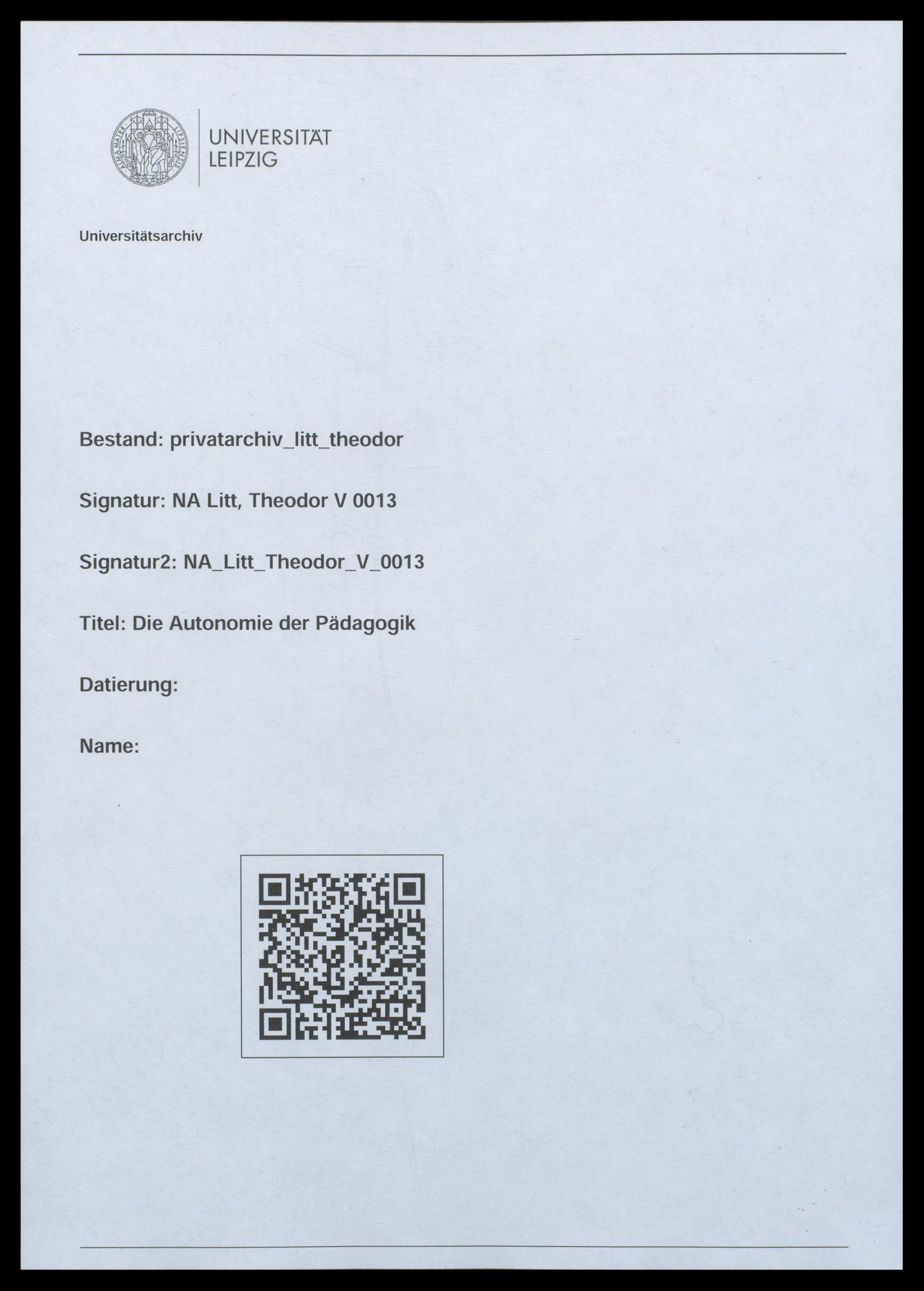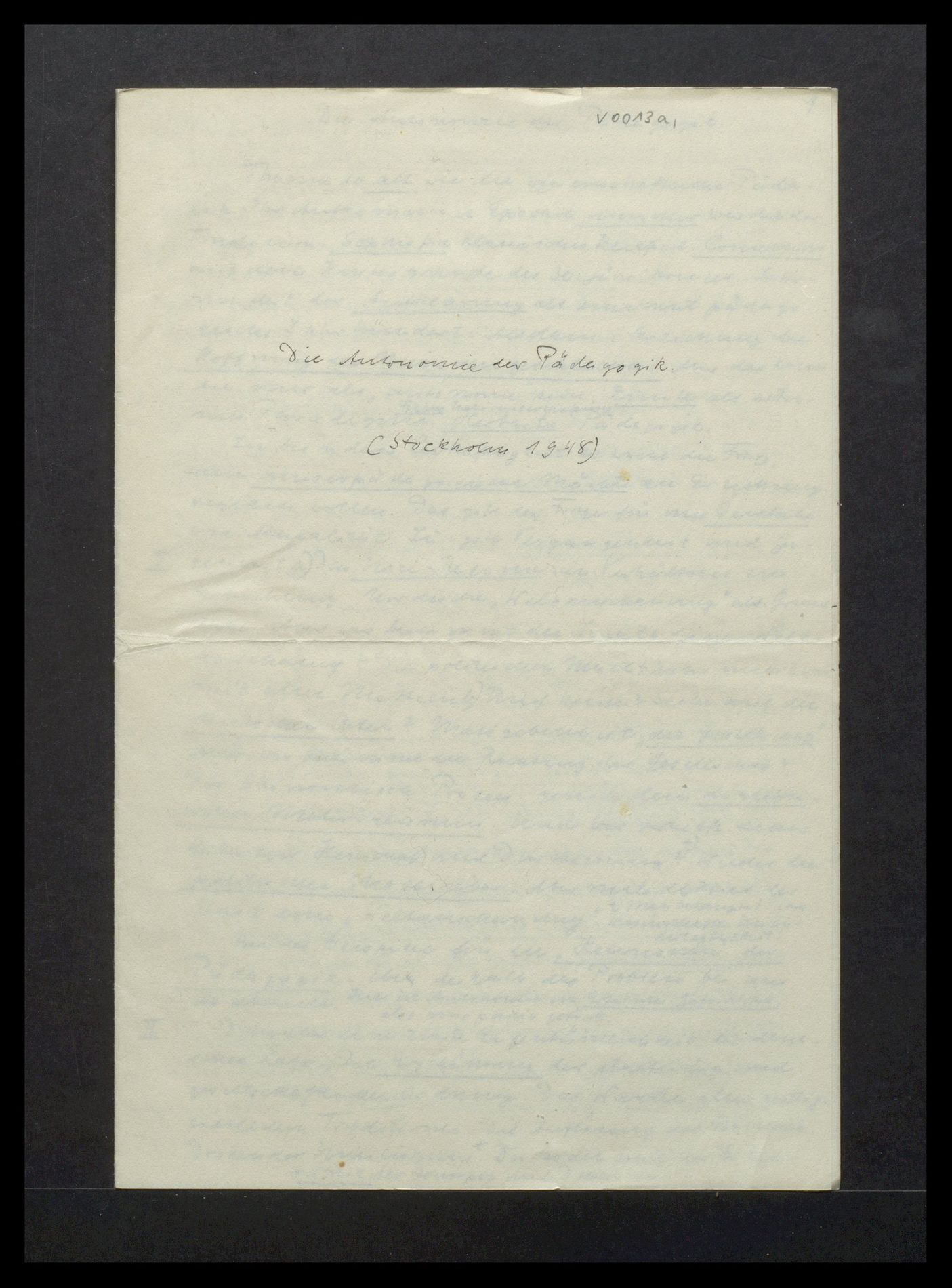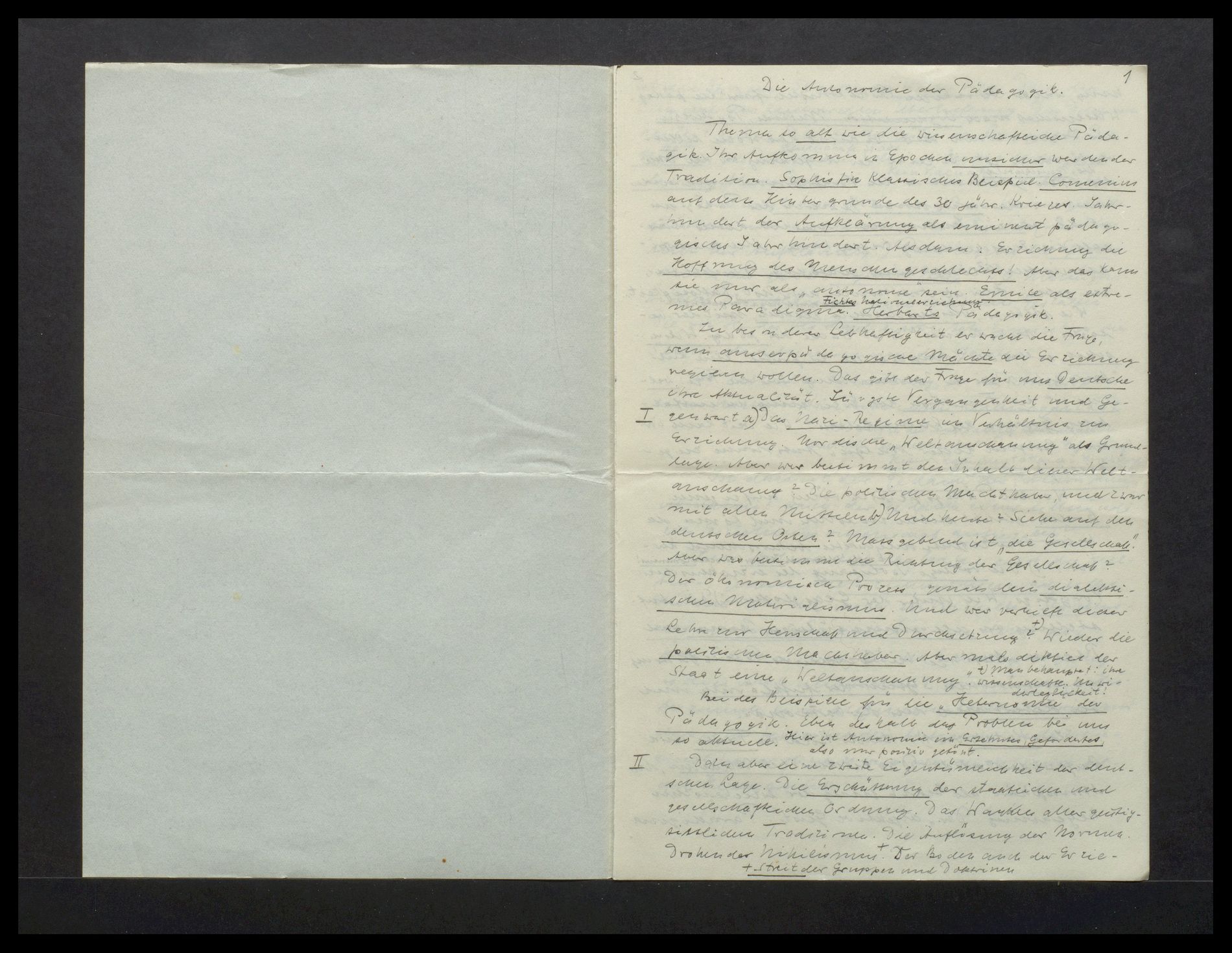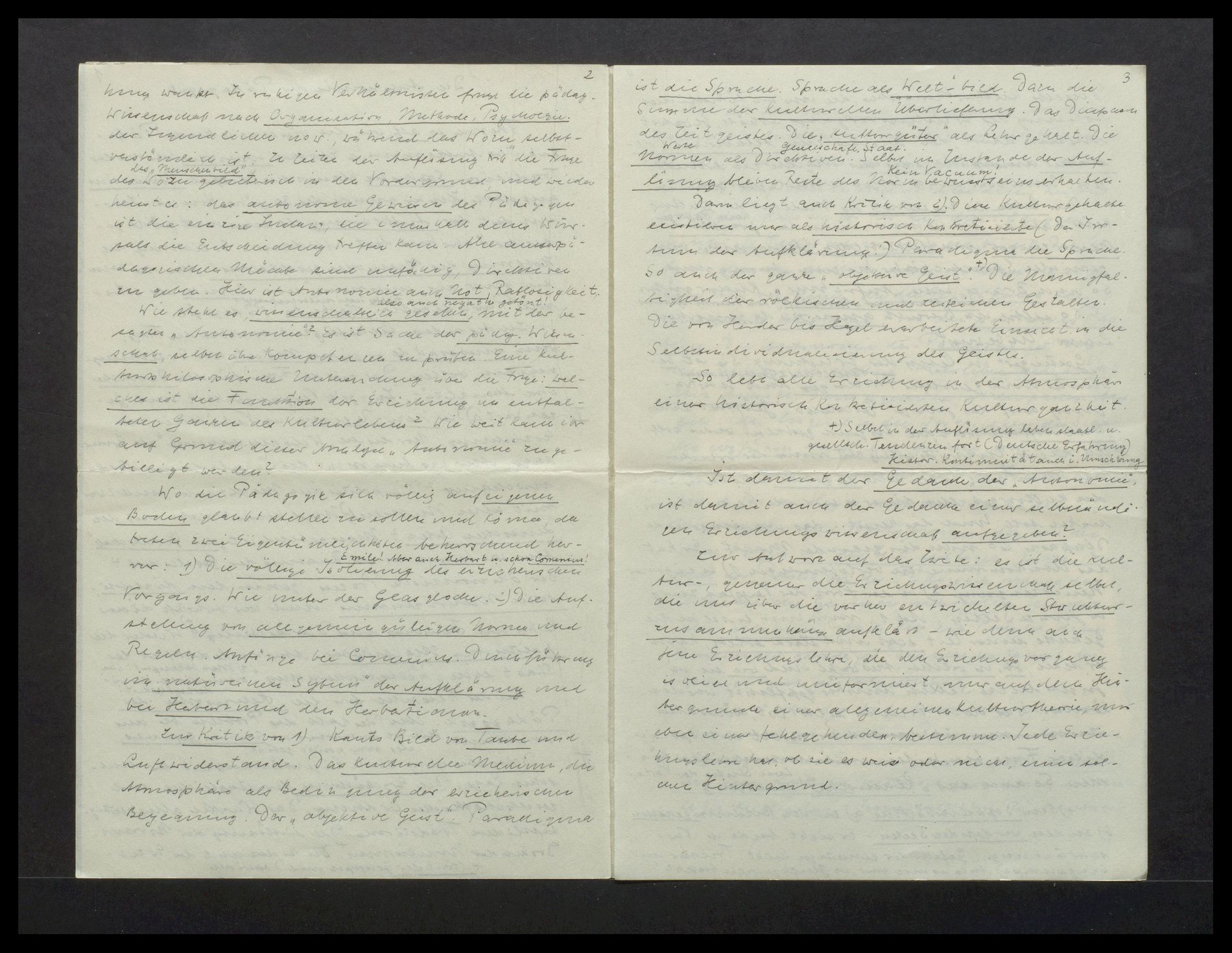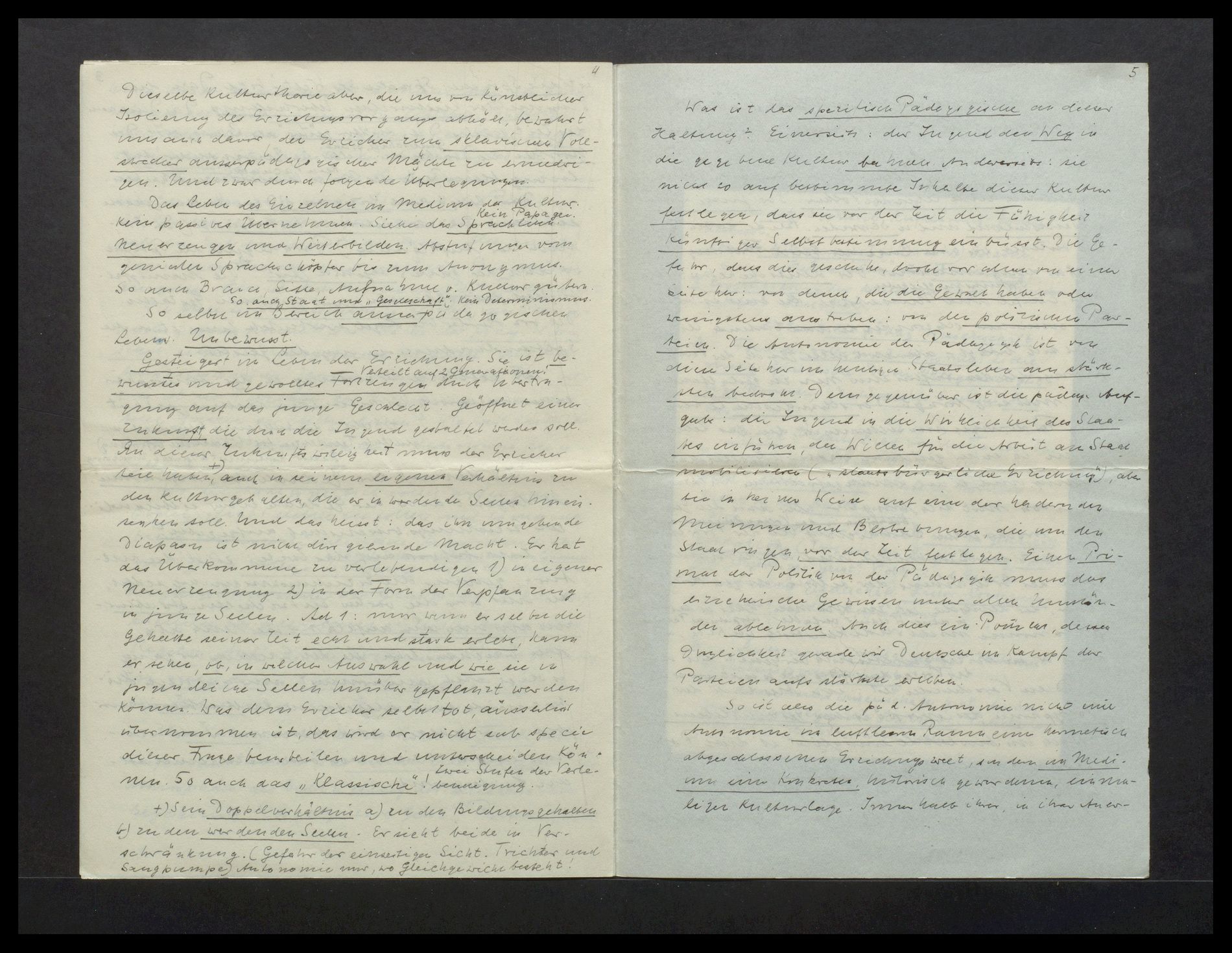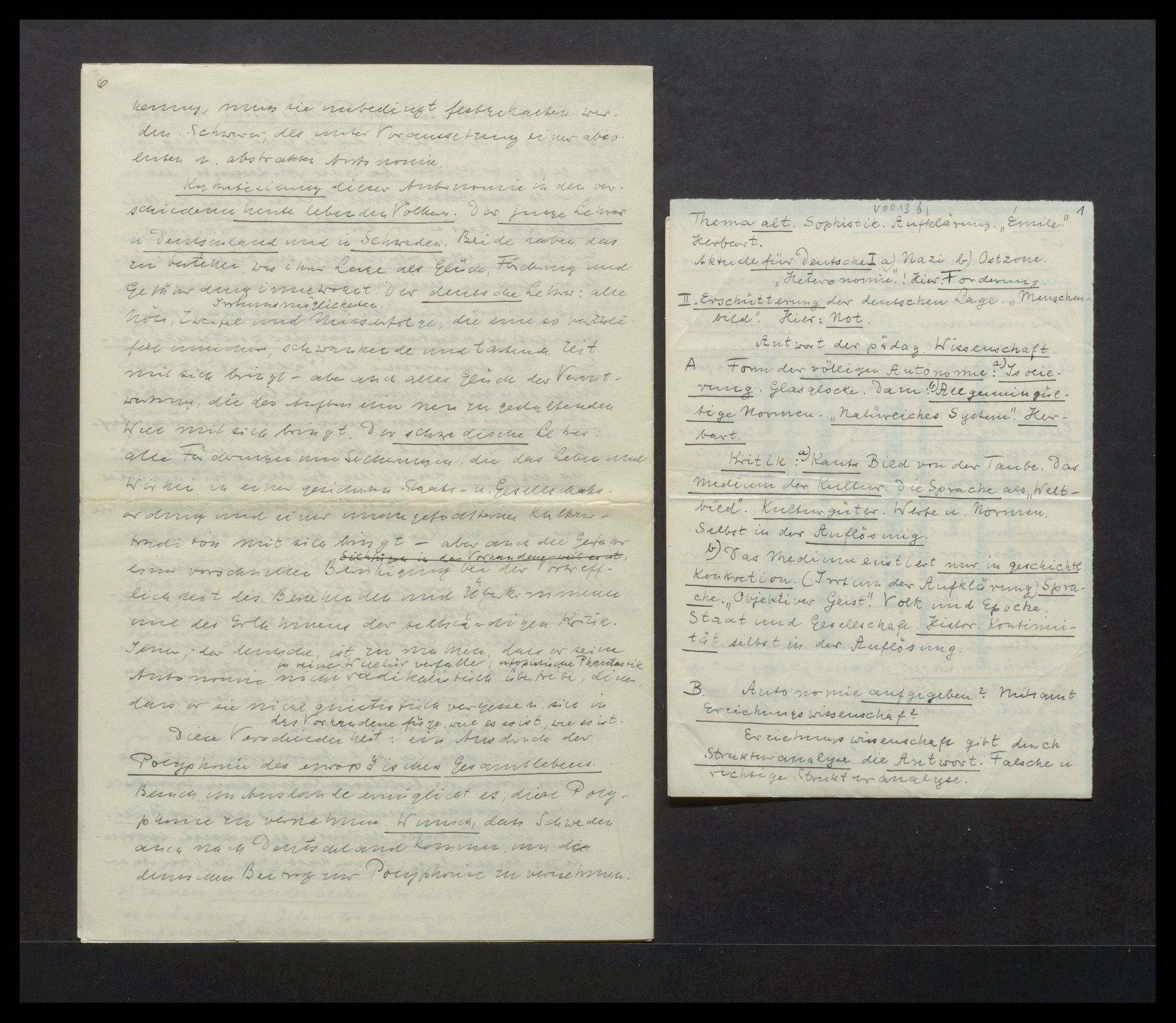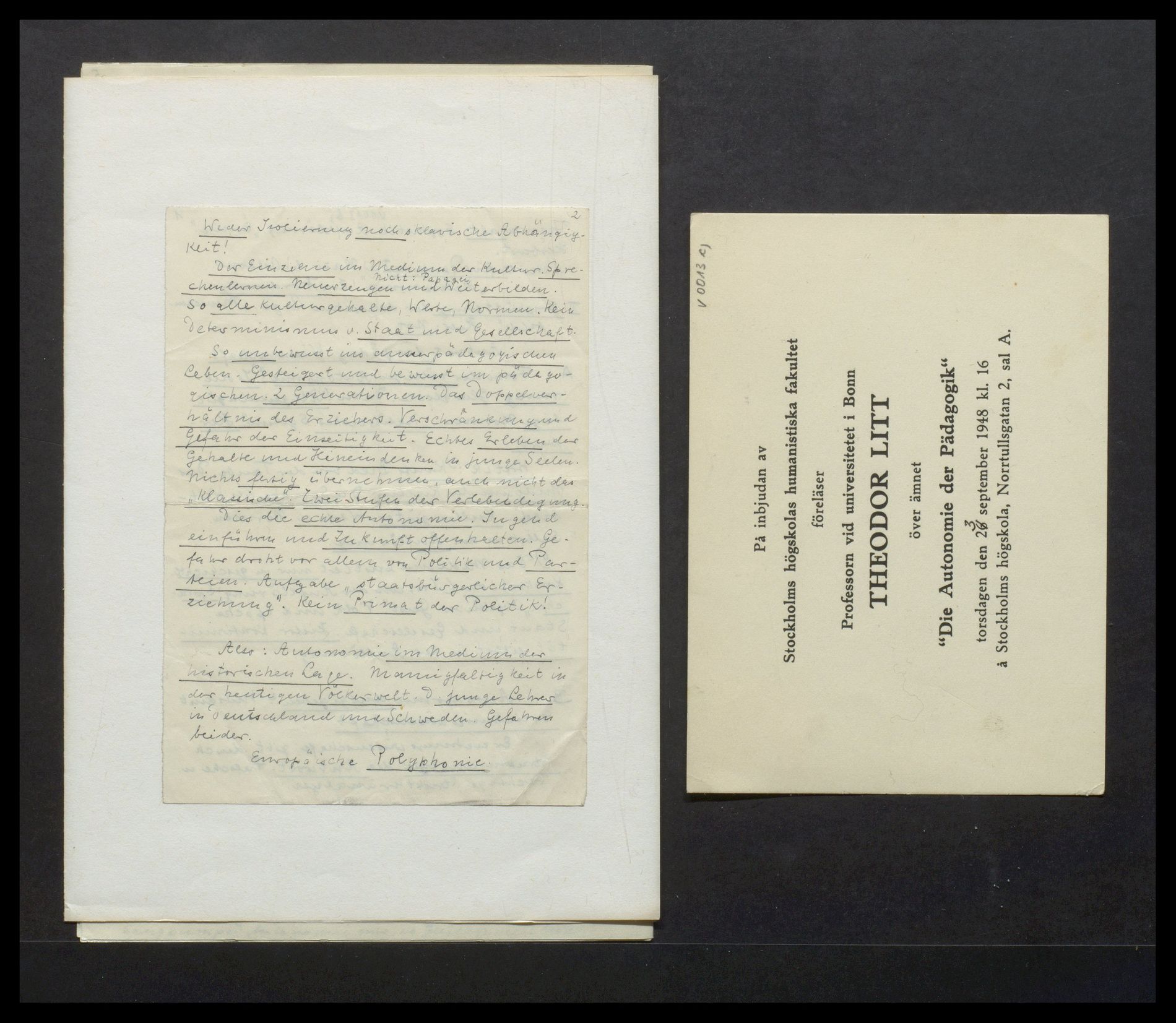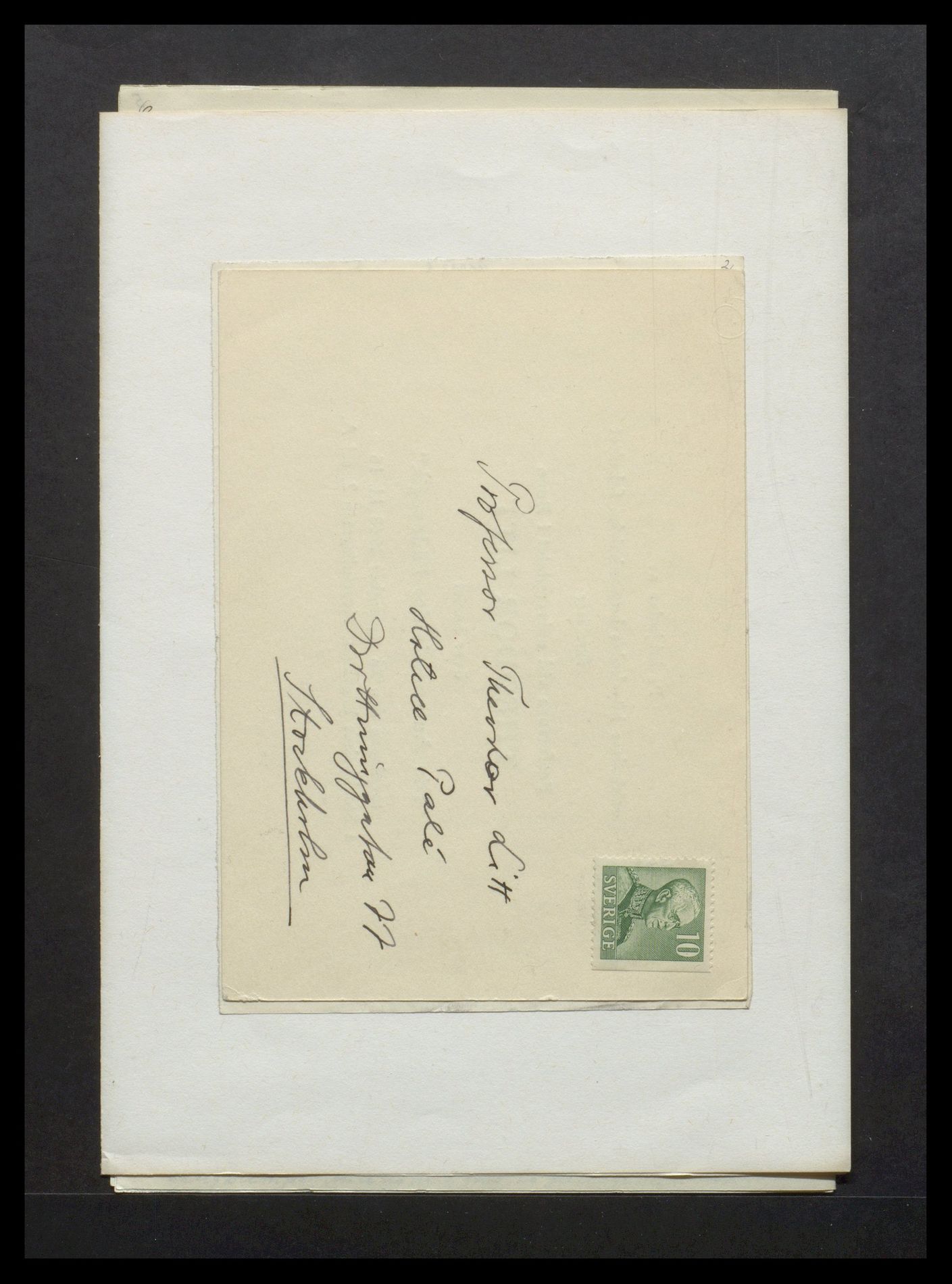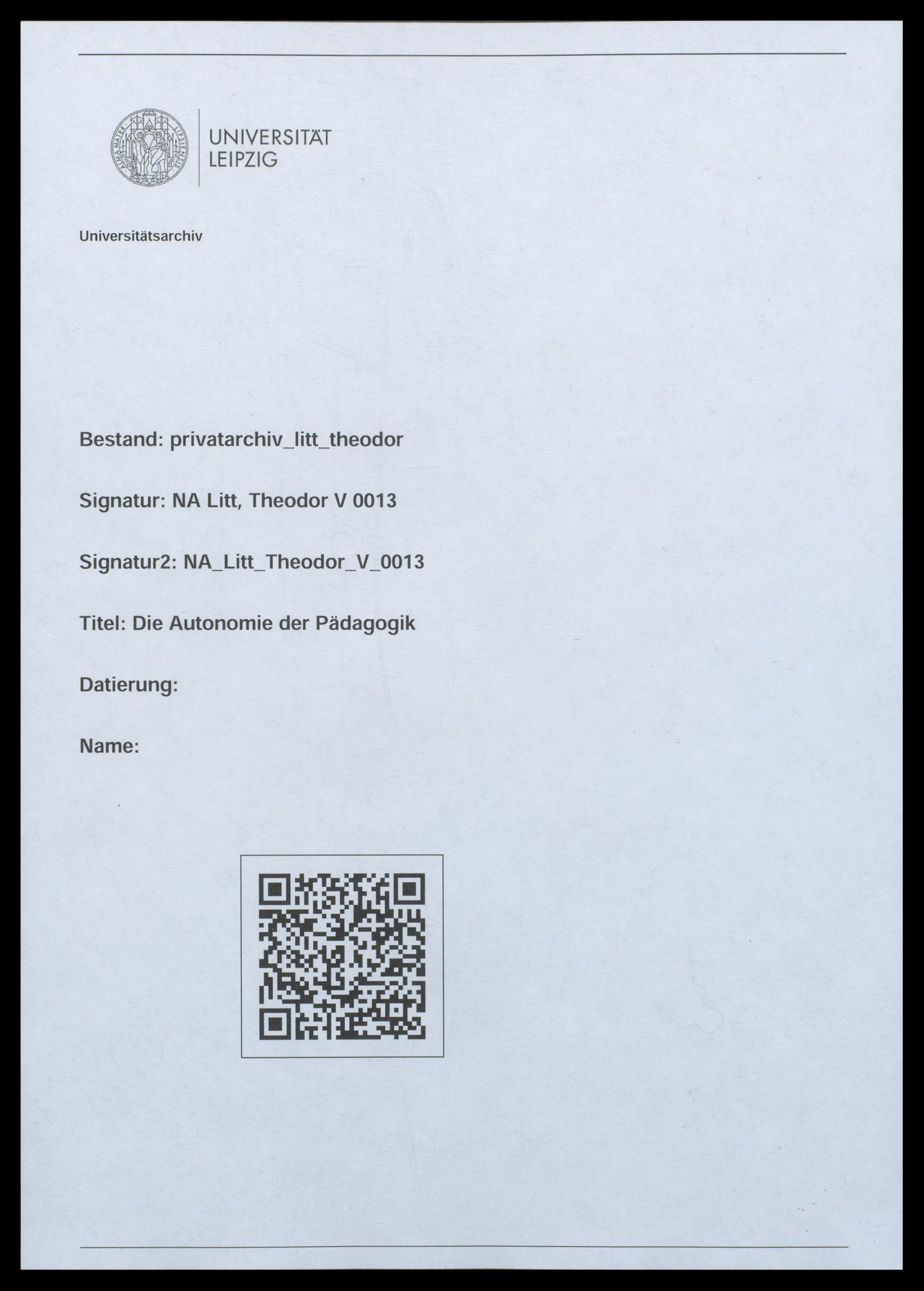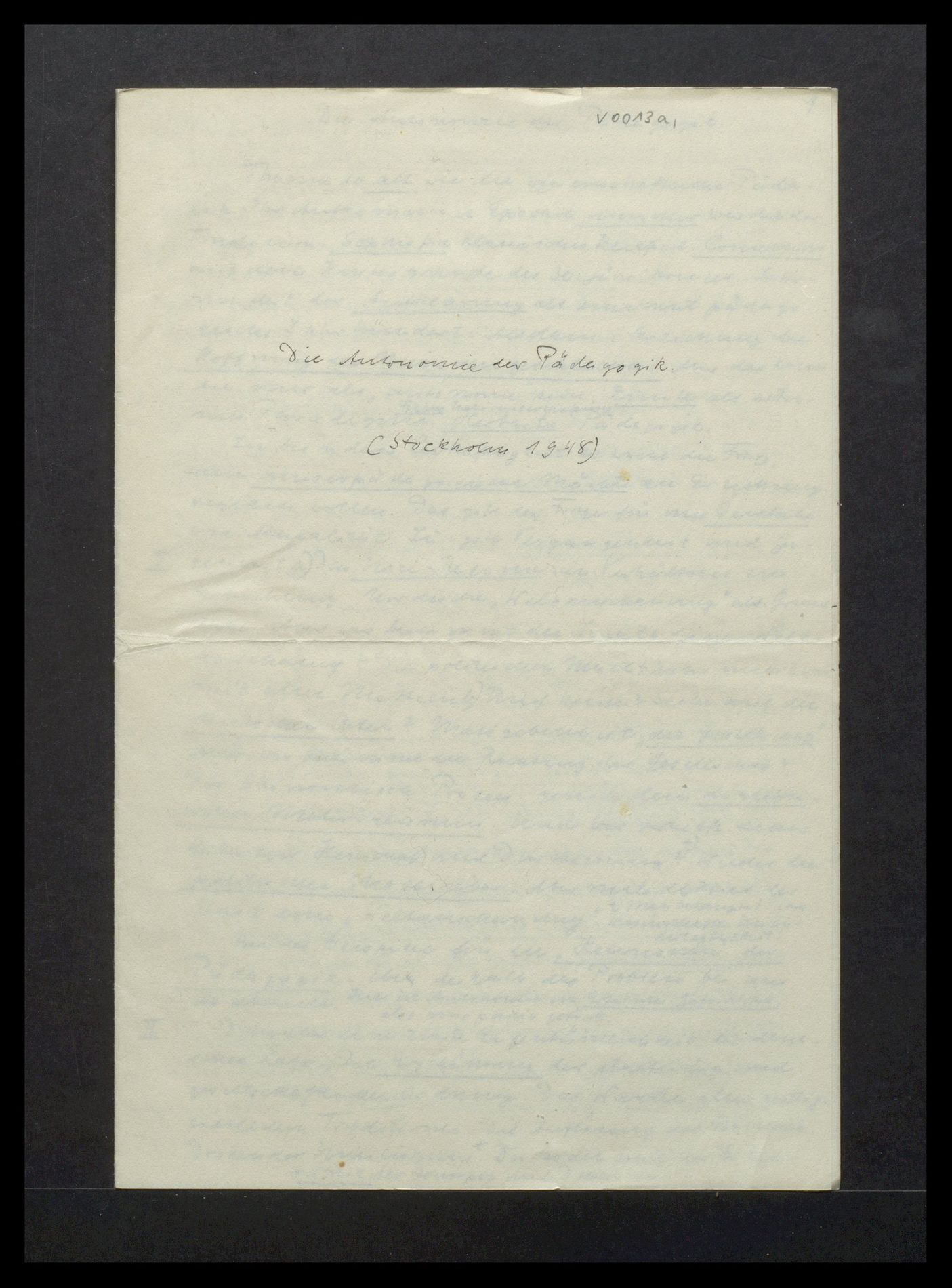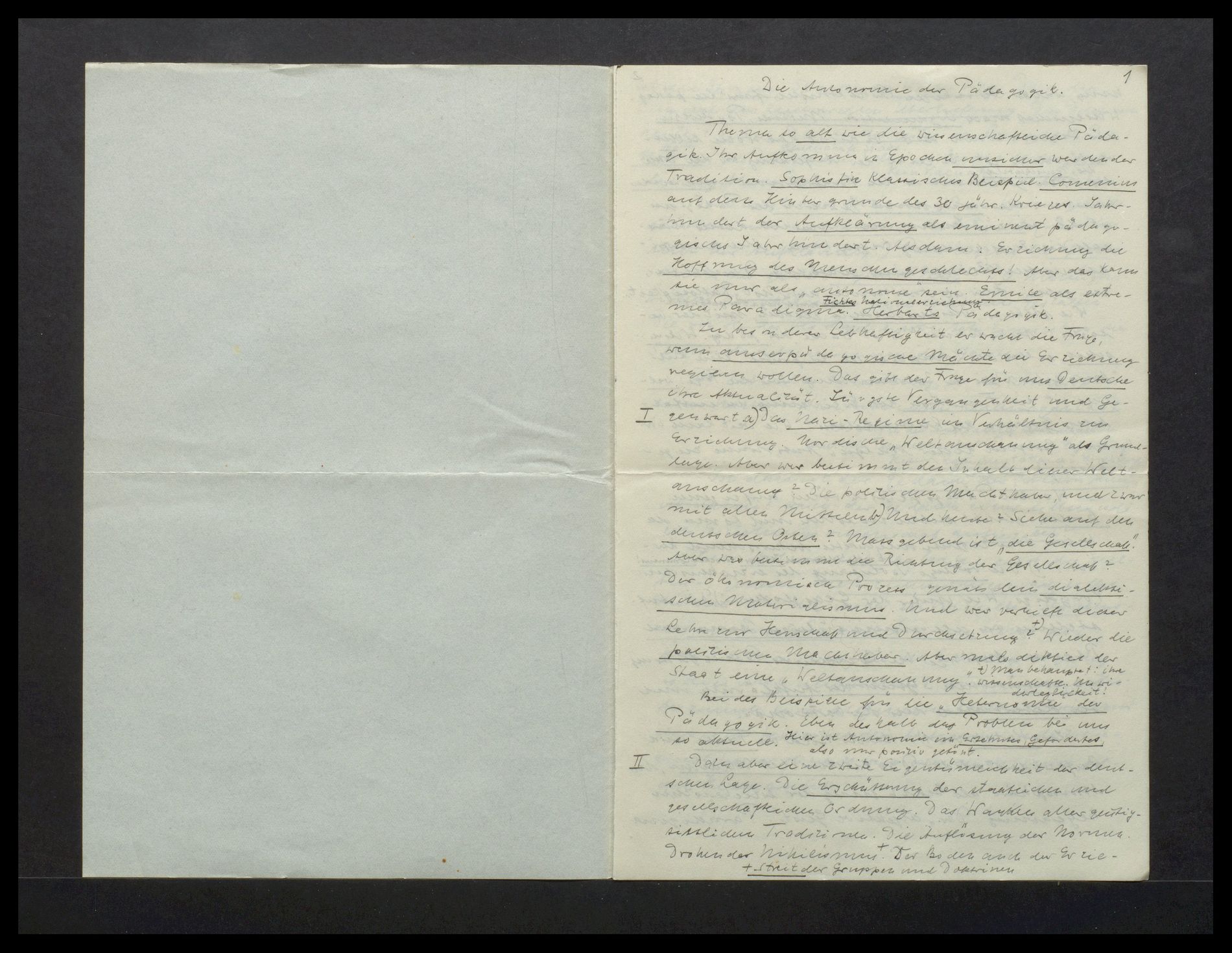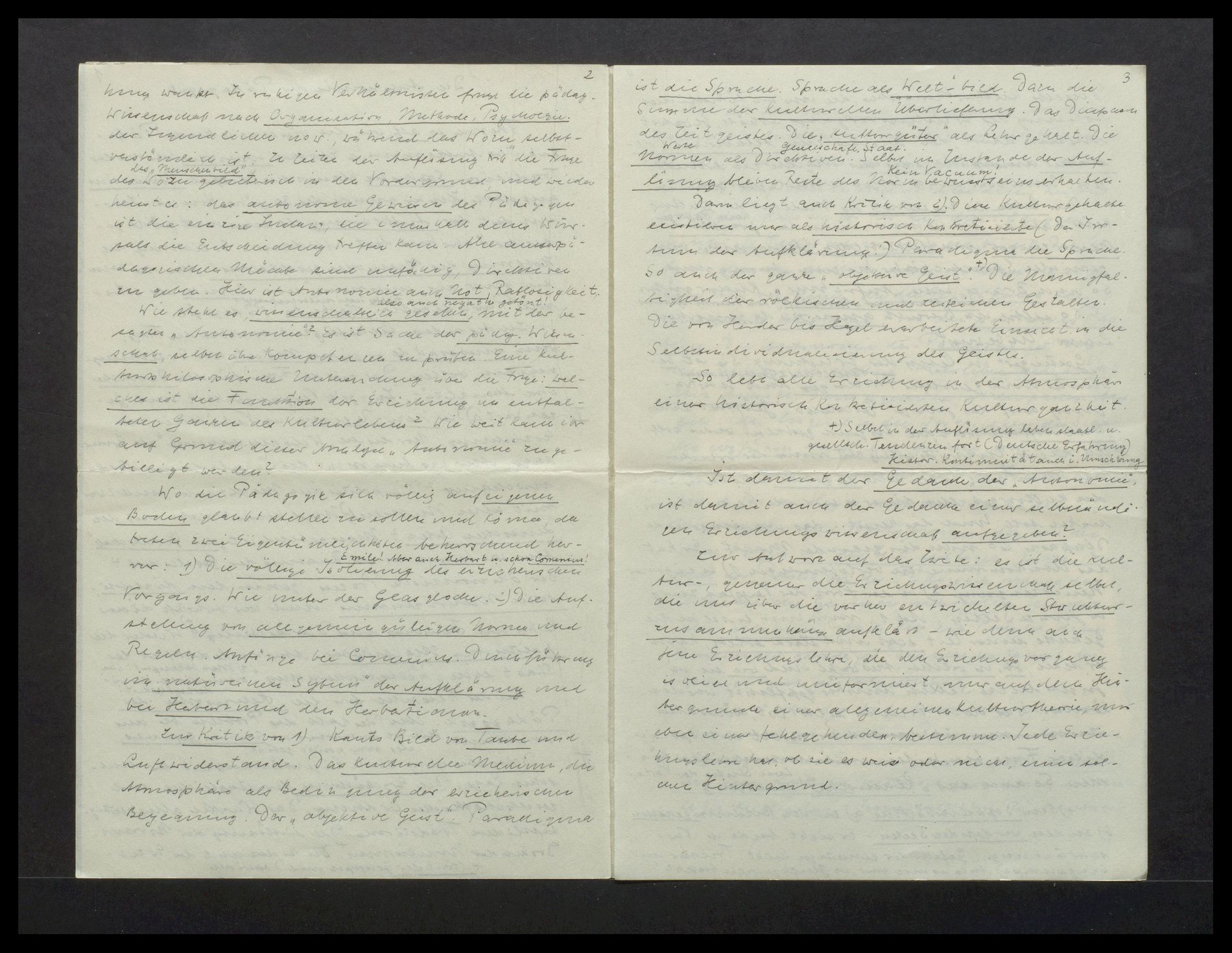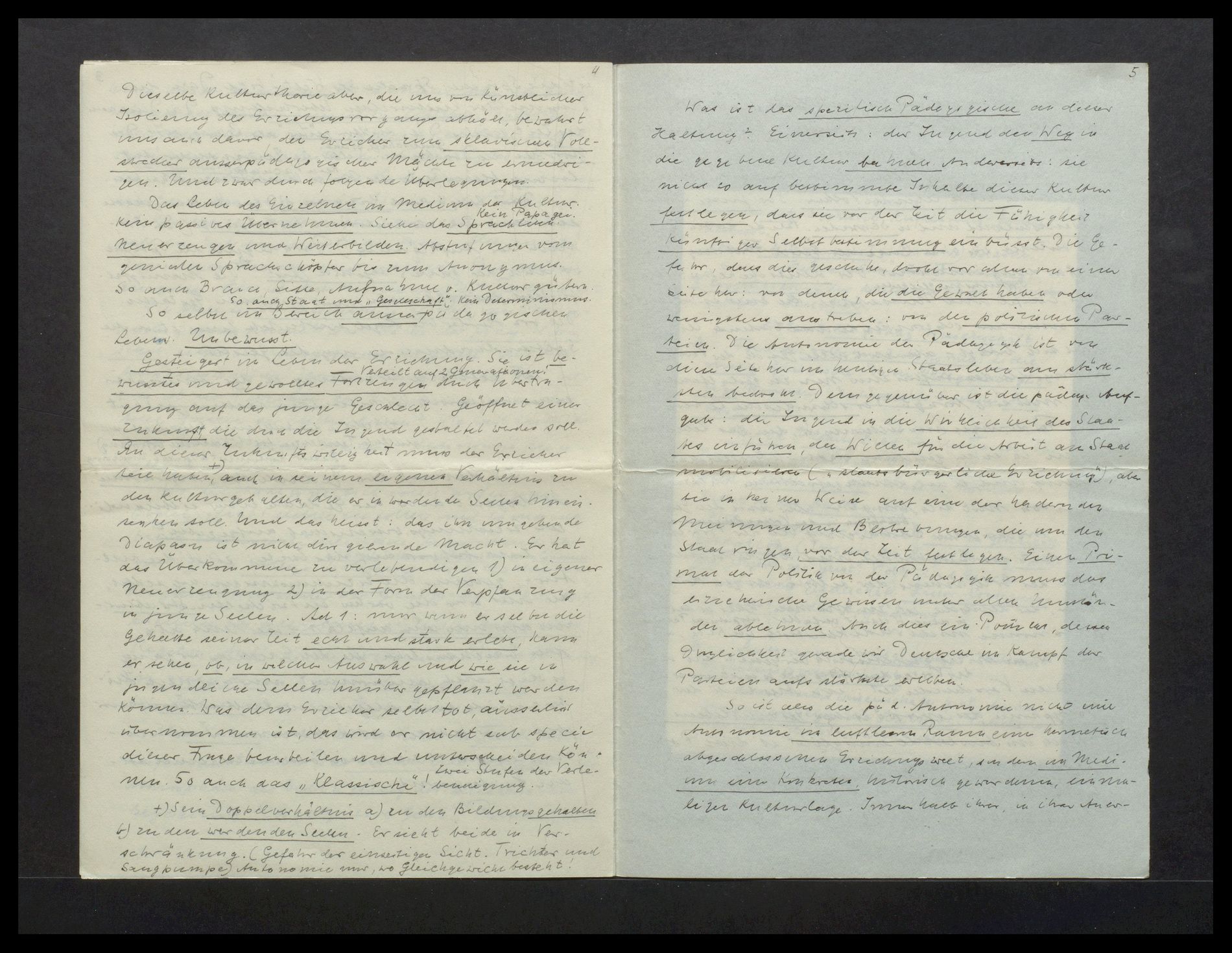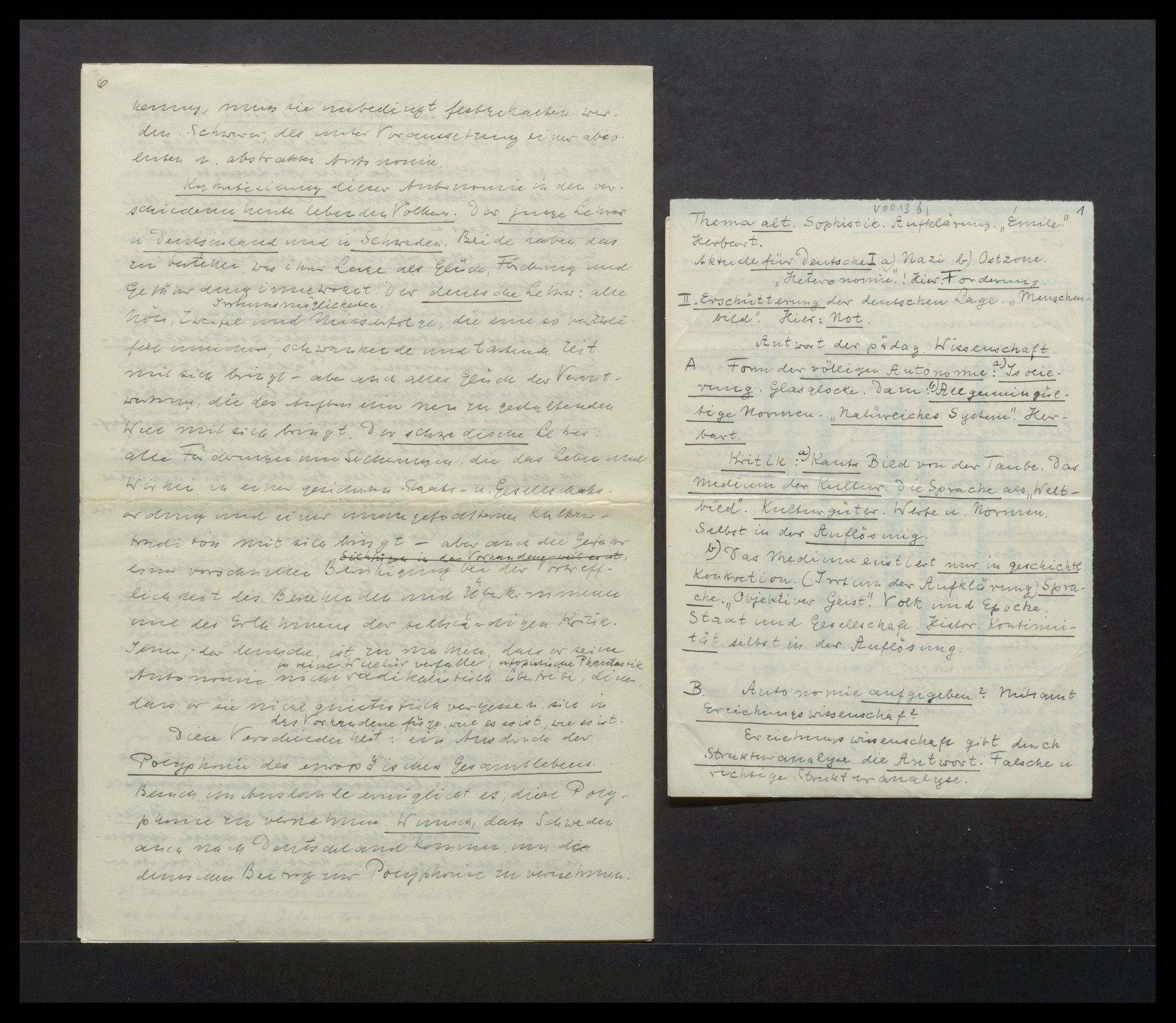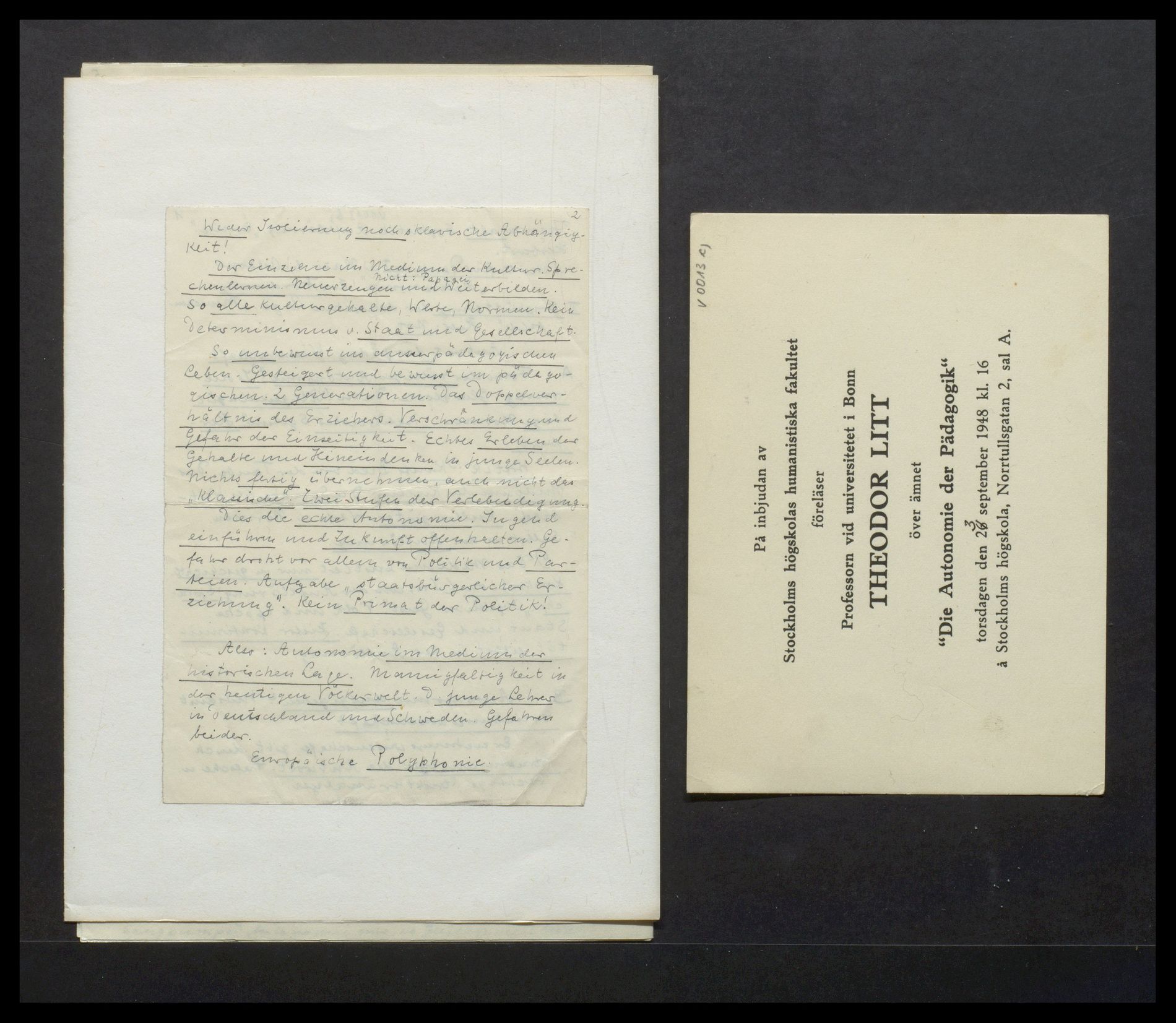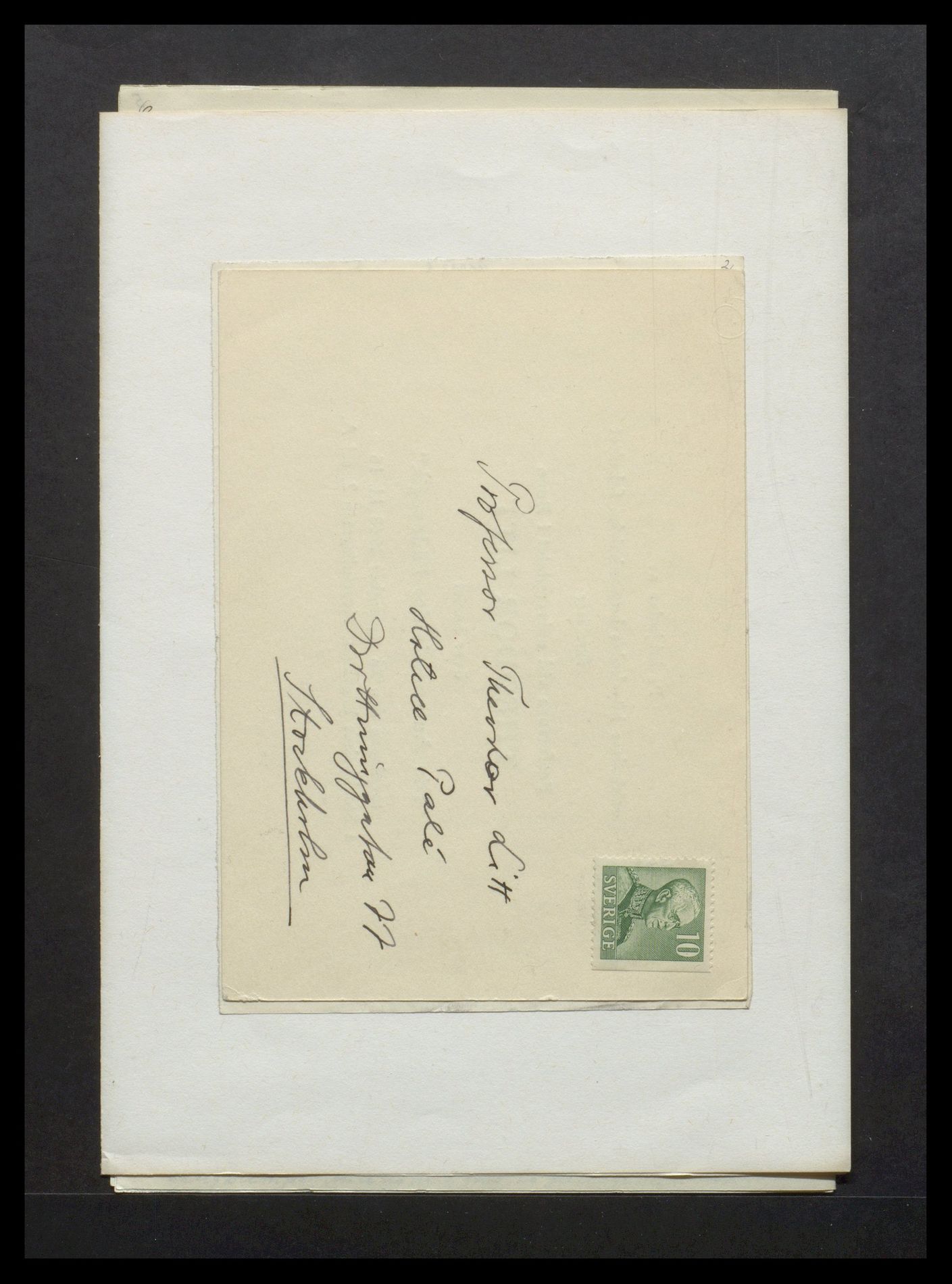| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0013 a
Stockholm 1948
Titelblatt
Die Autonomie der Pädagogik
(Stockholm 1948)
1
Die Autonomie der Pädagogik.
Thema so alt wie die wissenschaftliche Päda-
gik. Ihr Aufkommen in Epochen unsicher werden der
Tradition. Sophistik Klassisches Beispiel. Comenius
auf dem Hintergrunde des 30 jähr. Krieges. Jahr-
hundert der Aufklärung als eminent pädago-
gisches Jahrhundert. Alsdann: Erziehung die
Hoffnung des Menschengeschlechts! Aber das kann
sie nur als „autonome“ sein. Emile als extre-
Fichtes Nationalerziehung.
mes Paradigma. Herbarts Pädagogik.
Zu besonderer Lebhaftigkeit erwacht die Frage,
wenn ausserpädagogische Mächte die Erziehung
regieren wollen. Das gibt der Frage für uns Deutsche
ihre Aktualität. Jüngste Vergangenheit und Ge-
I gegenwart. a) Das Nazi-Regime im Verhältnis zur
Erziehung. Nordische „Weltanschauung“ als Grund-
lage. Aber wer bestimmt den Inhalt einer Welt-
anschauung? Die politischen Machthaber, und zwar
mit allen Mitteln. b) Und heute? Siehe auf den
deutschen Osten? Massgebend ist „die Gesellschaft“.
Aber was bestimmt die Richtung der Gesellschaft?
Der ökonomische Prozess gemäss dem dialekti-
schen Materialismus. Und wer verhilft dieser
Lehre zur Herrschaft und Durchsetzung? +) Wieder die
politischen Machthaber. Abermals diktiert der
Staat eine „Weltanschauung“. +) Man behauptet ihre
wissenschaftl. Unwi-
derlelichkeit!
Beides Beispiele für die „Heternomie“ der
Pädagogik. Eben deshalb das Problem bei uns
so aktuell. Hier ist Autonomie ein Ersehntes, Gefordertes,
also nur positiv getönt.
II Dazu aber eine zweite Eigentümlichkeit der deut-
schen Lage. Die Erschütterung der staatlichen und
gesellschaftlichen Ordnung. Das Wanken aller geistig-
sittlichen Traditionen. Die Auflösung der Normen.
Drohen des Nihilismus. + Der Boden auch der Erzie-
+ Streit der Gruppen und Doktrinen
2
hung wankt. In ruhigen Verhältnissen fragt die pädag.
Wissenschaft nach Organisation, Methode, Psychologie,
der Jugendlichen usw., während das Wozu selbst-
verständlich ist. Zu Zeiten der Auflösung tritt die Frage
das „Menschenbild“
des Wozu gebieterisch in den Vordergrund, und wieder
heisst es: das autonome Gewissen des Pädagogen
ist die einzige Instanz, die innerhalb dieses Wirr-
sals die Entscheidung treffen kann. Alle ausserpä-
dagogische Mächte sind unfähig, Direktiven
zu geben. Hier ist Autonomie auch Not, Ratlosigkeit.
also auch negativ getönt!
Wie steht es, wissenschaftlich gesehen, mit der be-
sagten „Autonomie“? Es ist Sache der pädag. Wissen-
schaft, selbst ihre Kompetenzen zu prüfen. Eine kul-
turphilosophische Untersuchung über die Frage: wel-
ches ist die Funktion der Erziehung im entfal-
teten Ganzen des Kulturlebens? Wie weit kann ihr
auf Grund dieser Analyse „Autonomie“ zuge-
billigt werden?
Wo die Pädagogik sich völlig auf eigenen
Boden glaubt stellen zu sollen und können, da
treten zwei Eigentümlichkeiten beherrschend her-
Emile! Aber auch Herbart u. schon Comenius!
vor: 1) Die völlige Isolierung des erzieherischen
Vorgangs. Wie unter der Glasglocke. 2) Die Auf-
stellung von allgemeingültigen Normen und
Regeln. Anfänge bei Comenius. Durchführung
im „natürlichen System“ der Aufklärung und
bei Herbat und den Herbartianern.
ZurKritik von 1) Kants Bild von Taube und
Luftwiderstand. Das kulturelle Medium, die
Atmosphäre als Bedingung der erzieherischen
Begegnung. Der „objektive Geist“. Paradigma
3
ist die Sprache. Sprache als „Welt“-bild. Dazu die
Sume der kulturellen Überlieferung. Das Diapason
des Zeitgeistes. Die „Kulturgüter“ als Lehrgehalt. Die
Werte Gesellschaft, Staat.
Normen als Direktiven. Selbst im Zustande der Auf-
Kein Vacuum!
lösung bleiben Reste des Normbewusstseins erhalten.
Darin liegt auch Kritik von 2). Diese Kulturgehalte
existieren nur als historisch Konkretisierte (Der Irr-
tum der Aufklärung!) Paradigma die Sprache.
So auch der ganze „objektiveGeist“. +) Die Mannigfal-
tigkeit der völkischen und zeitlichen Gestalten.
Die von Herder bis Hegel erarbeitete Einsicht in die
Selbstindividualisierung des Geistes.
So lebt alle Erziehung in der Atmosphäre
einer historisch konkretisierten Kulturganzheit.
+) Selbst in der Auflösung leben staatl. u.
gesellsch. Tendenzen fort (Deutsche Erfahrung)
Histor. Kontinuität auch i. Umschwung
Ist damit der Gedanke der „Autonomie“,
ist damit auch der Gedanke einer selbständi-
gen Erziehungswissenschaft aufgegeben?
Zur Antwort auf das Zweite: es ist die kul-
tur-, genauer die Erziehungswissenschaft selbst,
die uns über die vorher entwickelten Struktur-
zusammenhänge aufklärt – wie denn auch
jene Erziehungslehre, die den Erzeihungsvorgang
isoliert und uniformiert, nur auf dem Hin-
tergrunde einer allgemeinen Kulturtheorie, nur
eben einer fehlgehenden, bestimmt. Jede Erzie-
hungslehre hat, ob sie es weis oder nicht, einen sol-
chen Hintergrund.
4
Dieselbe Kulturtheorie aber, die uns von künstlicher
Isolierung des Erziehungsvorgangs abhält, bewahrt
uns auch davor, den Erzeiher zum sklavischen Voll-
strecker ausserpädagogischer
Mächte zu erniedri-
gen. Und zwar durch folgende Überlegungen.
Das Leben des Einzelnen im Medium der Kultur.
Kein Papagei.
Kein passives Übernehmen. Siehe das Sprachleben.
Neuerzeugen und Weiterbilden. Abstufungen vom
genialen Sprachschöpfer bis zum Anonymus.
So auch Brauch, Sitte Aufnahme v. Külturgütern.
So auch Staat und „Gesellschaft“. Kein Determinismus.
So selbst im Bereich ausserpädagogischen
Lebens. Unbewusste.
Gesteigert in Leben der Erziehung. Sie ist be-
Verteilt auf 2 Generationen!
wusstes und gewolltes Fortzeugen durch Übertra-
gung auf das junge Geschlecht. Geöffnet einer
Zukunft, die durch die Jugend gestaltet werden soll,
An dieser Zukunftswilligkeit muss der Erzieher
teil haben, +) auch in seinem eigenen Verhältnis zu
den Kulturgehalten, die er werdende Seelen hinein-
senken soll. Und das heisst: das ihn umgehende
Diapason ist nicht diregierende Macht. Er hat
das Überkommene zu verlebendigen 1) in eigener
Neuerzeugung 2) in der Form der Verpflanzung
in junge Seelen. Ad 1: nur wenn er selbst die
Gehalte seiner Zeit echt und stark erlebt, kann
er sehen, ob, in welcher Auswahl und wie sie in
jugendlichen Seelen hinübergepflanzt werden
können. Was dem Erzieher selbst tot, äusserlich
übernommen ist, das wird er nicht sub specie
dieser Frage beurteilen und unterscheiden kön-
nen. So auch das „Klassische“! Zwei Stufen der Verle-
bendigung.
+) Sein Doppelverhältnis a) zu den Bildungsgehalten
b) zu den werdenden Seelen. Er sieht beide in Ver-
schränkung. (Gefahr der einseitigen Sicht. Trichter und
Saugpumpe) Autonomie nur, wo Gleichgewicht besteht!
5
Was ist das spezifisch Pädagogische an dieser
Haltung? Einerseits: der Jugend den Weg in
die gegebene Kultur bahnen Andererseits: sie
nicht so auf bestimmte Inhalte dieser Kultur
festlegen, dass sie vor der Zeit die Fähigkeit
künftiger Selbstbestimmung einbüsst. Die Ge-
fahr, dass dies geschehe, droht vor allem von einer
Seite her: von denen, die die Gewalt haben oder
wenigstens anstreben: von den politischen Par-
teien. Die Autonomie der Pädagogik ist von
dieser Seite her im heutigen Staatsleben am stärk-
sten bedroht. Dem gegenüber ist die pädag. Auf-
gabe: die Jugend in die Wirklichkeit des Staa-
tes einführen, den Willen für die Arbeit am Staat
mobilisieren („staatsbürgerliche Erziehung“), aber
sie in keiner Weise auf eine der hadernden
Meinungen und Bestrebungen, die um den
Staat ringen, vor der Zeit festlegen. Einen Pri-
mat der Politik von der Pädagogik muss das
erzieherische Gewissen unter allen Umstän-
den ablehnen. Auch dies ein , dessen
Dringlichkeit gerade wir Deutsche im Kampf der
Parteien aufs stärkste erleben.
So ist also die päd. Autonomie nicht eine
Autonomie im luftleeren Raum eine hermetisch
abgeschlossene Erziehungswelt, sondern im Medi-
um einer konkreten, historisch gewordenen, einma-
ligen Kulturlage. Innerhalb ihrer, in ihrer Aner-
6
kennung, muss sie unbedingt festgehalten wer-
den. Schwerer, als unter Voraussetzung einer abso-
luten u. abstrakten Autonomie.
Konkretisierung dieser Autonomie in den ver-
schiedenen heute lebenden Völkern. Der junge Lehrer
in Deutschland und in Schweden. Beide haben das
zu bestehen, was ihrer Lage als Glück, Förderung und
Gefährdung innewohnt. Der deutsche Lehrer: alle
Irrtumsmöglichkeiten
Nöte, Zweifel und Misserfolge, die eine so von Zwei-
fel unsicher, schwankende und tastende Zeit
mit sich bringt – aber auch alles Glück der Verant-
wortung, die der Aufbau einer neu zu gestaltenden
Welt mit sich bringt. Der schwedische Lehrer:
alle Förderungen und Sicherungen, die das Leben <...>
Wirken in einer gesicherten Staats- u. Gesellschafts-
ordnung und einer unangefochtenen Kultur-
tradition mit sich bringt – aber auch die Gefahr
sich fügen in das Vorhandene, weil es ist;
einer vorschnellen Beruhigung bei der Vortreff-
lichkeit des Beruhenden und Überkommenen
und des Erlahmens der selbständigen Kritik.
Jener; der deutsche, ist zu mahnen, dass er seine
in reine Willkür verfalle; utopische Phantastik
Autonomie nicht radikalistisch übertrete, dieser
dass er sie nicht <.....tistisch> vergessen u. sich in
das Vorhandene füge, weil es so ist, wie es ist.
Diese Verschiedenheit: ein Ausdruck der
Polyphonie des europäischen Gesamtlebens.
Besuch im Auslande ermöglicht es, die Poly-
phonie zu vernehmen. Wunsch, dass Schweden
auch nach Deutschland kommen, um den
deutschen Beitrag zur Polyphonie zu vernehmen.
V 0013 b
Stockholm 1948
1
Thema alt. Sophistik. Aufklärung. Emile.“
Herbart.
Aktuell für Deutsche I a) Nazi b) Ostzone.
„Heteronomie“.! Hier: Forderung.
II. Erschütterung der deutschen Lage. „Menschen-
bild“. Hier: Not.
Antwort der pädag. Wissenschaft.
A Form der völligen Autonomie: a) Isolie-
rung. Glasglocke. Dazu: b) Allgemeingül-
tige Normen. „Natürliches System“. Her-
bart.
Kritik: a) Kants Bild von der Taube. Das
Medium der Kultur. Die Sprache als „Welt-
bild“. Kulturgüter. Werte u. Normen.
Selbst in der Auflösung.
b) Das Medium existiert nur in geschichtl.
Konkretion. (Irrtum der Aufklärung) Spra-
che. „Objektiver Geist“. Volk und Epoche.
Staat und Gesellschaft. Histor. Kontinui-
tät selbst in der Auflösung.
B. Autonomie aufgegeben? Mitsamt
Erzeihungswissenschaft?
Erziehungswissenschaft gibt durch
Strukturanalyse die Antwort. Falsche u.
richtige Strukturanalyse.
2
Weder Isolierung noch sklavische Abhängig-
keit!
Der Einzelne im Medium der Kultur. Spre-
Nicht: Papagei
chenlernen. Neuerzeugen und Weiterbilden.
So alle Kulturgehalte, Werte, Normen. Kein
Determinismus v. Staat und Gesellschaft.
O unbewusst im ausserpädagogischen
Leben. Gesteigert und bewusst im pädago-
gischen. 2 Generationen. Das Doppelver-
hältnis des Erziehers. Verschränkung und
Gefahr der Einseitigkeit. Echtes Erleben der
Gehalte und Hineindenken in junge Seelen.
Nichts fertig übernehmen, auch nicht das
„Klassische“. Zwei Stufen der Verlebendigung.
Dies die echte Autonomie. Jugend
einführen und Zukunft offenhalten. Ge-
fahr droht vor allem von Poltik und Par-
teien. Aufgabe „staatsbürgerlicher Er-
ziehung“. Kein Primat der Politik!
Also: Autonomie im Medium der
historischen Lage. Mannigfaltigkeit in
der heutigen Völkerwelt. D. junge Lehrer
in Deutschland und Schweden. Gefahren
beider.
Europäische Polyphonie. |