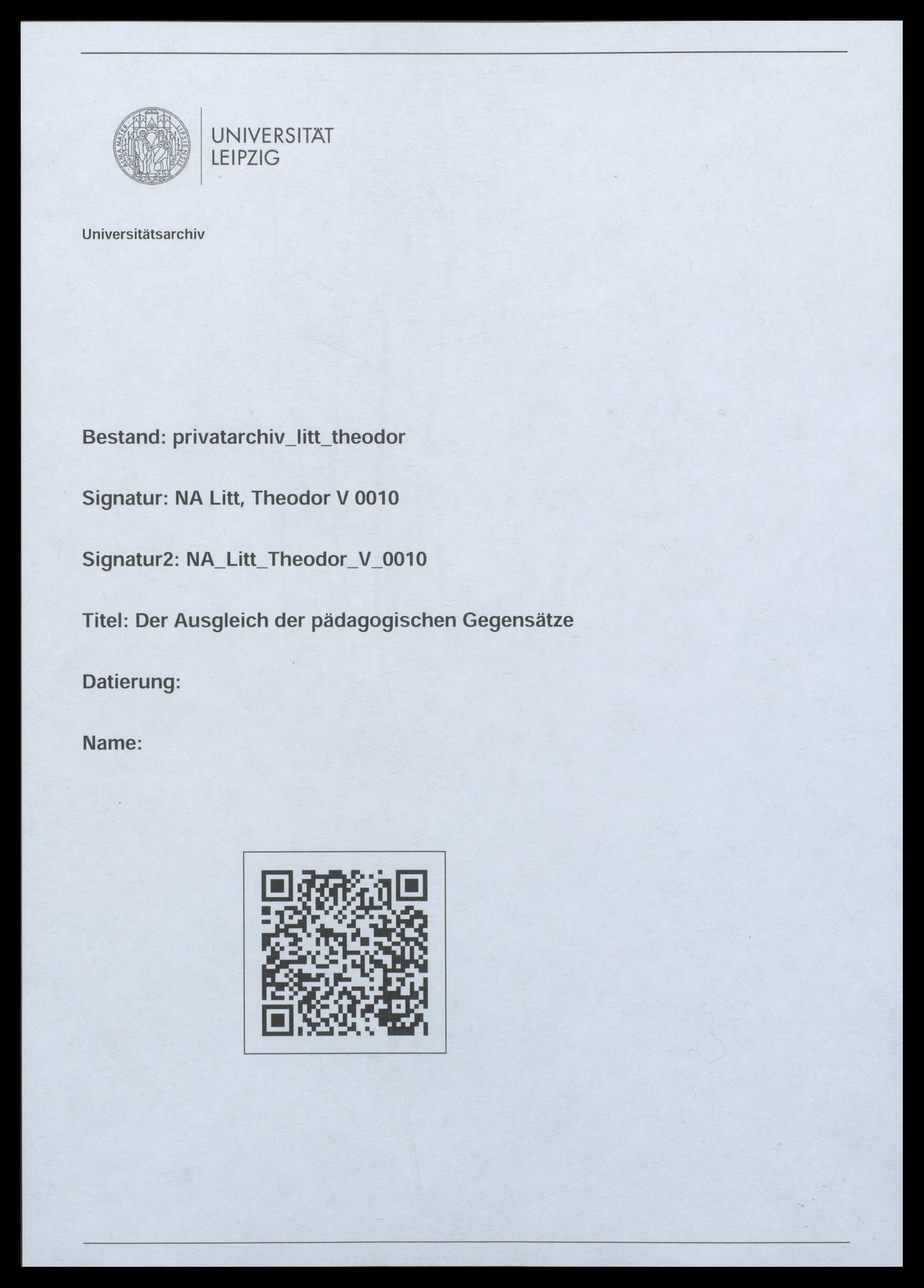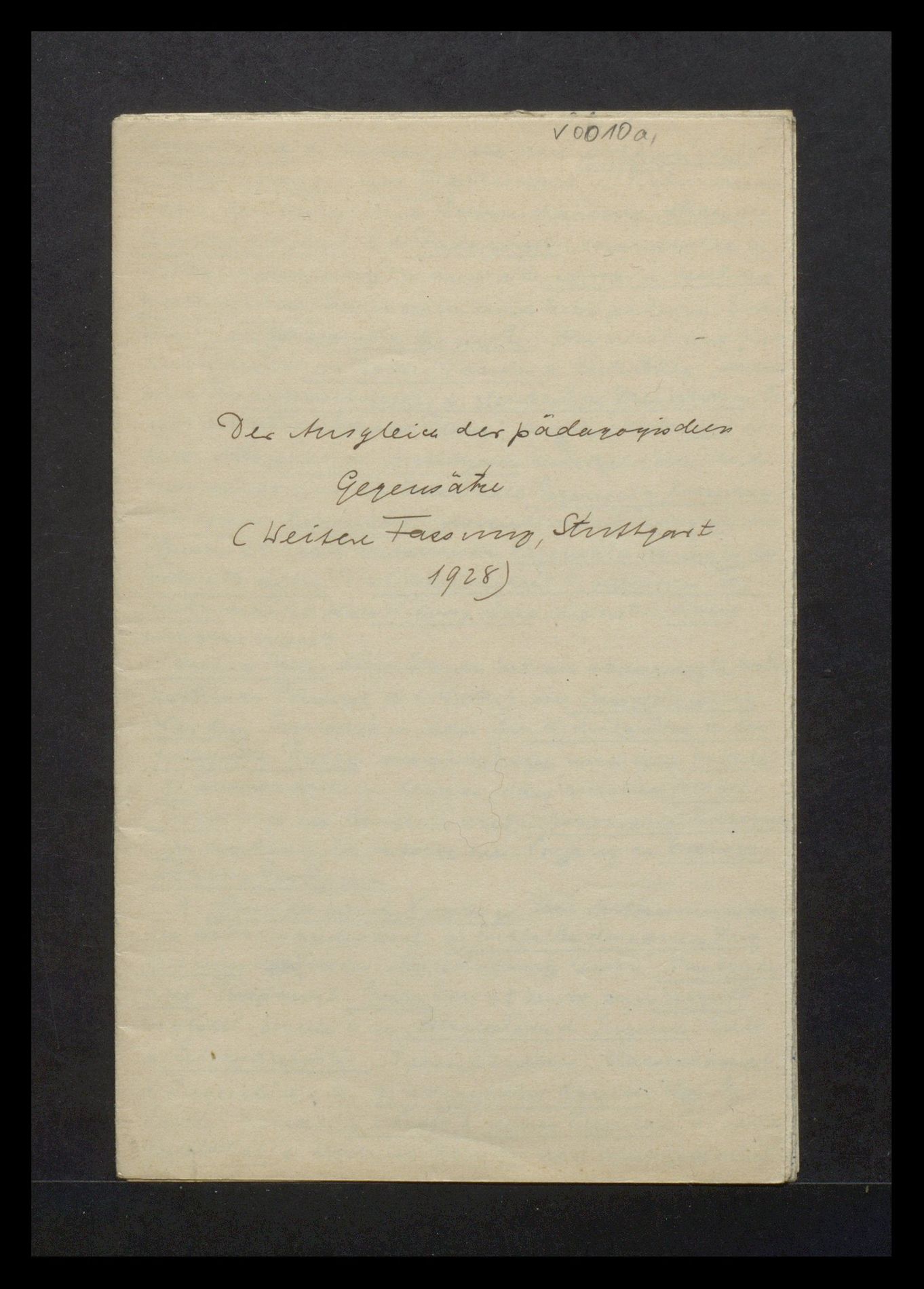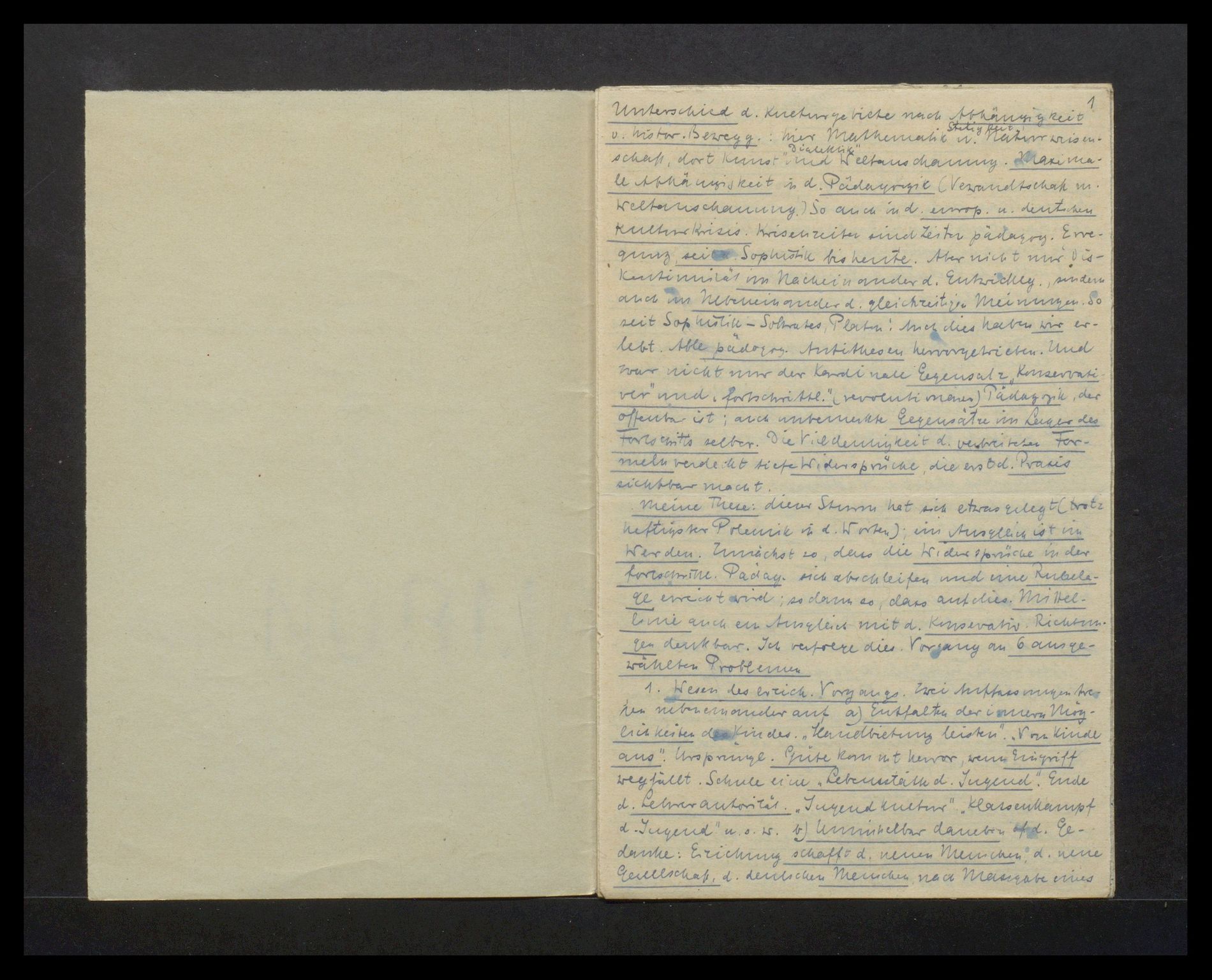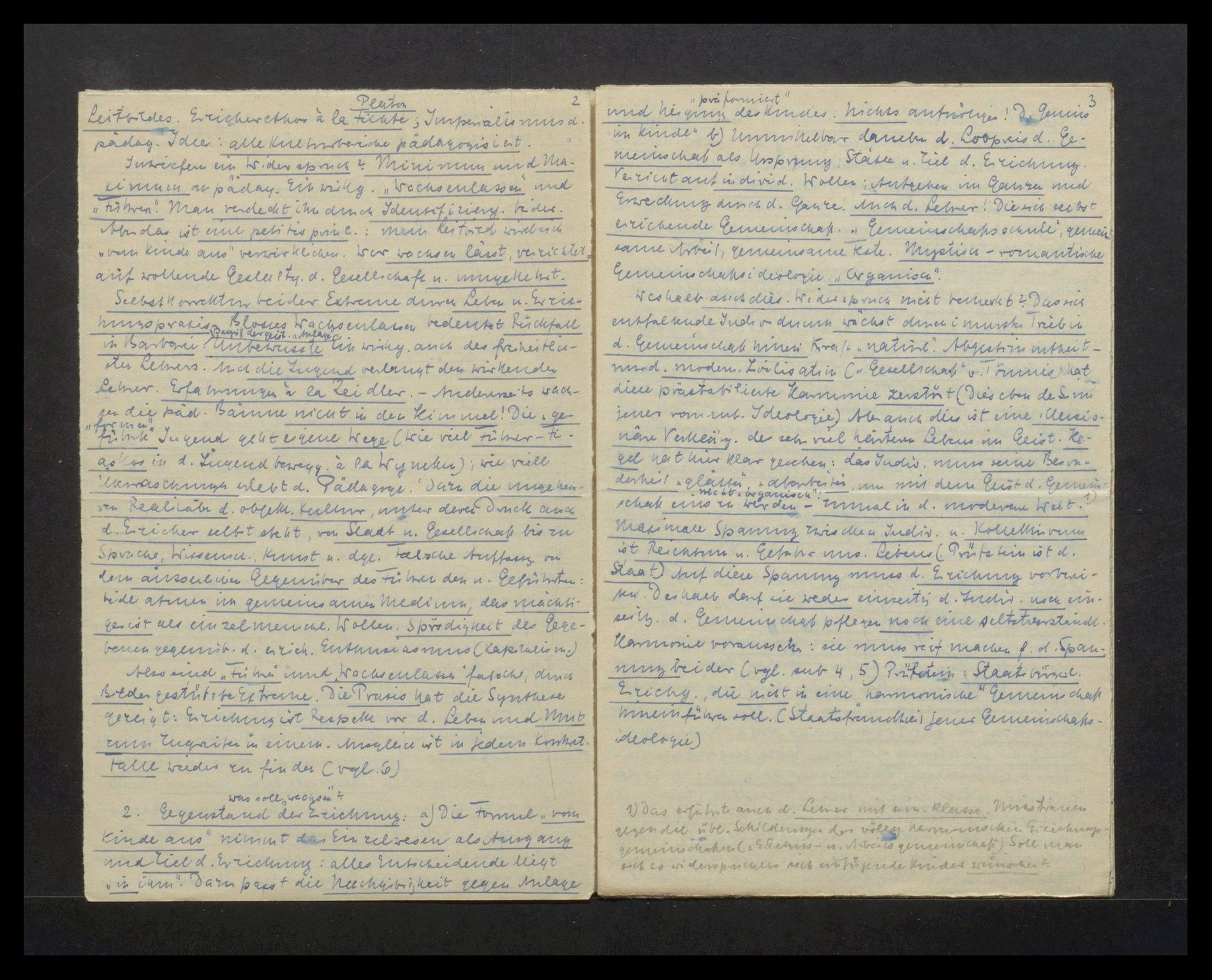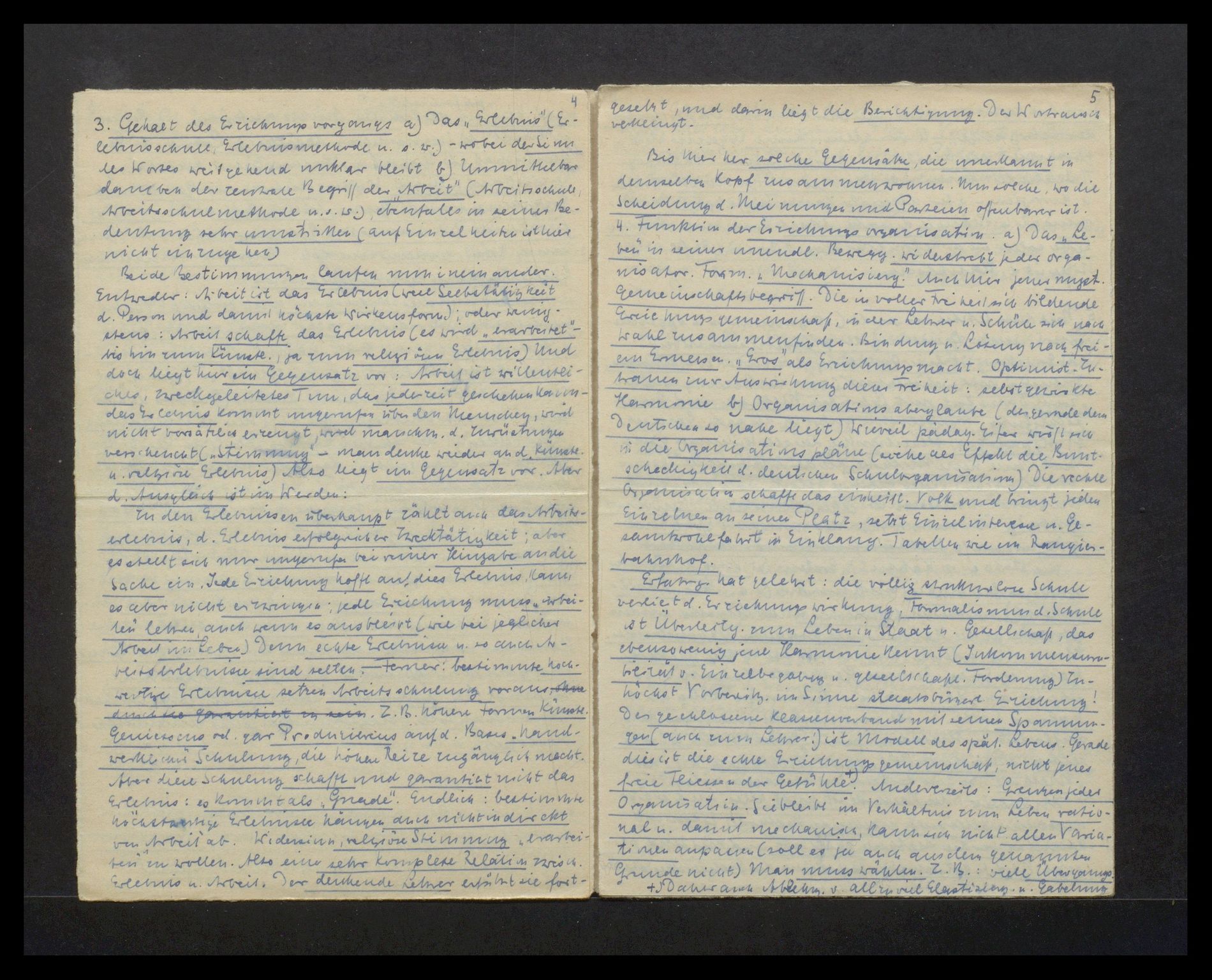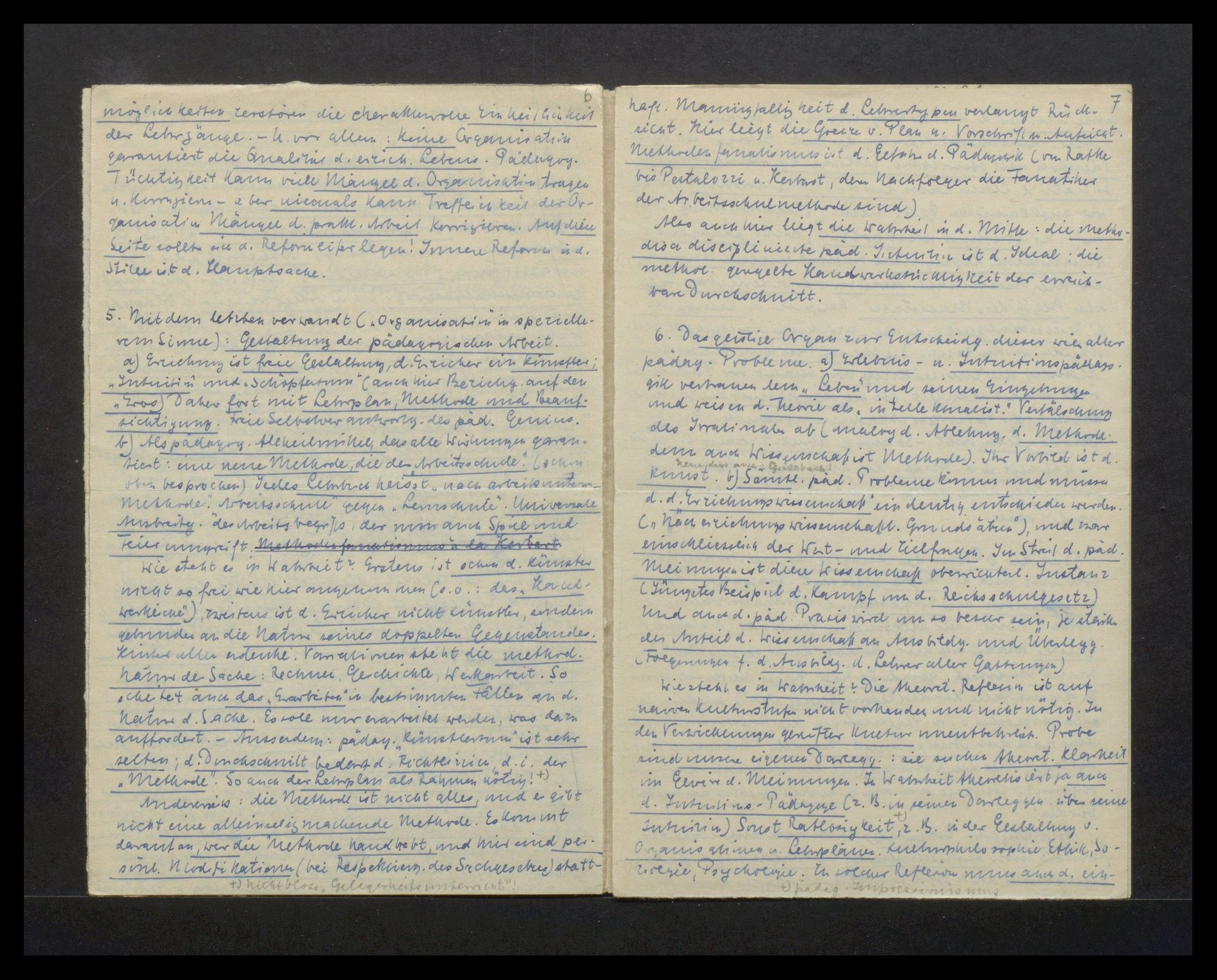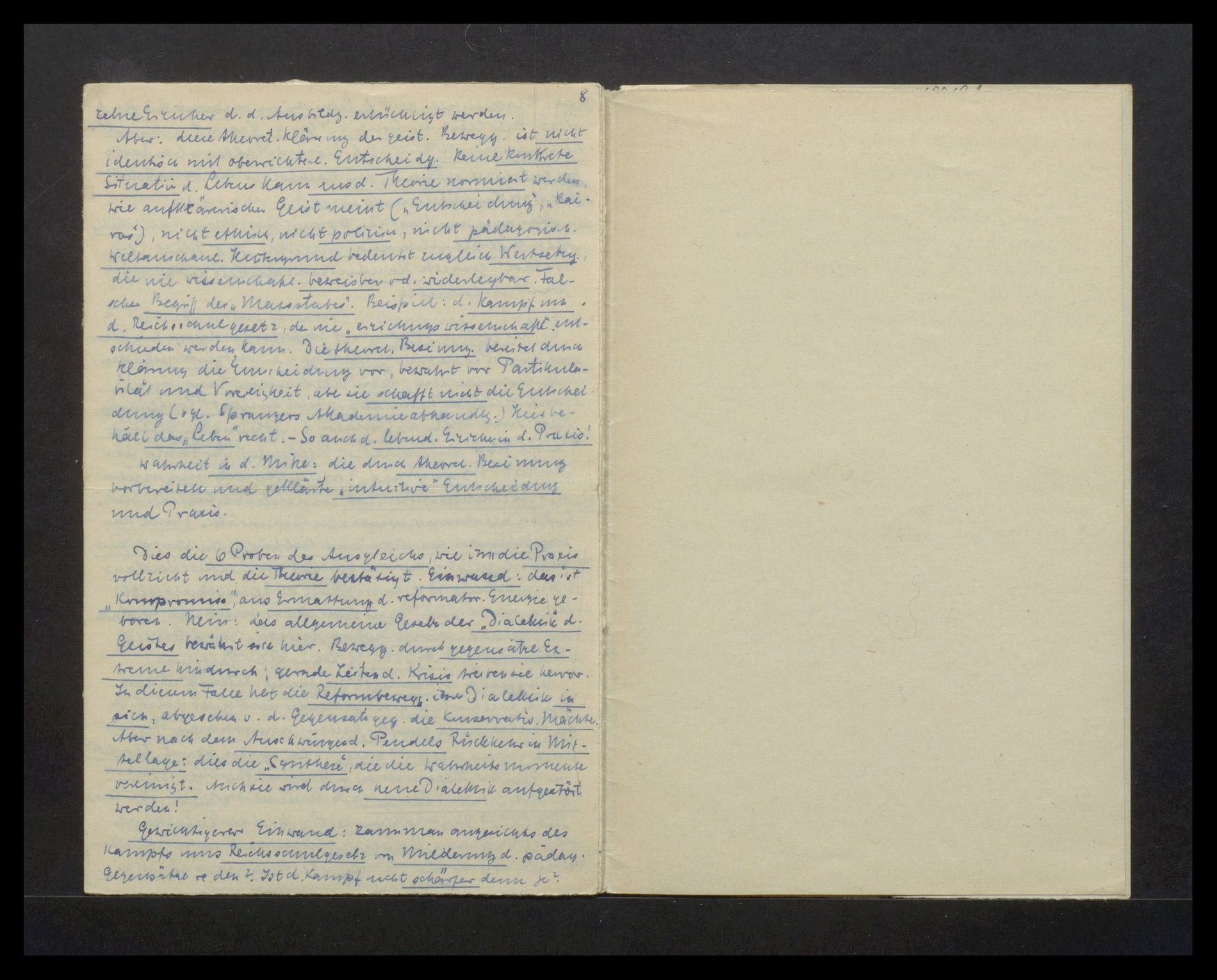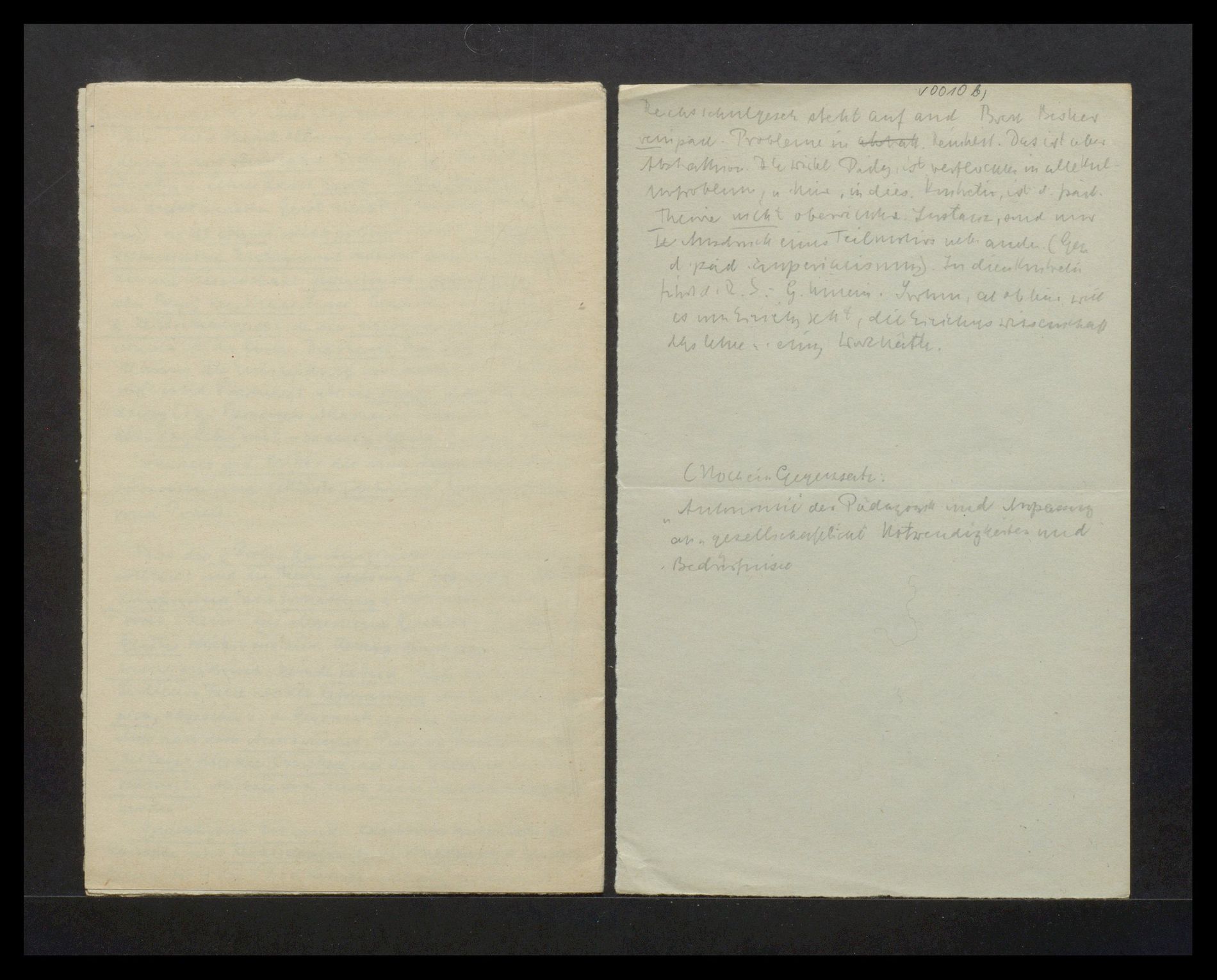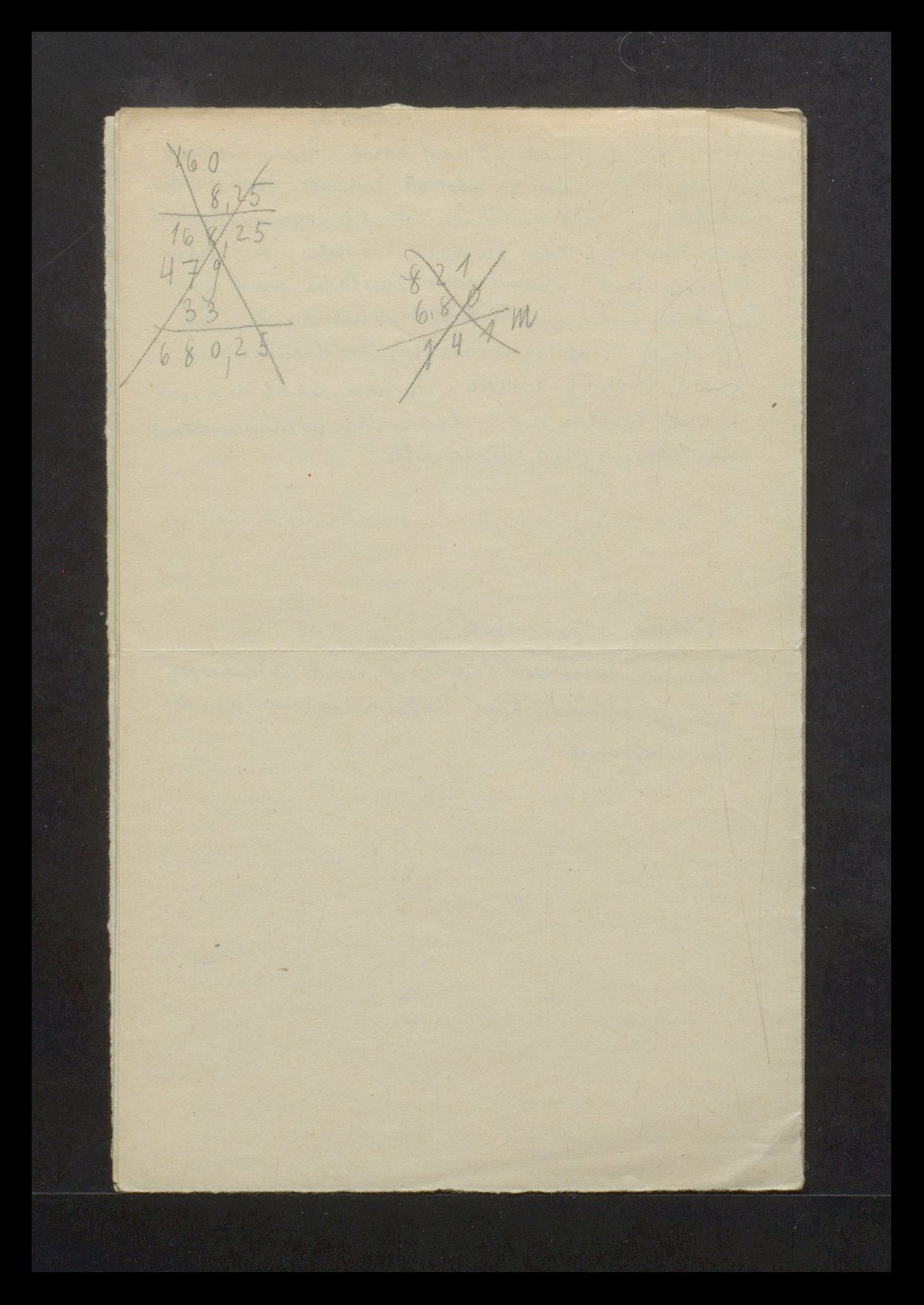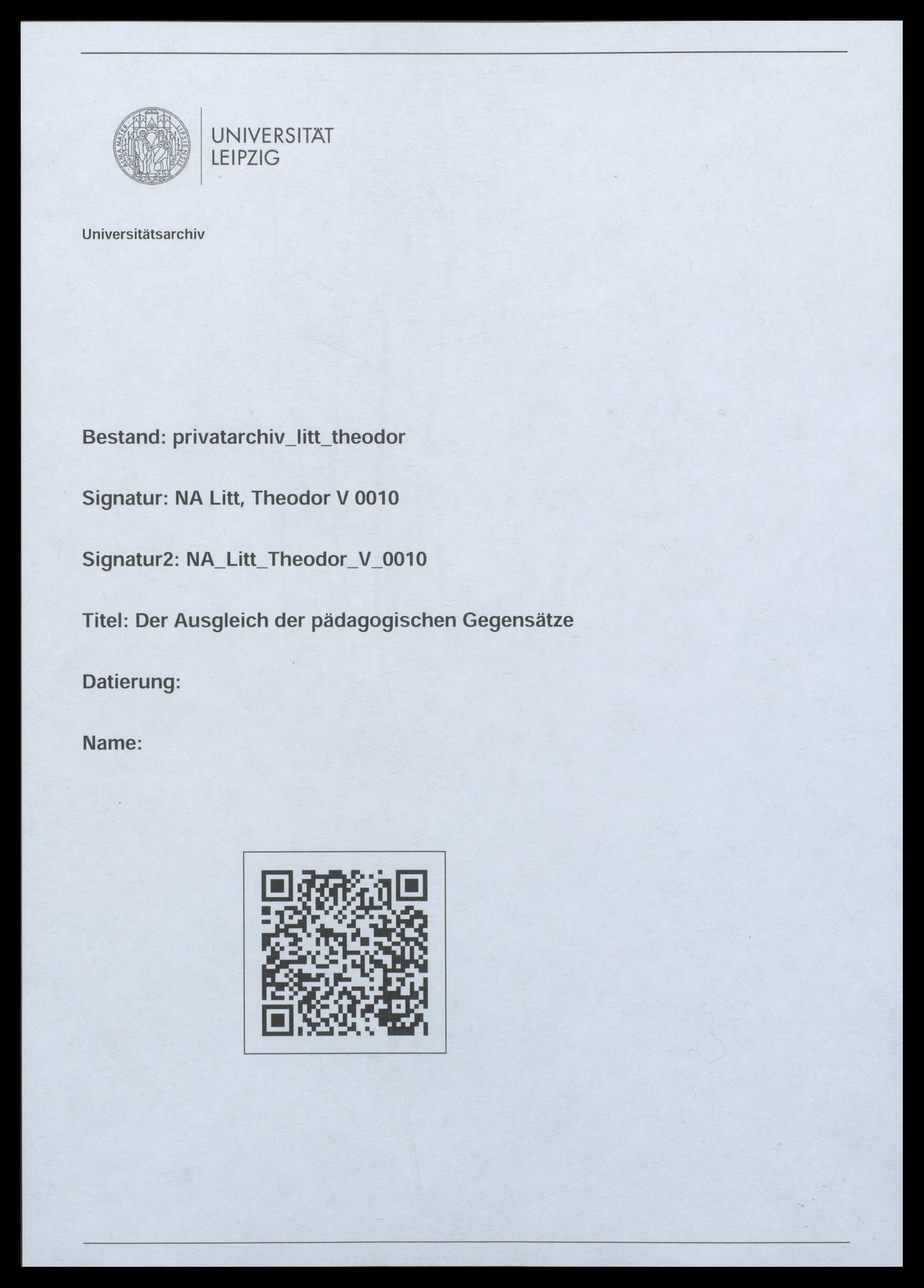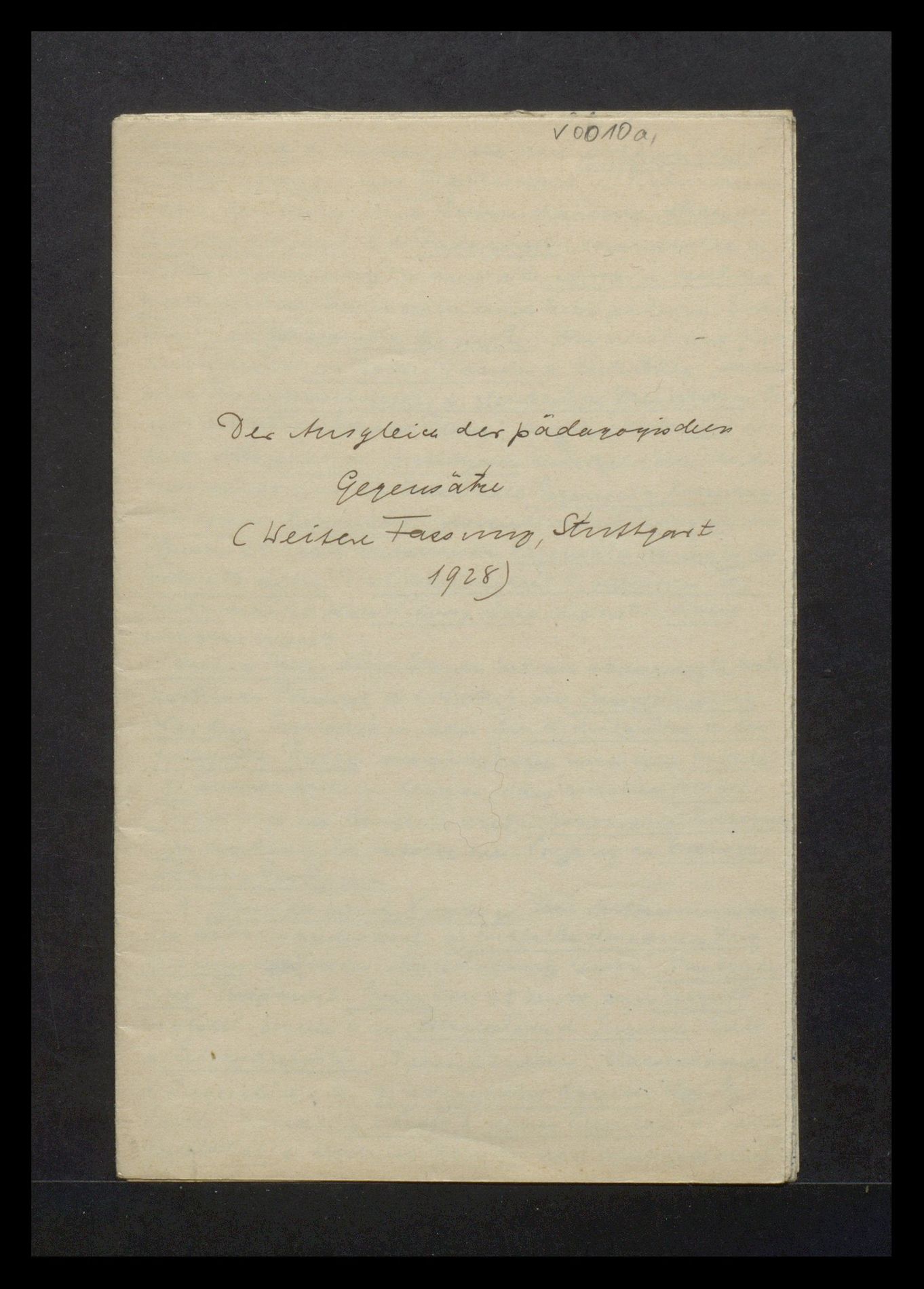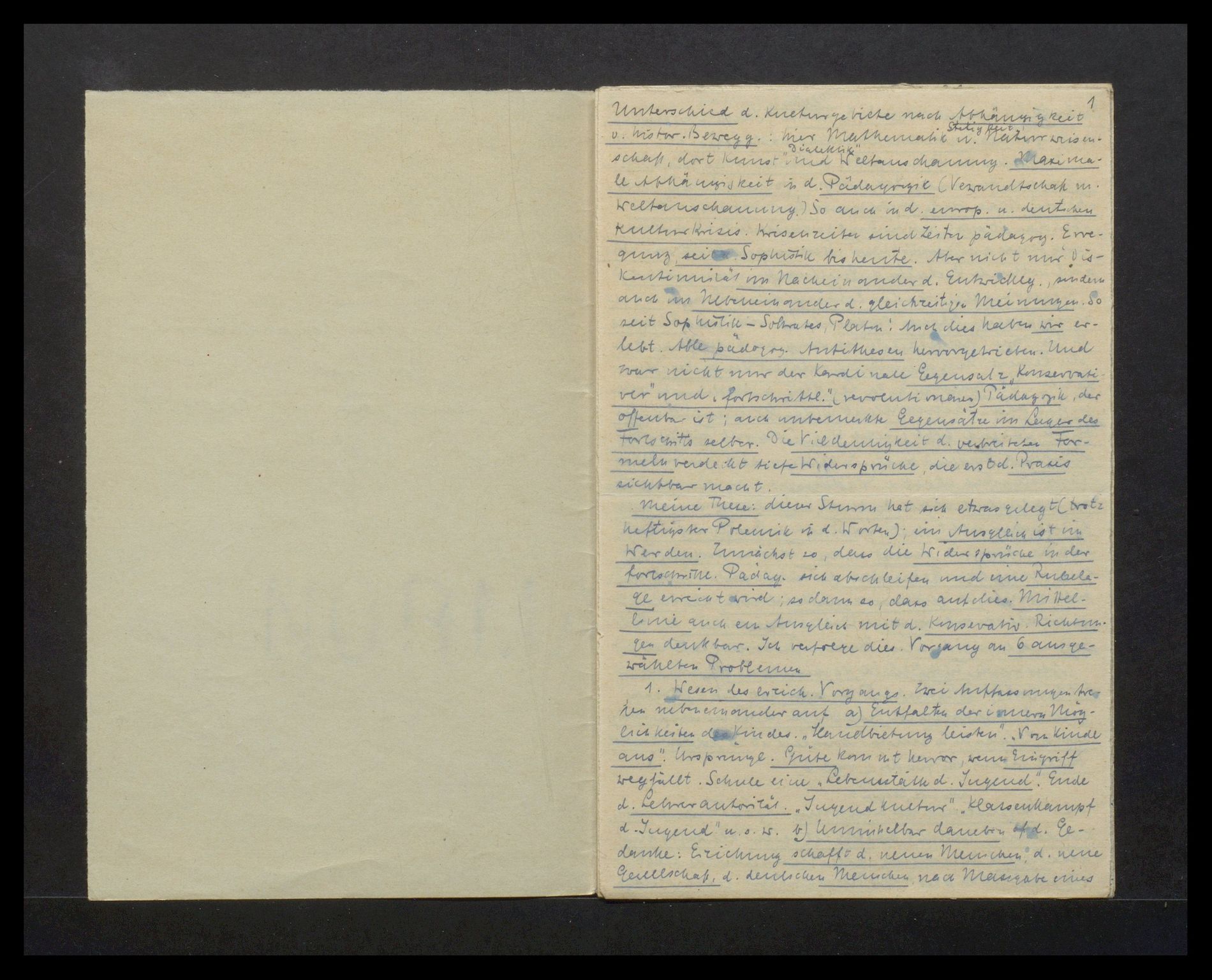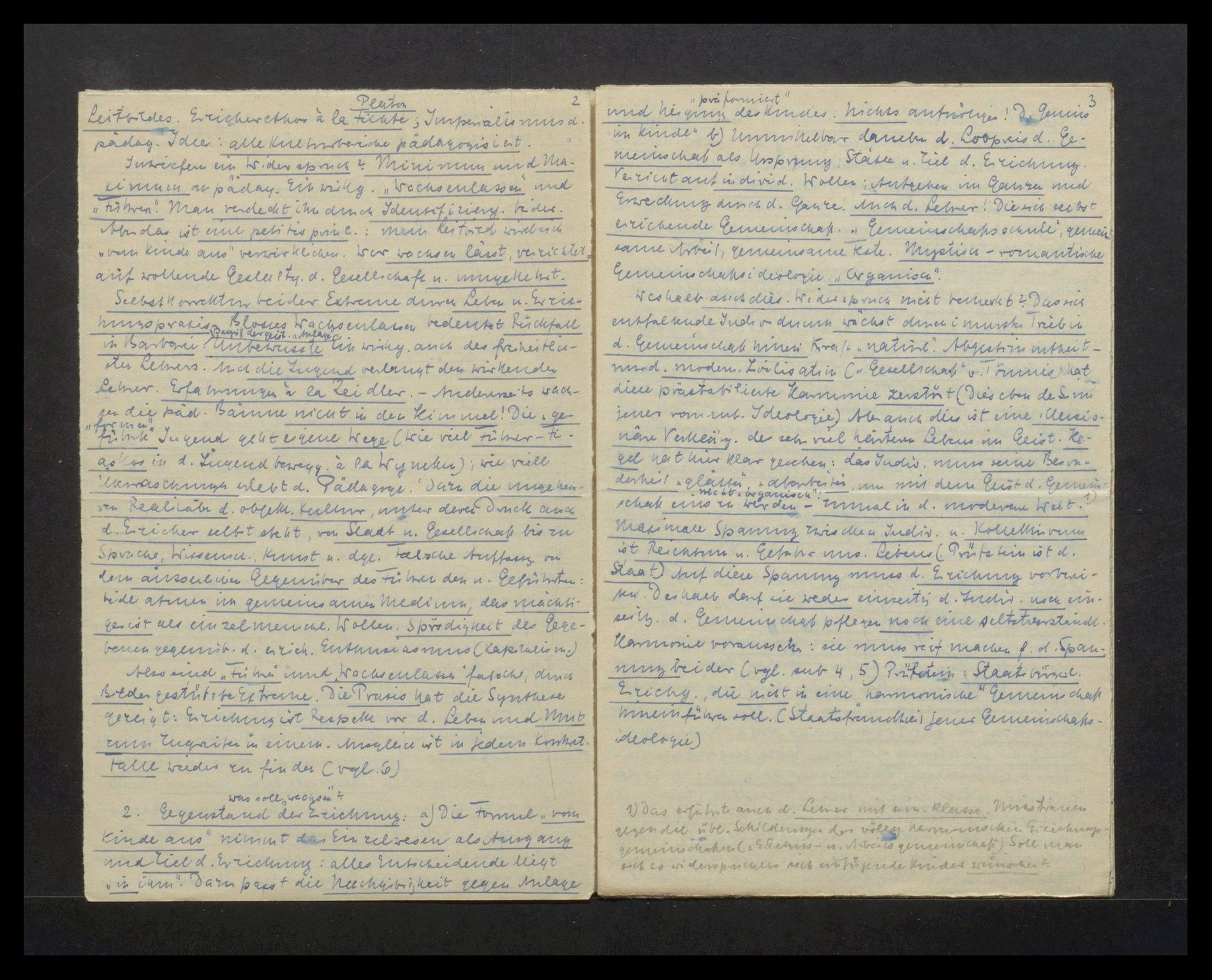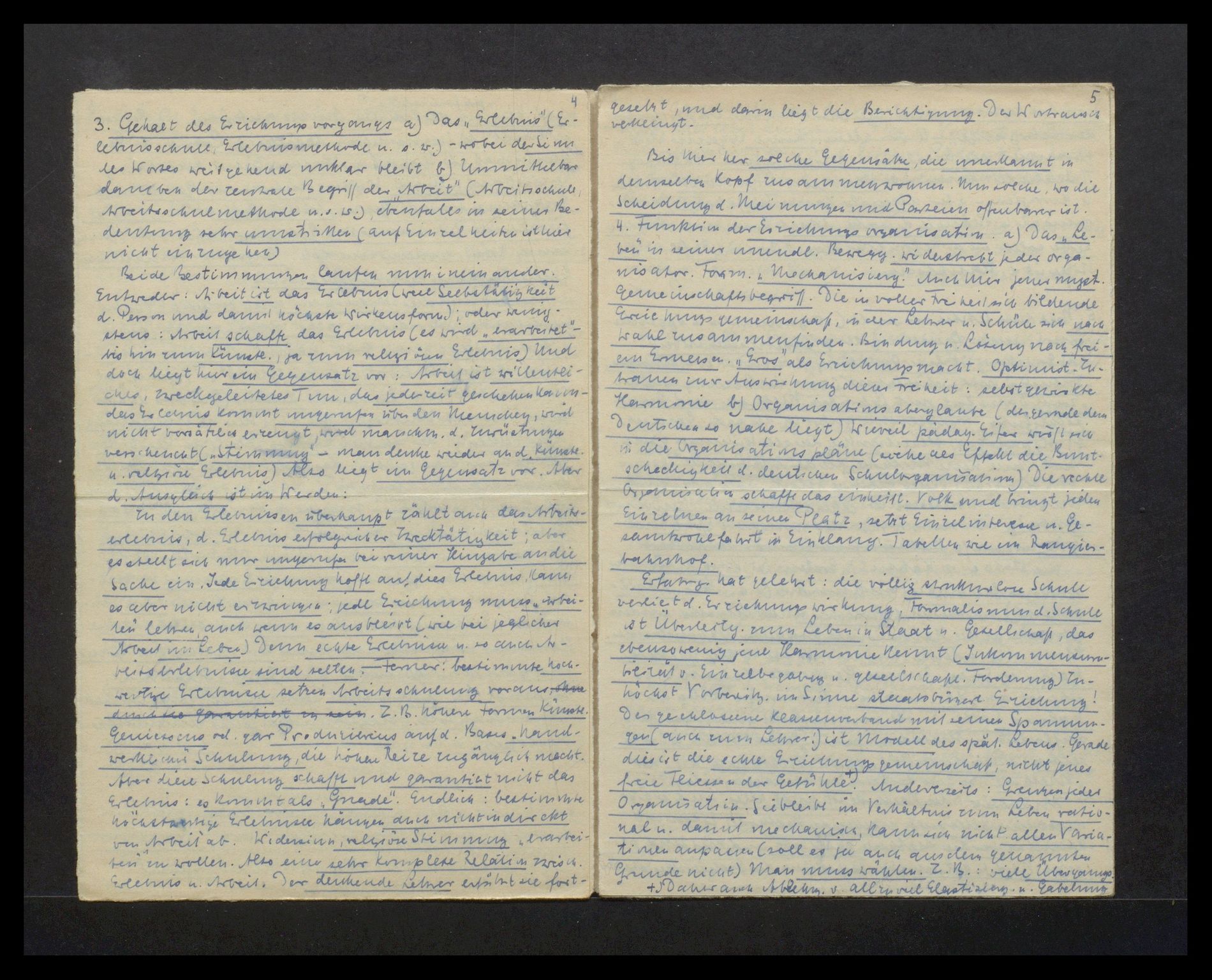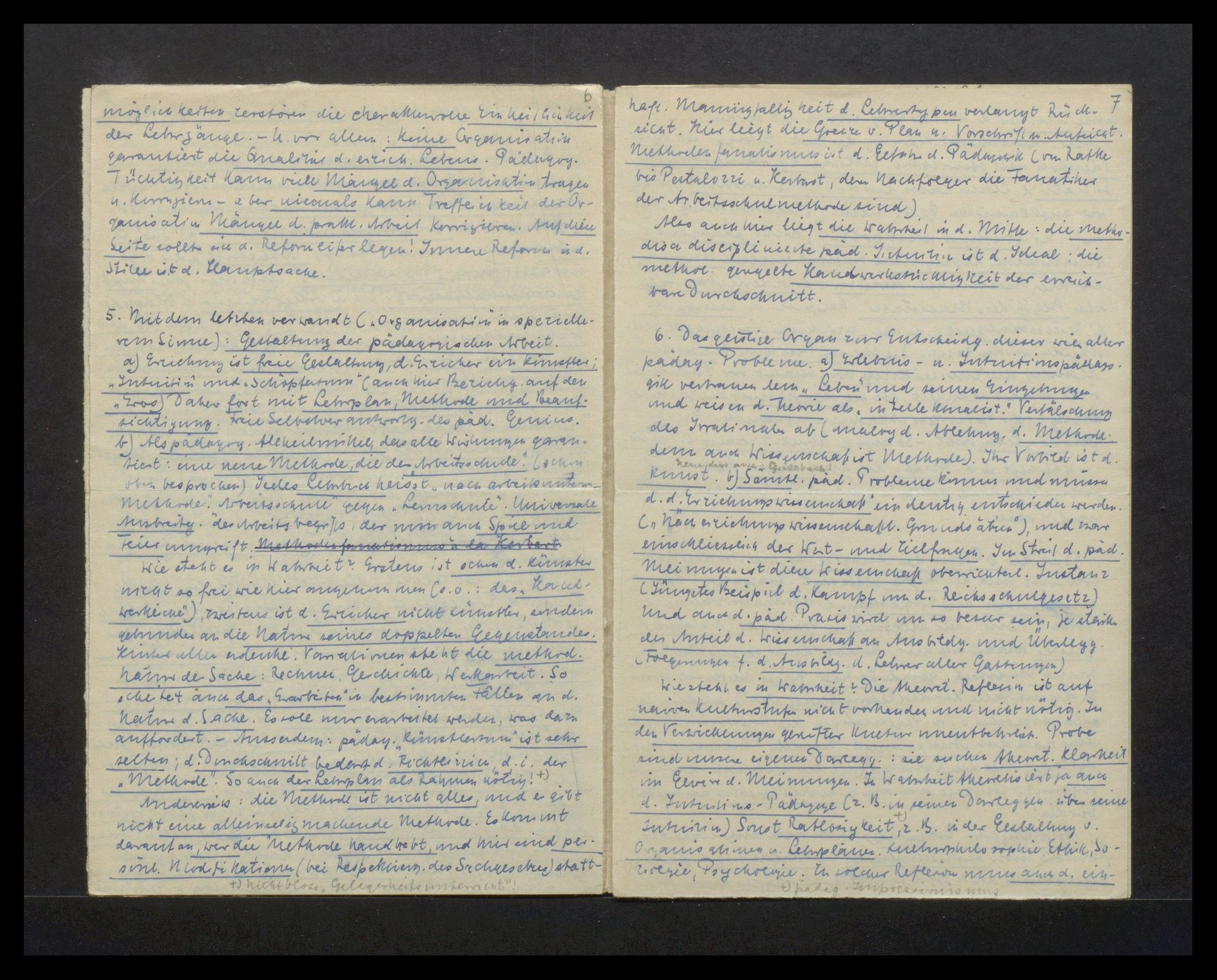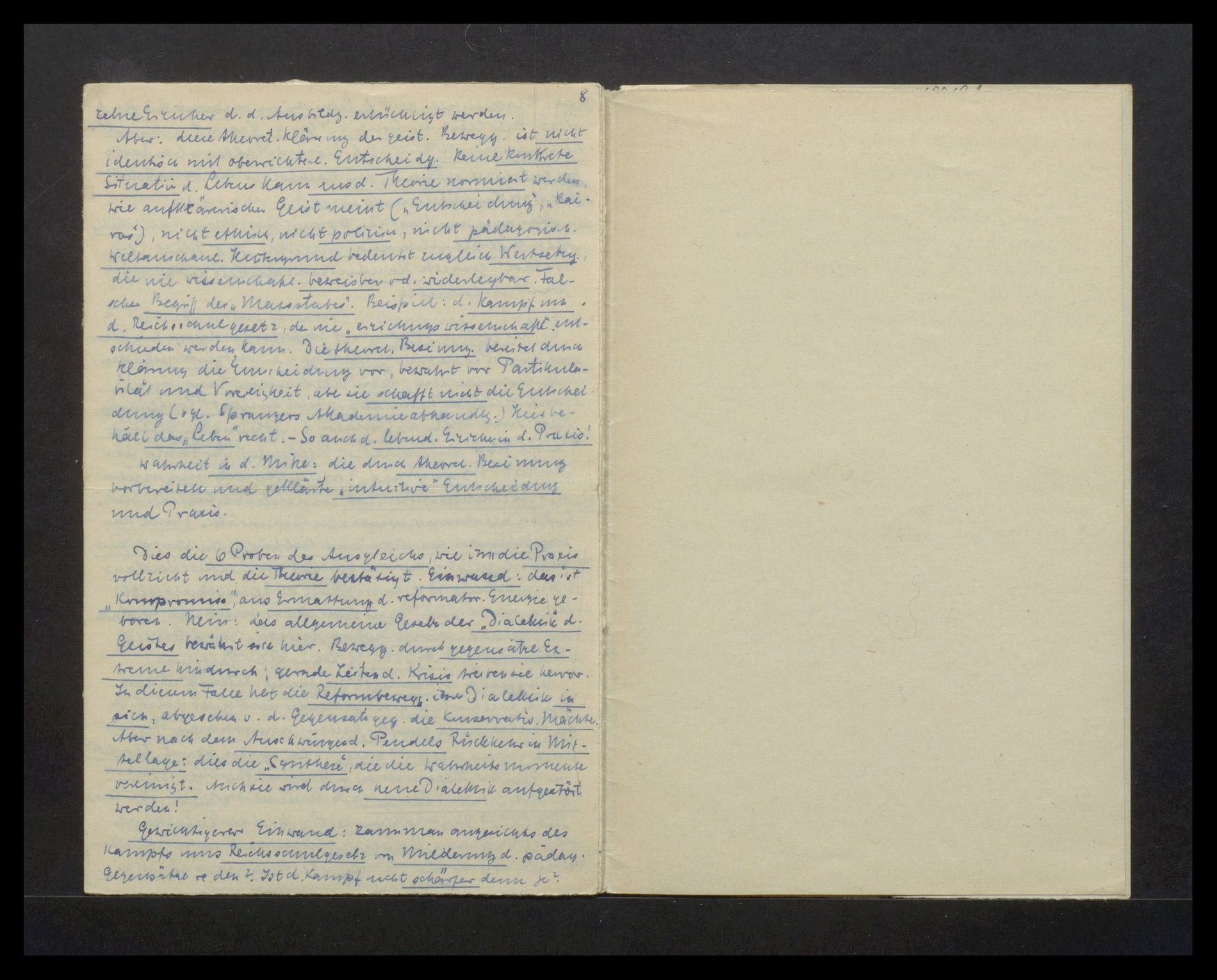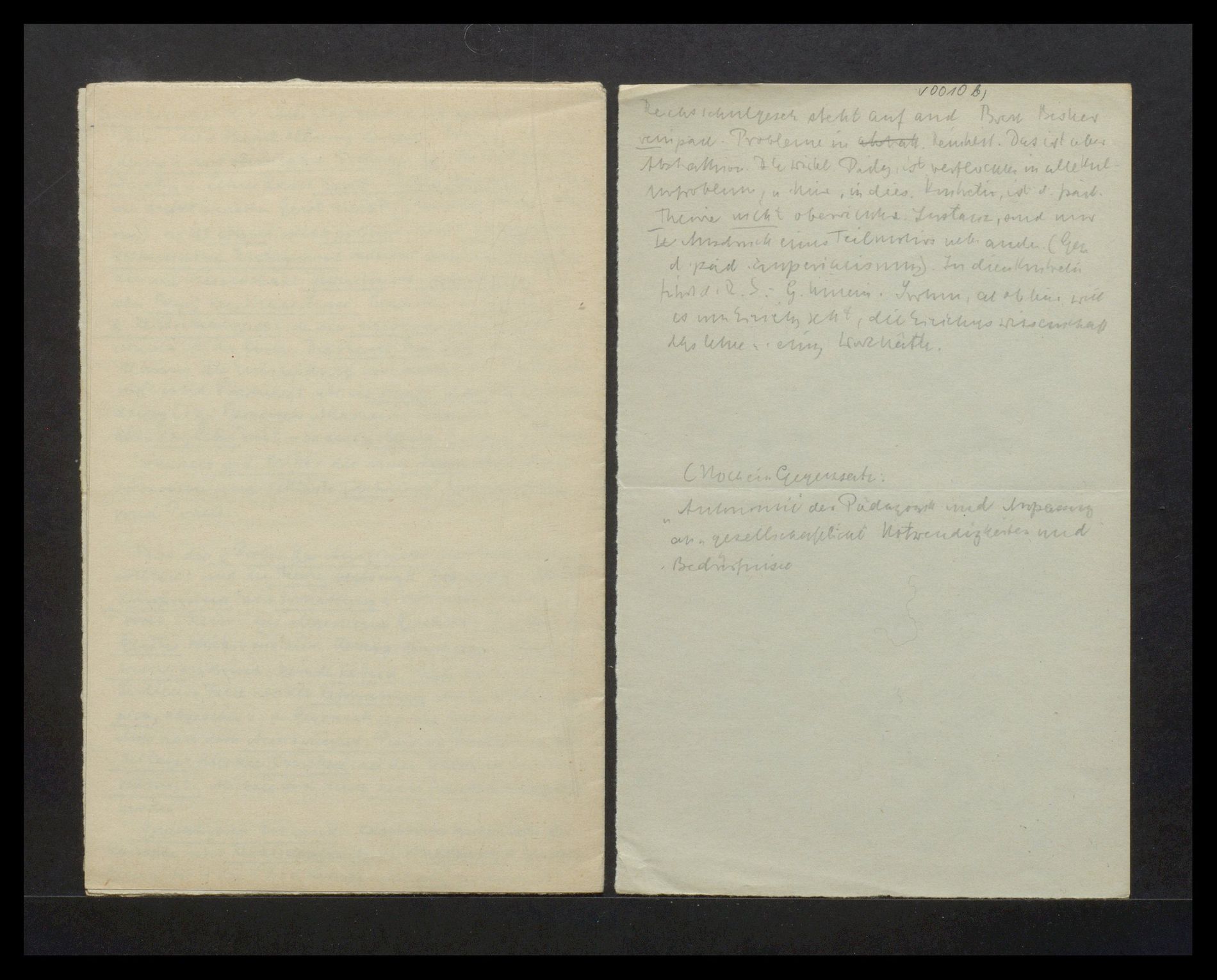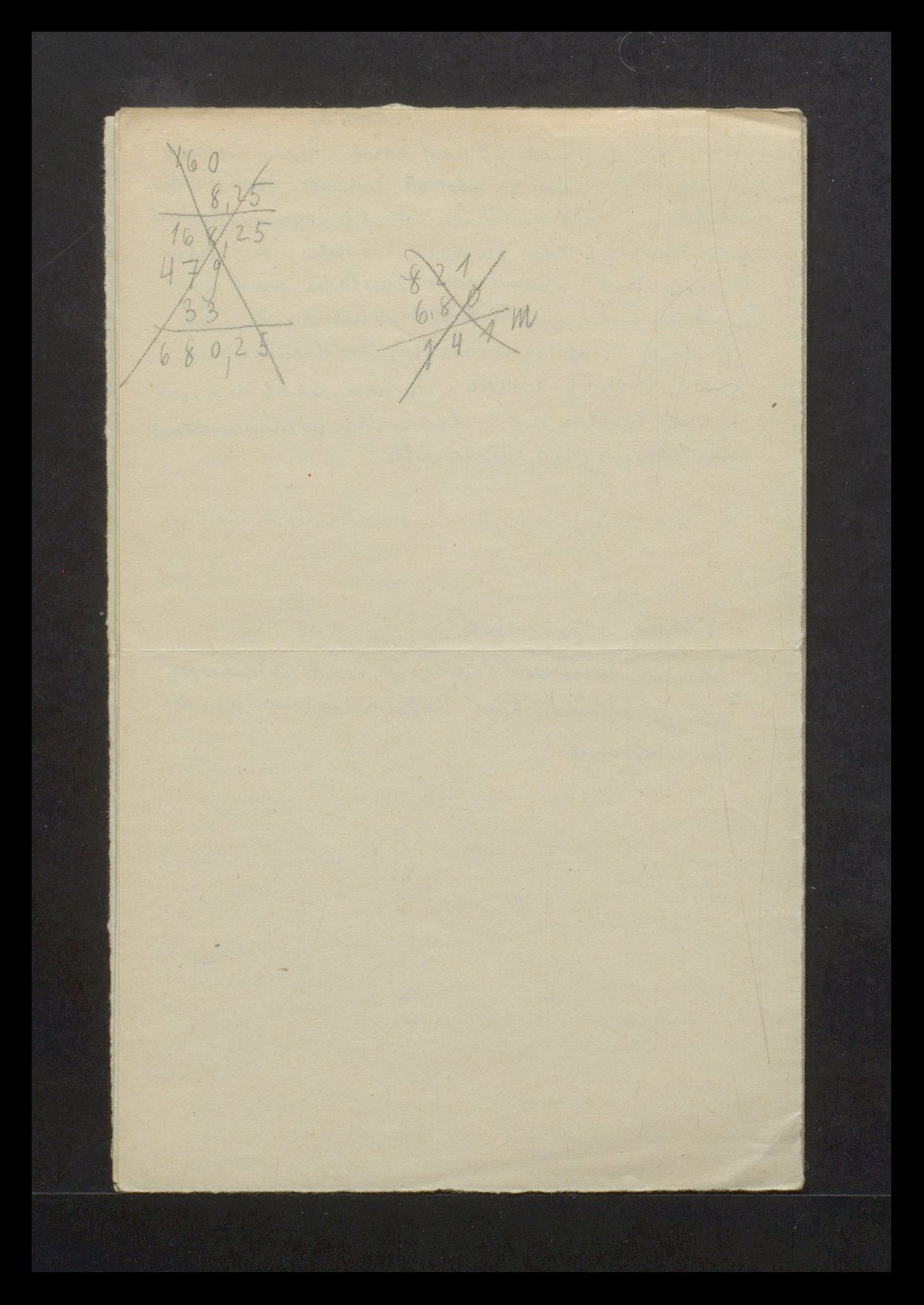| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0010 a
1928
Titelblatt
Der Ausgleich der pädagogischen Gegensätze
(Weitere Fassung, Stuttgart 1928)
1
Unterschied d. Kulturgebiete nach Abhängigkeit
Stetigkeit
v. histor. Bewegg.: hier Mathematik u. Naturwisen-
„Dialektik“
schaft, dort Kunst und Weltanschauung. Maxima-
le Abhängigkeit in d. Pädagogik (Verwandtschaft m.
Weltanschauung.) So auch in d. europ. u. deutschen
Kulturkrisis. Krisenzeiten sind Zeiten pädagog. Erre-
gung, seit Sophistik bis heute. Aber nicht nur Dis-
kontinuität im Nacheinander d. Entwicklg., sondern
auch im Nebeneinander d. gleichzeitigen Meinungen. So
seit Sophistik – Sokrates, Platon: Auch dies haben wir er-
lebt. Alle pädagogischen Antithesen hervorgetrieben. Und
war nicht nur der Gegensatz „Konservati-
ver“ und „fortschrittl.“ (revolutionärer) Pädagogik, der
offenbar ist; auch unbemerkte Gegensätze im Lager des
Fortschritts selber. Die Vieldeutigkeit d. verbreiteten For-
meln verdeckt tiefe Widersprüche, die erst d. Praxis
sichtbar macht.
Meine These: dieser Sturm hat sich etwas gelegt (trotz
heftigster Polemik in d. Worten); ein Ausgleich ist im
Werden. Zunächst so, dass die Widersprüche in der
fortschrittl. Pädag. sich abschleifen und eine Ruhela-
ge erreicht wird; so dann so, dass auf dies. Mittel-
linie auch ein Ausgleich mit d. Konservativ. Richtun-
gen denkbar. Ich verfolge dies. Vorgang an 6 ausge-
wählten Problemen
1. Wesen des erzieh. Vorgangs. Zwei Auffassungen tre-
ten nebeneinander auf a) Entfalten der inneren Mög-
lichkeiten des Kindes. „Handbietung leisten“. „Vom Kinde
aus“. Ursprüngl. Güte kommt hervor, wenn Eingriff
wegfällt. Schule eine „Lebenstätte d. Jugend“. Ende
d. Lehrerautorität. „Jugendkultur“. „Klassenkampf
d. Jugend“ u.s.w. b) Unmittelbar daneben <..> d. Ge-
danke: Erziehung schafft d. neuen Menschen, d, neue
Gesellschaft, d. deutschen Menschen nach Massgabe eines
2
Platon
Leitbildes. Erzieherethos à la Fichte; Imperialismus d.
pädag. Idee: alle Kulturbereiche pädagogisiert.
Inwiefern ein Widerspruch? Minimum und Ma-
ximum an pädag. Einwirkg. „Wachsenlassen“ und
„Führen“. Man verdeckt ihn durch Identifizierg. beider.
Aber das ist eine petitio princ.: mein Leitbild wird sich
„vom Kinde aus“ verwirklichen. Wer wachsen lässt, verzichtet
auf wollende Gestaltg. d. Gesellschaft u. umgekehrt.
Selbstkorrektur beider Extreme durch Leben u. Erzie-
hungspraxis Blosses Wachsenlassen bedeutet Rückfall
Begriff der geist. „Anlage“.
in Barbarei. Unbewusste Einwirkg. auch des freiheitlich-
sten Lehrers Auch die Jugend verlangt den wirkenden
Lehrer. Erfahrungen à la Zeidler. – Andererseits wach-
sen die päd. Bäume nicht in den Himmel! Die „ge-
„formen“
führte“ Jugend geht eigene Wege (wie viel Führer-Fi-
askos in d. Jugenbewegg. à la Wyneken); wie viel
Überraschungen erlebt d. Pädagoge. Dazu die ungeheu-
ren Realität d. objekt. Kultur, unterderen Druck auch
d. Erzieher selbst steht, von Staat u. Gesellschaft bis zu
Sprache, Wissensch., Kunst u. dgl. Falsche Auffassg. von
dem äusserlichen Gegenüber des Führenden u. Geführten:
beide atmen im gemeinsamen Medium, das mächti-
ger ist als einzelmenschl. Wollen. Sprödigkeit des Gege-
benen gegenüb. d. erzieh. Enthusiasmus (Kapitalism.)
Also sind „Führen“ und „Wachsenlassen“ falsche, durch
Bilder gestützte Extreme. Die Praxis hat die Synthese
gezeigt: Erziehung ist Respekt vor d. Leben und Mut
zum Zugreifen in einem. Ausgleich ist in jedem konkret.
Falle wieder zu finden (vgl. 6)
was soll „wachsen“?
2. Gegenstand der Erziehung: a) Die Formel „vom
Kinde aus“ nimmt das Einzelwesen als Ausgang
und Ziel d. Erziehung: alles Entscheidende liegt
„in ihm“. Dazu passt die Nachgiebigkeit gegen Anlage
3
„präformiert“
und Neigung des Kindes. Nichts aufnötigen! D. „Genius
im Kinde“ b) Unmittelbar daneben d. Lobpreis d. Ge-
meinschaft als Ursprung, Stätte u. Ziel d. Erziehung.
Verzicht auf individ. Wollen: Aufgeben im Ganzen und
Erweckung durch d. Ganze. Auch d. Lehrer! Die sich selbst
erzeihende Gemeinschaft. „Gemeinschaftsschule“, gemein-
same Arbeit, gemeinsame Feste. Mystisch-romantische
Gemeinschaftsideologie. „Organisch“.
Weshalb auch dies. Widerspruch nicht bemerkt? Das sich
entfaltende Individuum wächst durch Trieb in
d. Gemeinschaft hinein Kraft „natürl.“ modern. Zivilisation („Gesellschaft“ v. Tönnis) hat
diese prästabilierte Harmonie zerstört (Dies eben d. Sinn
jener romant. Ideologie) Abeer auch dies ist eine illusio-
näre Verklärg. der sehr viel härteren Lebens im Geist. He-
gel hat hier klar gesehen: das Indiv. muss seine Beson-
derheit „glätten“, „abarebiten“, um mit dem Geist d. Gemein-
„nicht organisch“! ---
schaft eins zu werden - Zumal in d. modernen Welt. 1)
Maximale Spannung zwischen Indiv. u. Kollektiven
ist Reichtum u. Gefahr uns. Lebens (Prüfstein ist d.
Staat) Auf diese Spannung muss d. Erziehung vorberei-
ten. Deshalb darf sie weder einseitig d. Indiv. noch ein-
seitig d. Gemeinschaft pflegen noch eine selbstverständl.
Harmonie voraussetzen: sie muss reif machen f. d. Span-
nung beider (vgl. auf 4,5) Prüfstein : Staatbürgerl.
Erziehg., die nicht in eine „harmonische“ Gemeinschaft
hineinführen soll. (Staatsfreundlichkeit jener Gemeinschafts-
ideologie)
1) Das erfährt auch d. Lehrer mit sein. klasse. Misstrauen
gegen die übl. Schilderungen der völlig harmonischen Erziehungs-
gemeinschaften („Erlebnis- u. Arbeitsgemeinschaft“) Soll man
sich so widerspruchlos sich einfügende Kinder wünschen?
4
3. Gehalt des Erziehungsvorgangs a) Das „Erlebnis“ (Er-
lebnisschule, Erlebnismethode u.s.w.) – wobei der Sinn
des Wortes weitgehend unklar bleibt b) Unmittelbar
daneben der zentrale Begriff der „Arbeit“ (Arbeitsschule,
Arbeitsschulmethoden u.s.w.), ebenfalls in seiner Be-
deutung sehr umstritten (auf Einzelheiten ist hier
nicht einzugehen)
Beide Bestimmungen laufen nun ineinander.
Entweder: Arbeit ist das Erlebnis (weil) Selbstätigkeit
d. Person und damit höchste Wirkensform; oder wenig-
stens: Arbeit schaft das Erlebnis (es wird „erarbeitet“-
bis hin zum künstl., ja zum religiösen Erlebnis) Und
doch liegt hier ein Gegensatz vor: Arbeit ist willentli-
ches, zweckgeleitetes Tun, das jederzeit geschehen kann –
das Erlebnis kommt ungerufen über den Menschen, wird
nicht vorsätzlich erzeugt, wird manchm. d.
verscheucht („Stimmung“ – man denke wieder an d. künstl.
u. religiöse Erlebnis) Also liegt ein Gegensatz vor. Aber
d. Ausgleich ist im Werden:
Zu den Erlebnissen überhaupt zählt auch das Arbeits-
erlebnis, d. Erlebnis erfolgreicher Zwecktätigkeit; aber
es stellt sich nur ungerufen bei reiner Hingabe an die
Sache ein. Jede Erziehung hofft auf dies Erlebnis, kann
es aber nicht erzwingen; jede Erziehung muss „arbei-
ten“ lehren, auch wenn es ausbleibt (wie bei jeglicher
Arbeit im Leben) Denn echte Erlebnisse u. so auch Ar-
beitserlebnisse sind selten. – Frener: bestimmte hoch-
wertige Erlebnisse setzen Arbeitsschulung voraus, ohne
durch sie garantiert zu sein. Z.B. höhere Formen künstl.
Geniessens od. gar Produzierens auf d. Basis „hand-
werklicher“ Schulung, die höhere Reize zugänglich macht.
Aber diese Schulung schaft und garantiert nicht das
Erlebnis: es kommt als „Gnade“. Endlich: bestimmte
höchstwertige Erlebnisse hängen auch nicht indirekt
von Arbeit ab. Widersinn, religiöse Stimmung „erarbei-
ten“ zu wollen. Also eine sehr komplexe Relation zwisch.
Erlebnis u. Arbeit. Der denkende Lehrer erfährt sie fort-
5
gesetzt, und darin liegt die Berichtigung. Der Wortrausch
verklingt.
Bis hierher solche Gegensätze, die unerkannt in
demselben Kopf zusammenkommen. Nun solche, wo die
Scheidung d. Meinungen und Parteien offenbarer ist.
4. Funktion der Erziehungsorganisation. a) Das „Le-
ben“ in seiner unendl. Bewegg. widerstrebt jeder orga-
nisator. Form. „Mechanisierg.“ Auch hier jener myst.
Gemeinschaftsbegriff. Die in voller Freiheit sich bildende
Erziehungsgemeinschaft, in der Lehrer u. Schüler sich nach
Wahl zusammenfinden. Bindung u. Lösung nach fre-
em Ermessen. „Eros“ als Erziehungsmacht. Optimist. Zu-
trauen zur Auswirkung dieser Freiheit: selbstgewirkte
Harmonie b) Organisationsaberglaube (der gerade dem
Deutschen so nahe liegt) Wieviel pädag. Eifer wirft sich
in die Organisationspläne (siehe als Effekt die Bunt-
scheckigkeit d. deutschen Schulorganisation) Die rechte
Organisation schafft das einheitl. Volk und bringt jeden
Einzelnen an seinen Platz, setzt Einzelinteresse u. Ge-
samtwohlfahrt in Einklang. Tabellen wie im Rangier-
bahnhof.
Erfahrg. hat gelehrt: die völlig strukturlose Schule
verliert d. Erziehungswirkung, Formalismus d. Schule
ist Überleitg. zum Leben in Staat u. Gesellschaft, das
ebensowenig jene Harmonie kennt ( v. Einzelbegabung u. gesellschaftl. Forderung) Zu-
höchst Vorbereitg. im Sinne staatsbürgerl. Erziehung!
Der geschlossene Klassenverband mit seinen Spannun-
gen (auch zum Lehrer!) ist Modell des spät. Lebens. Gerade
dies ist die echte Erziehungsgemeinschaft, nicht jenes
freie Fliessen der Gefühle. +) Andererseits: Grenzen jeder
Organisation. Sie bleibt im Verhältnis zum Leben ratio-
nal u. damit mechanisch, kann sich nicht allen Varia-
tionen anpassen (soll es ja auch aus dem genannten
Grunde nicht) Man muss wählen. Z.B.: viele Übergangs-
+) Daher auch Ablehng. v. allzuviel Elastizierg. u. Gabelung
6
möglichkeiten zerstören die charaktervolle Einheitlichkeit
der Lehrgänge. – U. vor allem: keine Organisation
garantiert die Qualität d. erzeih. Lebens. Pädagog.
Tüchtigkeit kann viele Mängel d. Organisation tragen
u. korrigieren – aber niemals kann Trefflichkeit der Or-
ganisation Mängel d. prakt. Arbeit korrigieren. Auf diese
Seite sollte sich d. Reformeifer legen! Innere Reform in d.
Stille ist d. Hauptsache.
5. Mit dem letzten verwandt („Organisation“ in spezielle-
rem Sinne): Gestaltung der pädagogischen Arbeit.
a) Erziehung ist freie Gestaltung, d. Erzieher ein Künstler;
„Intuition“ und „Schöpfertum“ (auch hier Beziehg. auf den
„Eros“) Daher fort mit Lehrplan, Methode und Beauf-
sichtigung. Freie Selbstverantwortung des päd. Genius.
b) Als pädagog. Allheilmittel, das alle Wirkungen garan-
tiert: eine neue Methode, die der „Arbeitsschule“. (schon
oben besprochen) Jedes Lehrbuch heisst „nach arbeitsunter.
Methode“. „Arbeitsschule“ gegen „Lernschule“. Universale
Ausbreitg. des Arbeitsbegriffs, der nun auch Spiel und
Feier umgreift. Methodenfanatismus à la Herbart
Wie steht es in Wahrheit? Erstens ist schon d. Künstler
nicht so frei wie hier angenommen (s.o.: das „Hand-
werkliche“), zweitens ist d. Erzieher nicht Künstler, sondern
gebunden an die Natur seines doppelten Gegenstandes.
Hinter allen erdenkl. Variationen steht die method.
Mauer der Sache: Rechnen, Geschichte, Werkarbeit. So
scheitert auch das „Erarbeiten“ in bestimmten Fällen an d.
Natur d. Sache. Es soll nur erarbeitet werden, was dazu
auffordert. – Ausserdem: pädag. „Künstlertum“ ist sehr
selten; d. Durchschnitt bedarf d. Richtlinien, d. i. der
„Methode“. So auch der Lehrplan als Rahmen nötig! +)
Andererseits: die Methode ist nicht alles, und es gibt
nicht eine alleinseligmachende Methode. Es kommt
darauf an, wer die Methode handhabt, und hier sind per-
sönl. Modifikationen (bei Respektieren des Sachgesetzes) statt-
+) Nicht bloss „Gelegenheitsunterricht“!
7
haft. Mannigfaltigkeit d. Lehrertypen verlangt Rück-
sicht. Hier liegt die Grenze v. Plan u. Vorschrift n. Aufsicht.
Methodenfanatismus ist d. Gefahr d. Pädagogik (von Ratke
bis Pestalozzi u. Herbart, deren Nachfolger die Fanatiker
der Arbeitsschulmethode sind).
Also auch hier liegt die Wahrheit in d. Mitte: die metho-
disch disciplinierte päd. Intition ist d. Ideal: die
method. geregelte Handwerkstüchtigkeit der erreich-
bare Durchschnitt.
6. Das geistige Organ zur Entscheidg. dieser wie aller
pädag. Probleme. a) Erlebnis – u. Intuitionspädago-
gik vertrauen dem „Leben“ und seinen Eingebungen
und weisen d. Theorie als „intellektualist.“ Verfälschung
des Irrationalen ab (analog d. Ablehng. d. Methode
denn auch Wissenschaft ist Methode). Ihr Vorbild ist d.
Neuerdings auch !
Kunst. b) Sämtl. päd. Probleme können und müssen
d. d. „Erziehungswissenschaft“ eindeutig, entschieden werden.
(„Nacherziehungswissenschaftl. Grundsätze“), und zwar
einschliesslich der Wert- und Zeilfragen. Im Streit d. päd.
Meinungen ist diese Wissenschaft oberrichterl. Instanz
(Jüngstes Beispiel d. Kampf um d. Reichschulgesetz)
Und auch d. päd. Praxis wird um so besser sein, je stärker
der Anteil d. Wissenschaft an Ausbildg. und Überllgg.
(Folgerungen f. d. Ausbildg. d. Lehrer aller Gattungen)
Wie steht es in Wahrheit? die theoret. Reflexion ist auf
naiven Kulturstufen nicht vorhanden und nicht nötig. In
den Verwicklungen gereifter Kultur unentbehrlich. Probe
sind unsere eigenen Darlegg.: sie suchen theoret. Klarheit
im Gewirr d. Meinungen. In Wahrheit theoretisiert ja auch
d. Intuitions-Pädagoge (z.B. in seinen Darleggem über seine
Intuition) Sonst Ratlosigkeit +), z.B. in der Gestaltung v.
Organisationen u. Lehrplänen. Kulturphilosophie, Ethik, So-
ziologie, Psychologie. Zu solcher Reflexion muss auch d. ein-
pädag. Impressionismus
8
zelne Erzieher d. d. Ausbildg. ertüchtigt werden.
Aber: diese theoret. Klärung der geist. Bewegg. ist nicht
identisch mit oberrichterl. Entscheidg. keine konkrete
Situation d. Lebens kann aus d. Theorie normiert werden,
wie aufklärerischer Geist meint („Entscheidung“, <“Rai-
ros“>, nicht ethisch, nicht politisch, nicht pädagogisch.
Weltanschaul. Hintergrund bedeutet zugleich Wertsetzg.,
die nie wissenschaftl. beweisbar od. widerlegbar. Fal-
scher Begriff des „Massstabes“. Beispiel: d. Kampf um
d. Reichsschulgesetz, „erziehungswissenschaftl.“ ent-
schieden werden kann. Die theoret. Besinng. bereitet durch
Klärung die Entscheidung vor, bewahrt vor Partikula-
rität und Voreiligkeit, aber sie schafft nicht die Entschei-
dung (vgl. Sprangers Akademieabhandlg.) Hier be-
hält das „Leben“ recht. – So auch d. lebend. Einblicke in d. Praxis!
Wahrheit in d. Mitte: die durch theoret. Besinnung
vorbereitet und geklärte „intuitive“ Entscheidung
und Praxis.
Dies die 6 Proben des Ausgleichs, wie ihn die Praxis
vollzieht und die Theorie bestätigt. Einwand: das ist
„Kompromiss“, aus Ermattung d. reformator. Energie ge-
boren. Nein: das allgemeine Gesetz der „Dialektik“ d.
Geistes bewährt sich hier. Bewegg. durch gegensätzl. Ex-
treme hindurch; gerade Zeiten d. Krisis treiben sie hervor.
In diesem Falle hat die Reformbewegg. ihre Dialektik in
sich, abgesehen v. d. Gegensatz geg. die konservativ. Mächte.
Aber nach dem Ausschwingen d. Pendels Rückkehr in Mit-
tellage: dies die „Synthese“, die die Wahrheitsmomente
vereinigt. Auch sie wird durch neue Dialektik aufgestört
werden!
Gewichtigerer Einwand: kann man angesichts des
Kampfes ums Reichsschulgesetz von Milderung d. pädag.
Gegensätze reden? Ist d. Kampf nicht schärfer denn je?
V 0010 b
1928
Reichsschulgesetz staht auf and Brett. Bisher
rein päd. Probleme in anstrak. Reinheit. Das ist aber
Abstraktion. Die wirkl. Pädg. ist verflochten in alle Kul-
turprobleme, u. hier, in dies. , ist d. päd.
Theorie nicht oberrichterl. Instanz, sond. nur
Ausdruck eines Teilmotivs neben anderen (Gew.
d. päd. <..perialismus>). In diese
führt s. R.S. hinein. Irrtum, als ob hier, weil
es um geht, die Erziehungswissenschaft
das letzte u. einzige Wort hätte.
(Noch ein Gegensatz:
„Autonomie“ der Pädagogik und Anpassung
an „gesellschaftliche“ Notwendigikeiten und
Bedürfnisse |