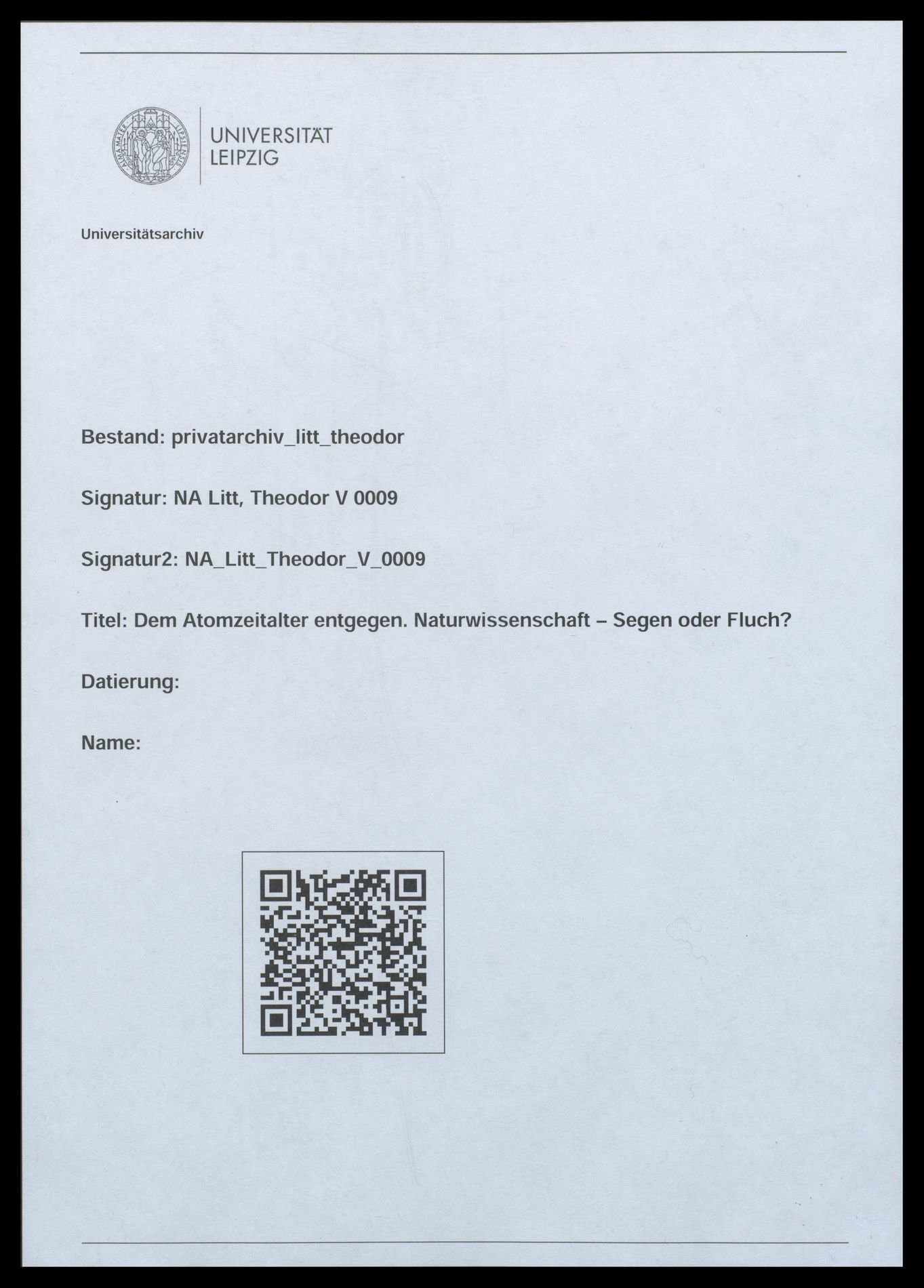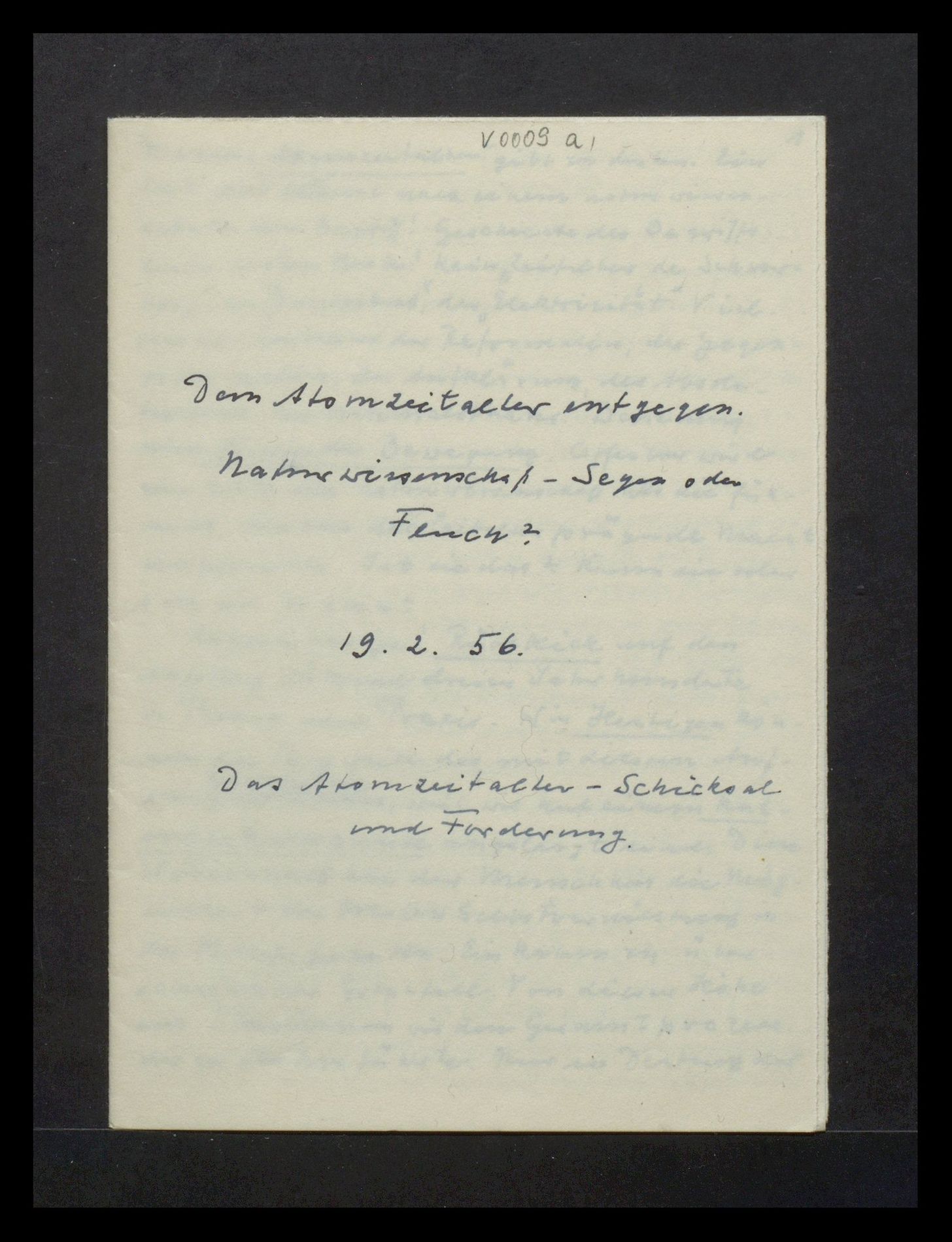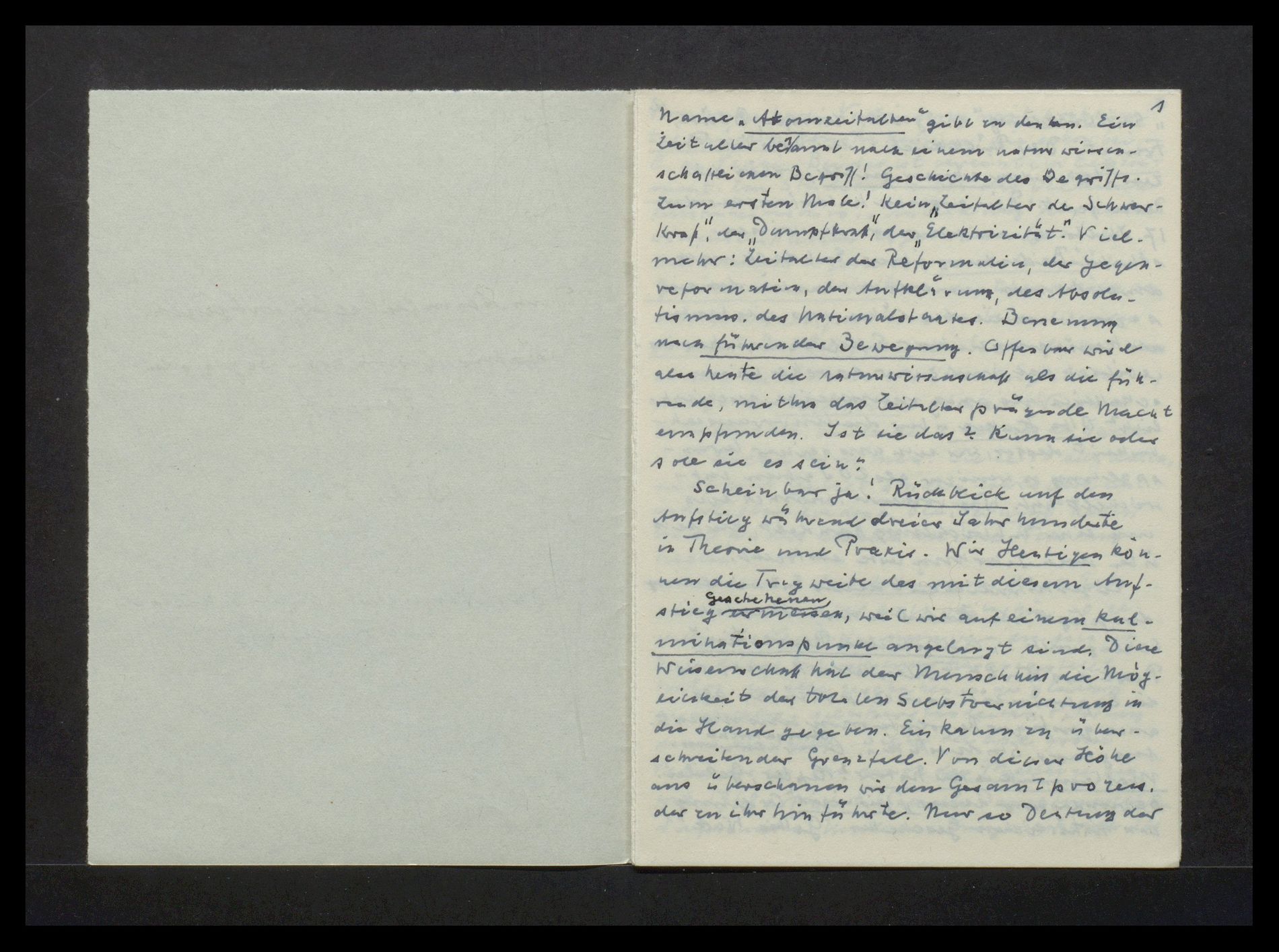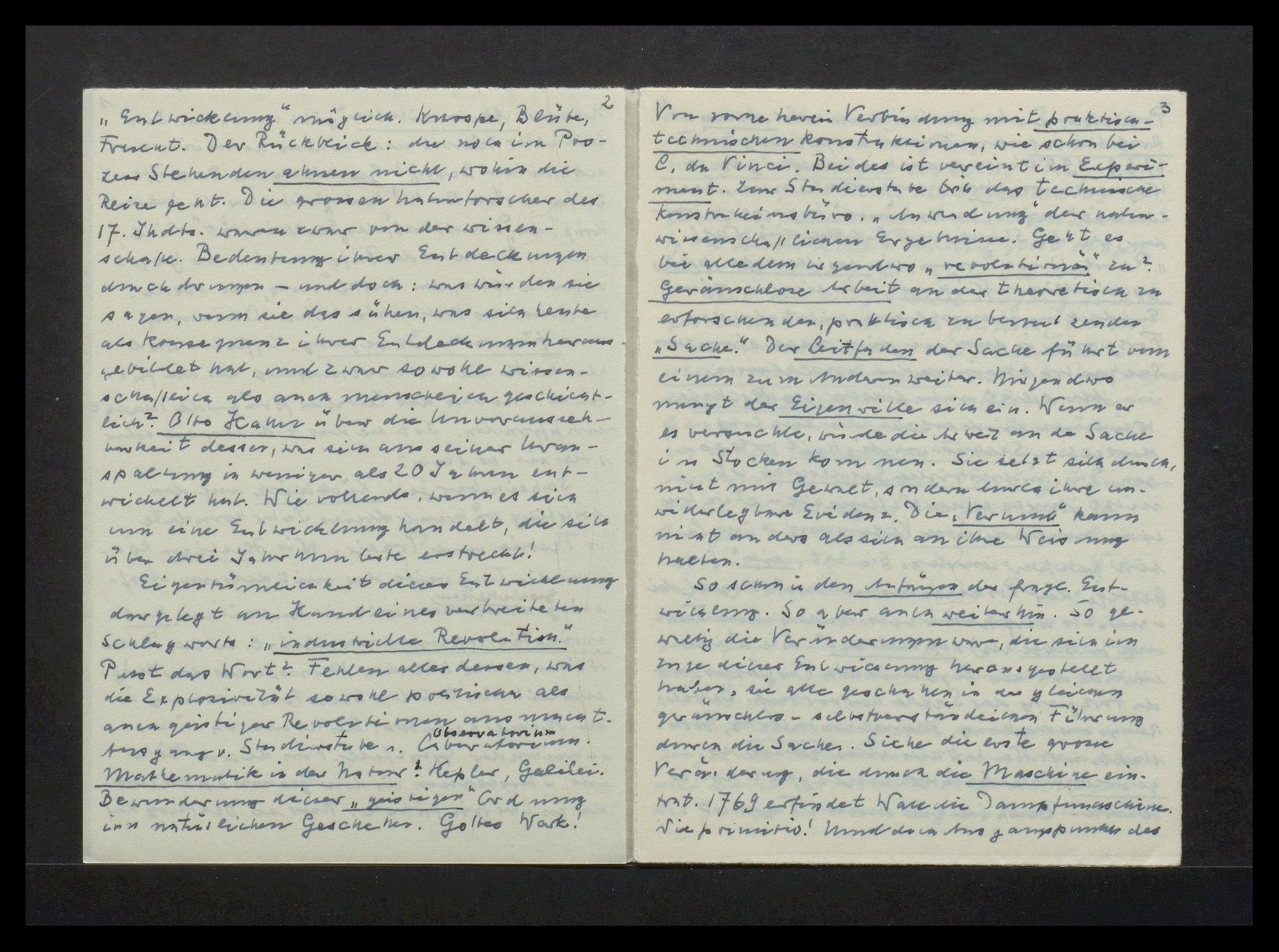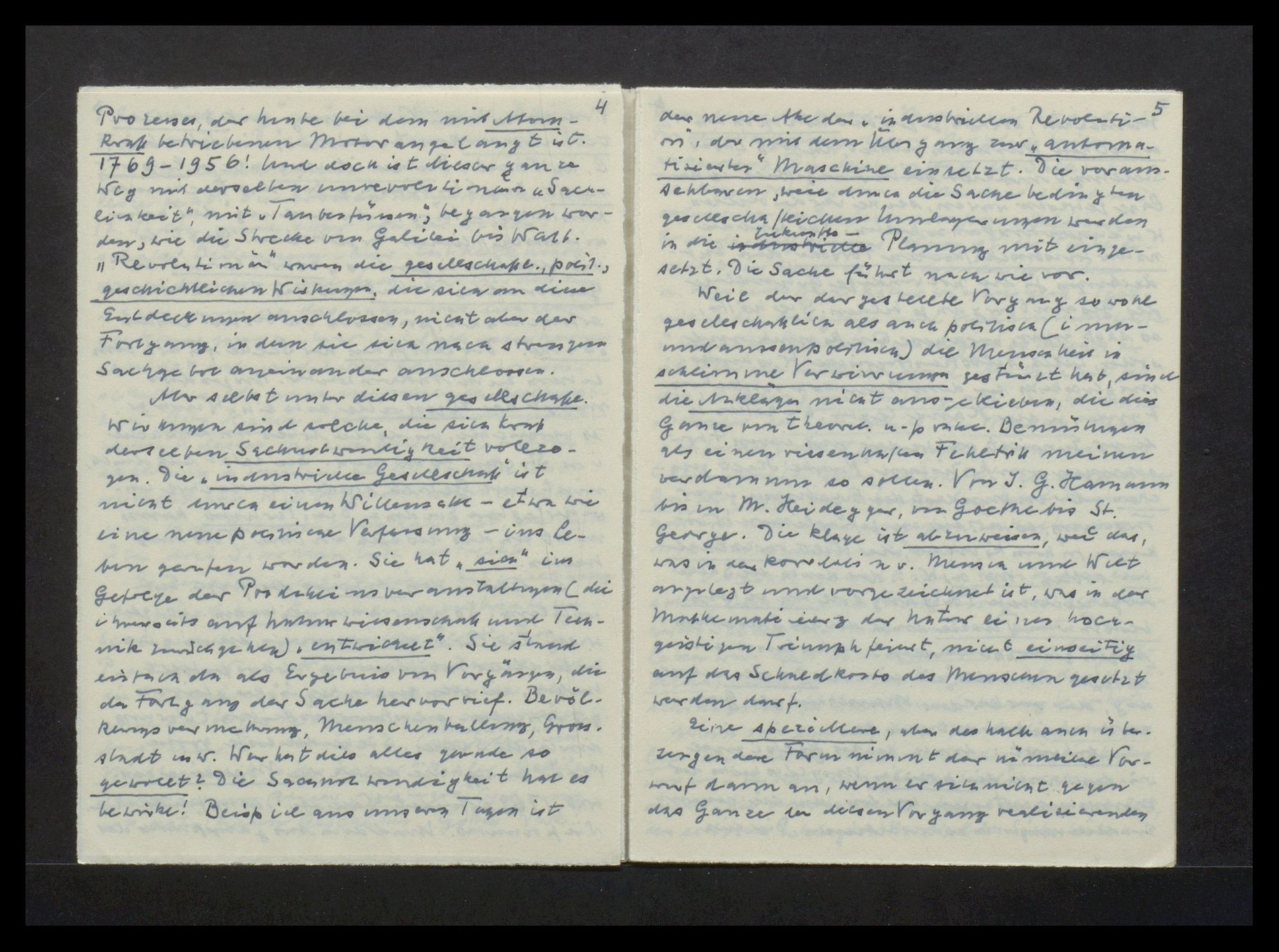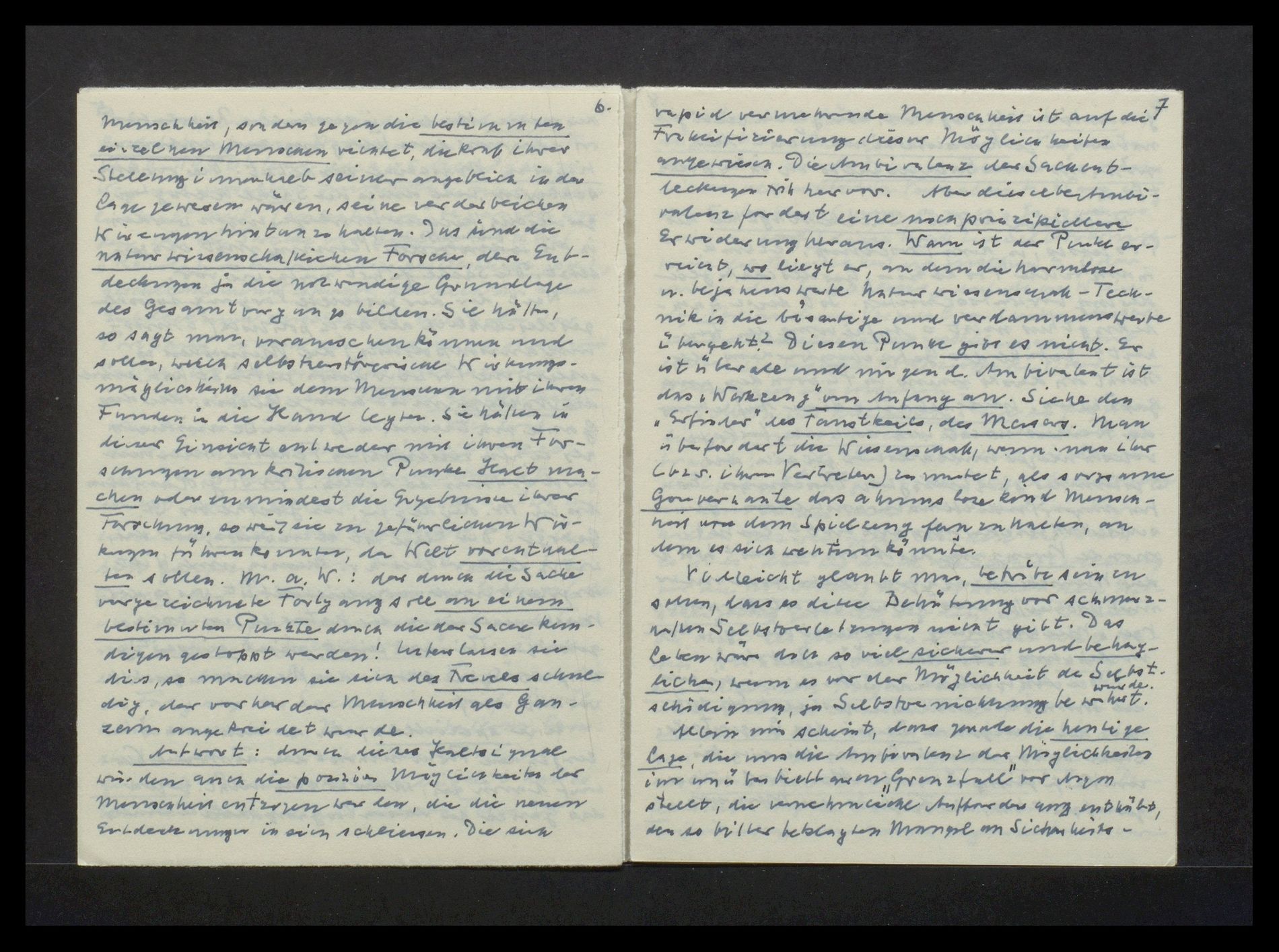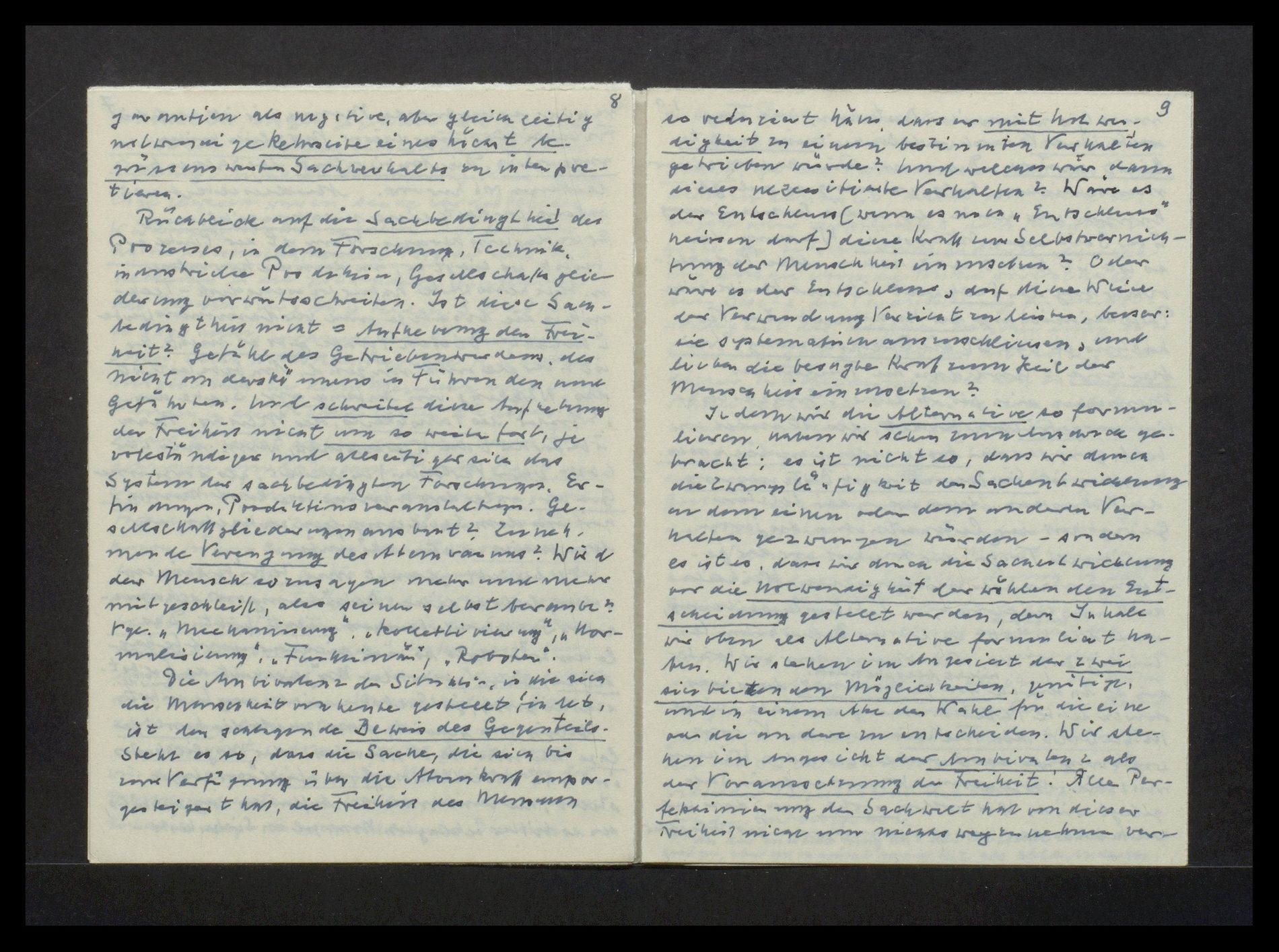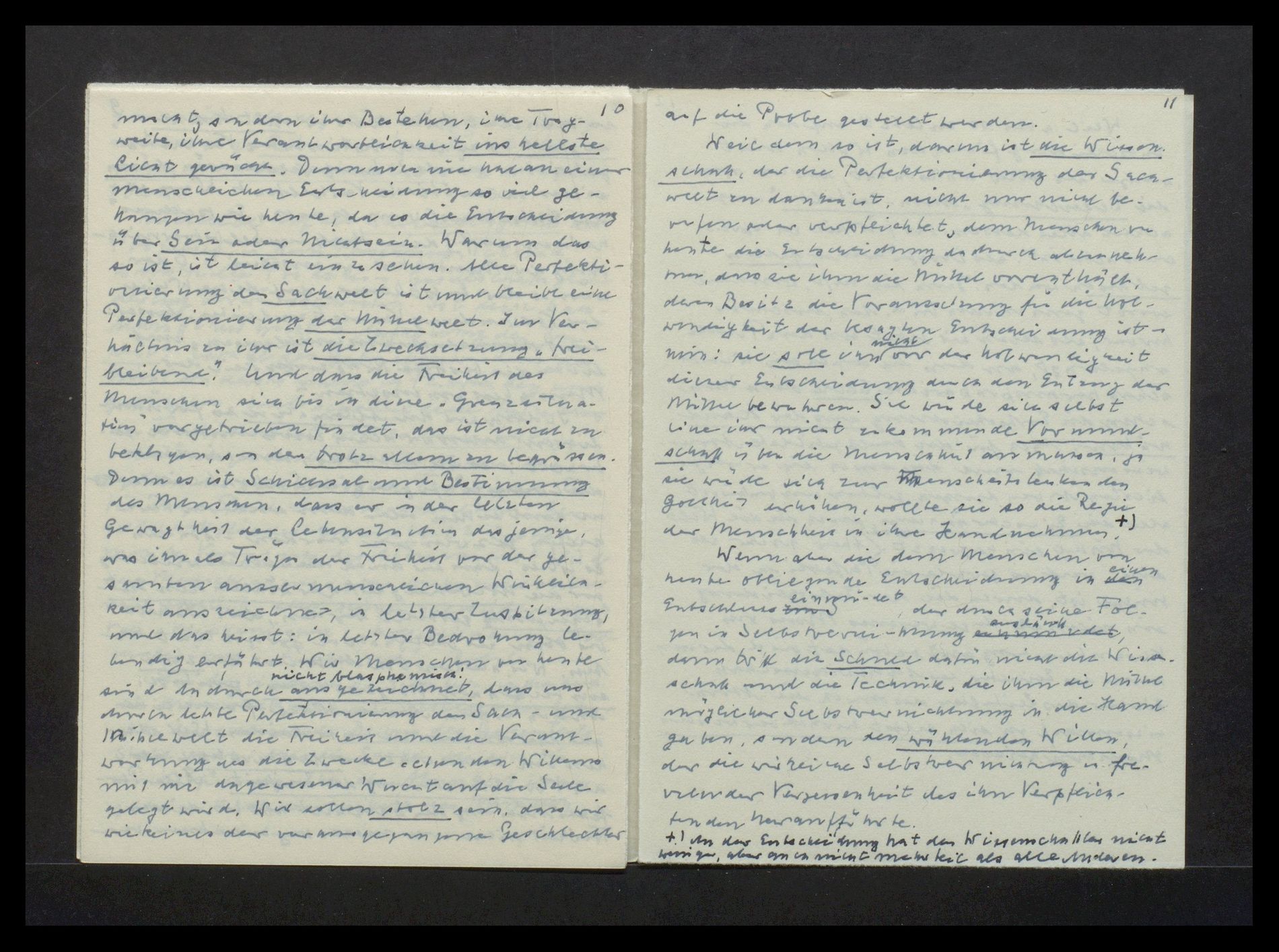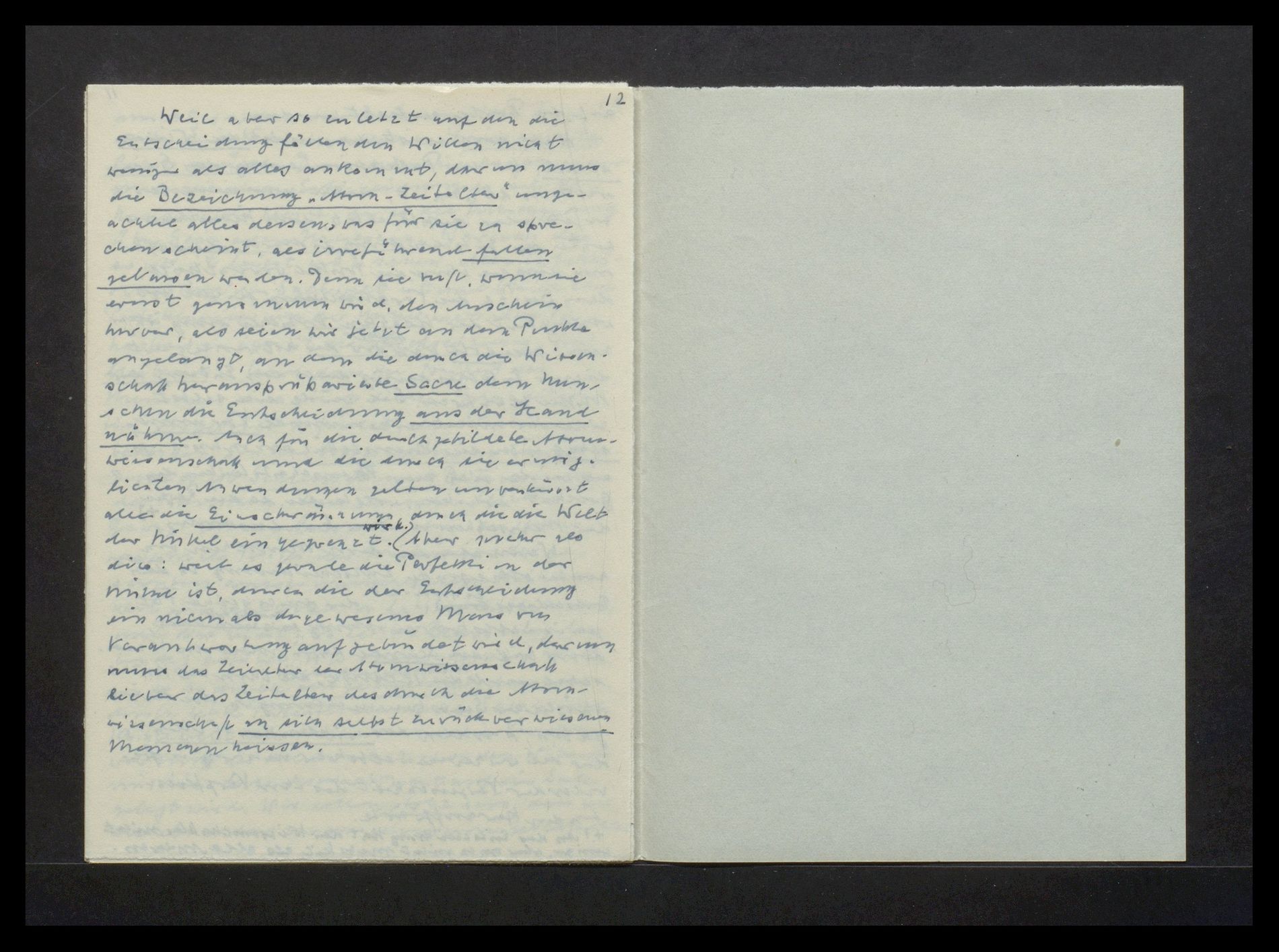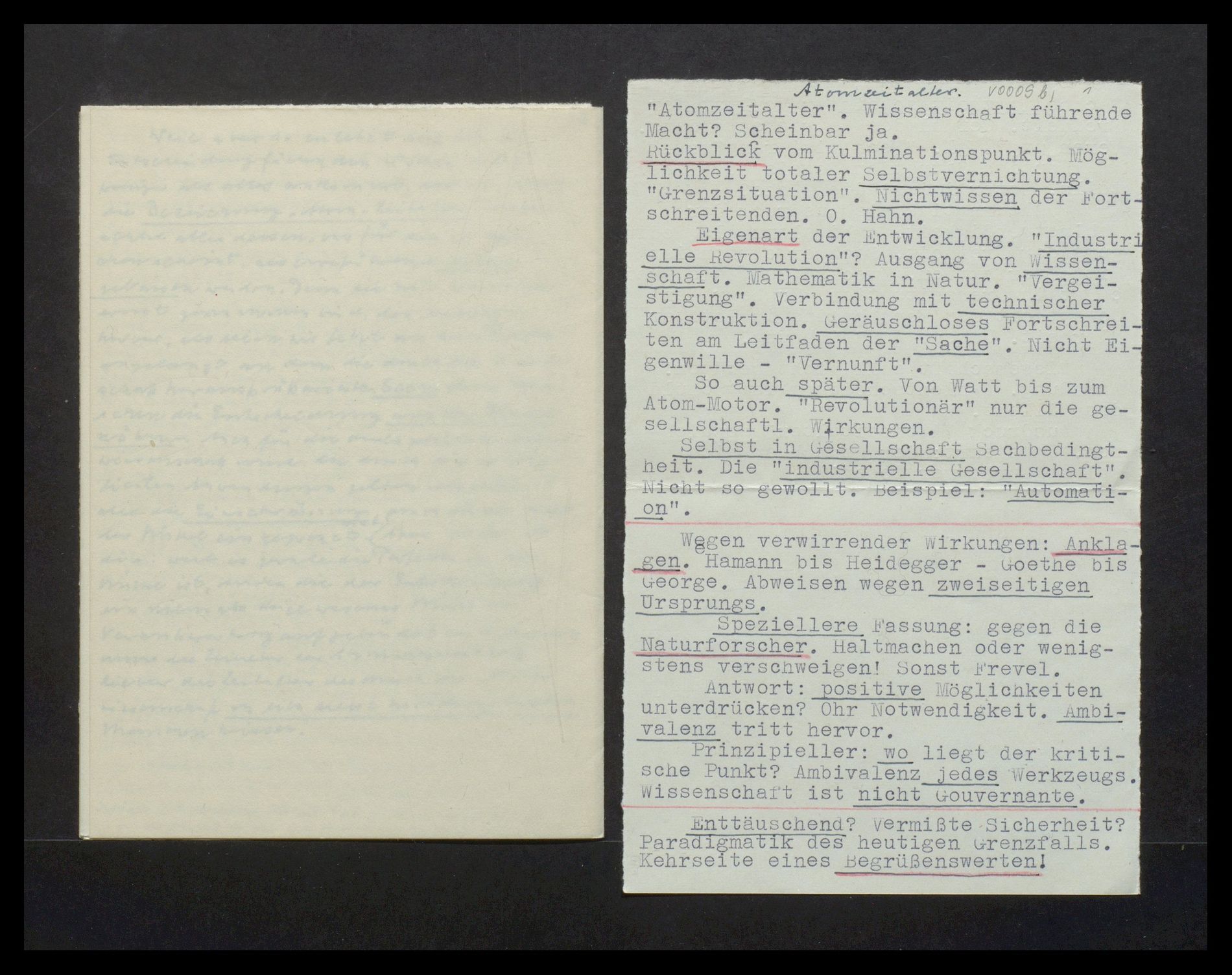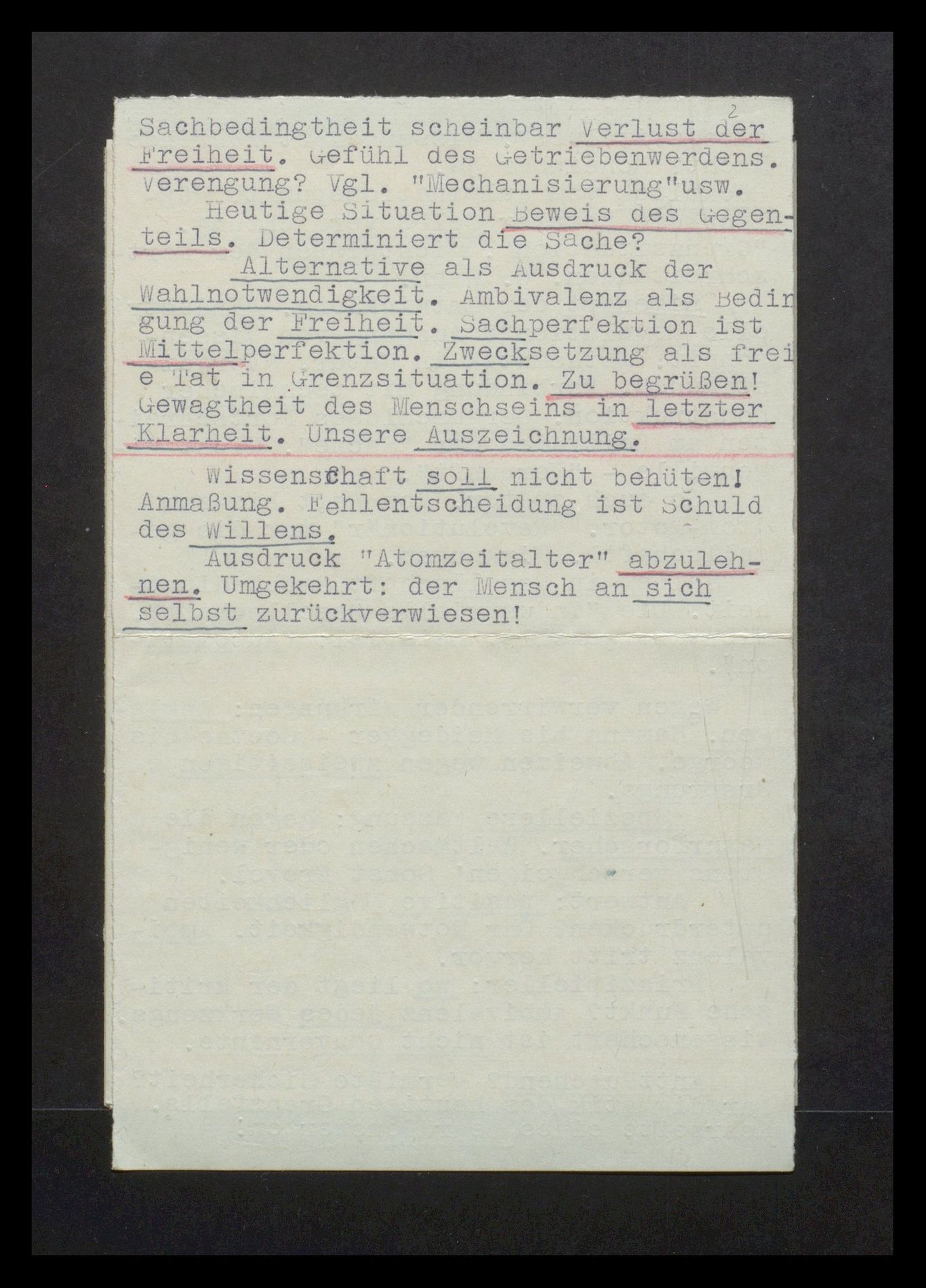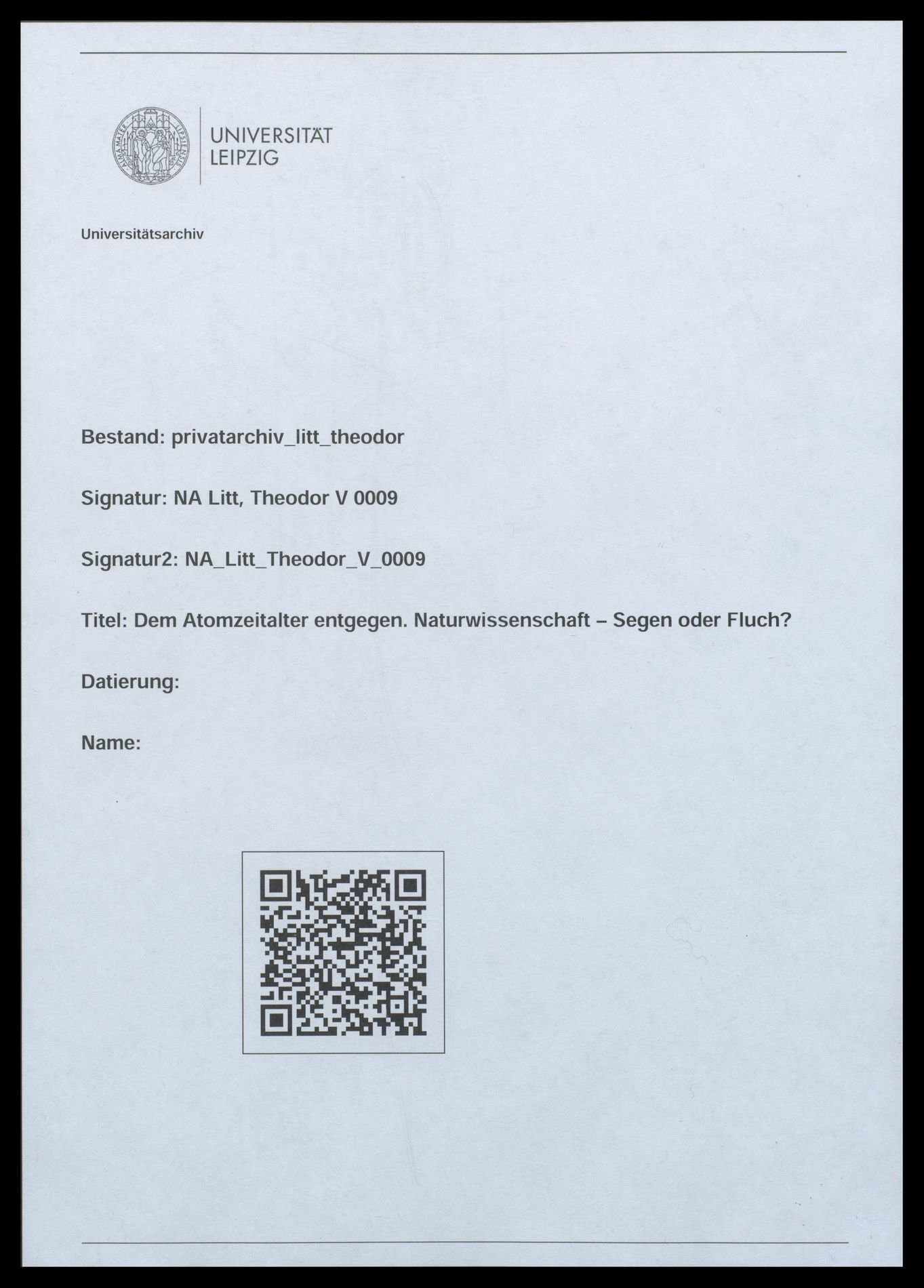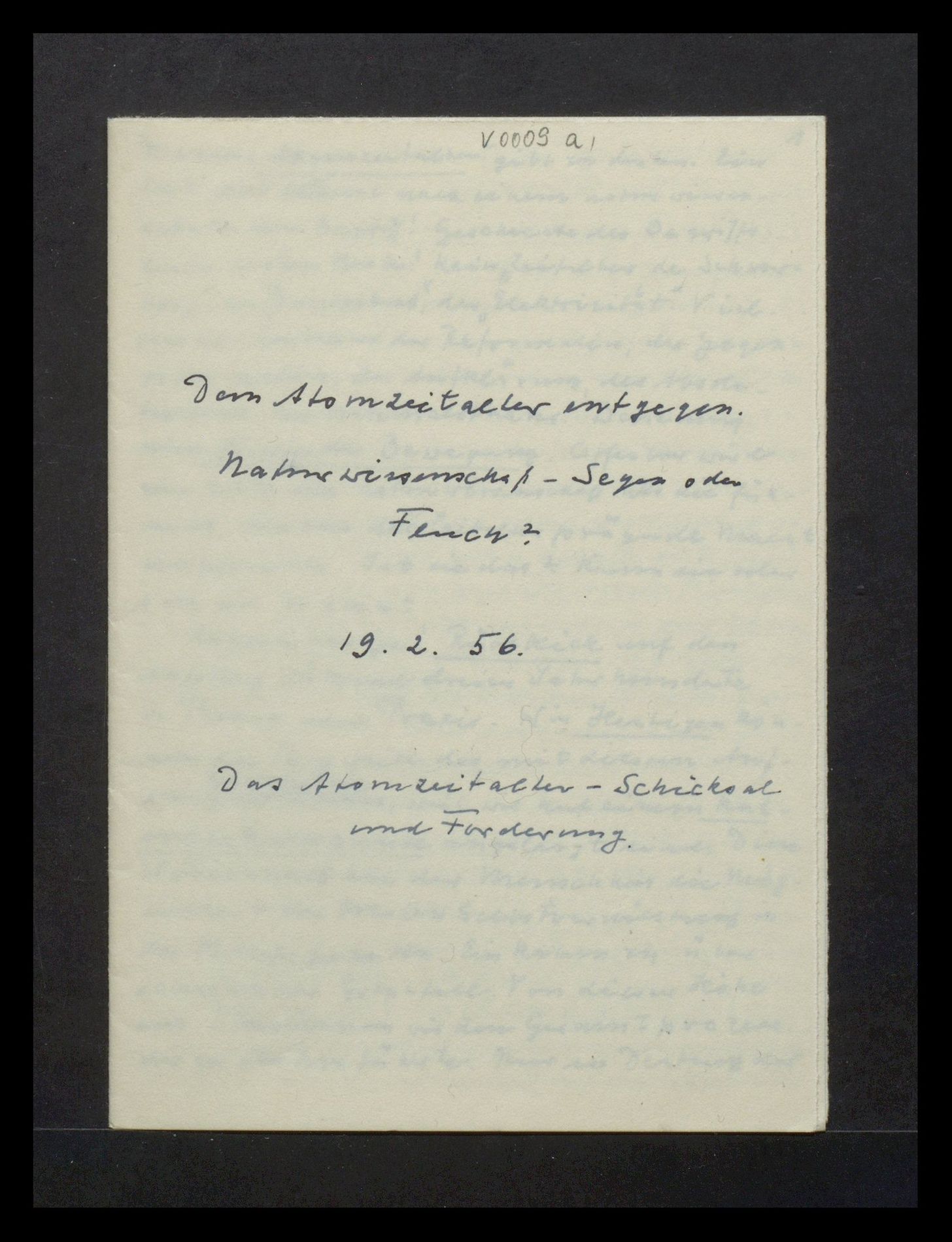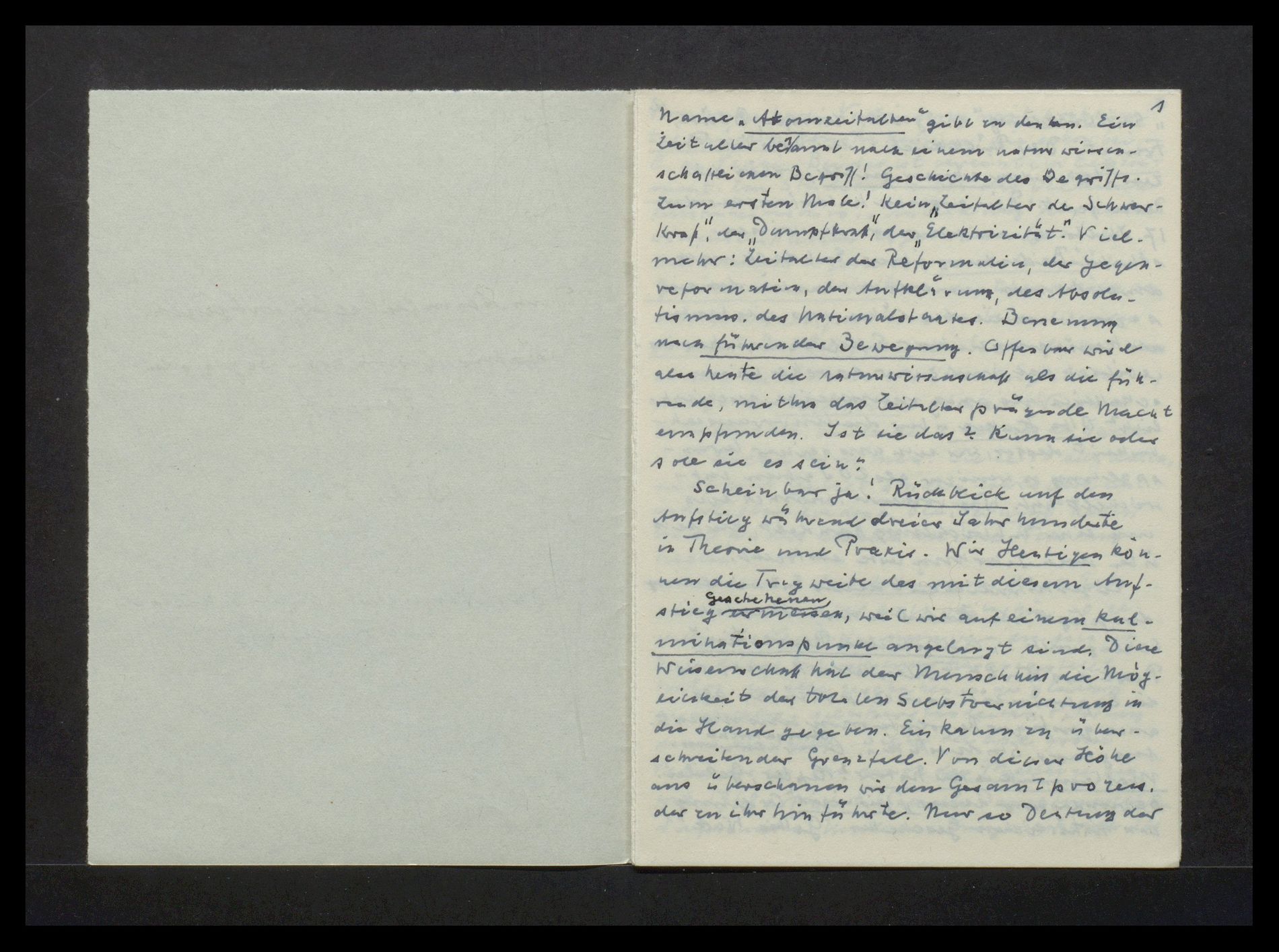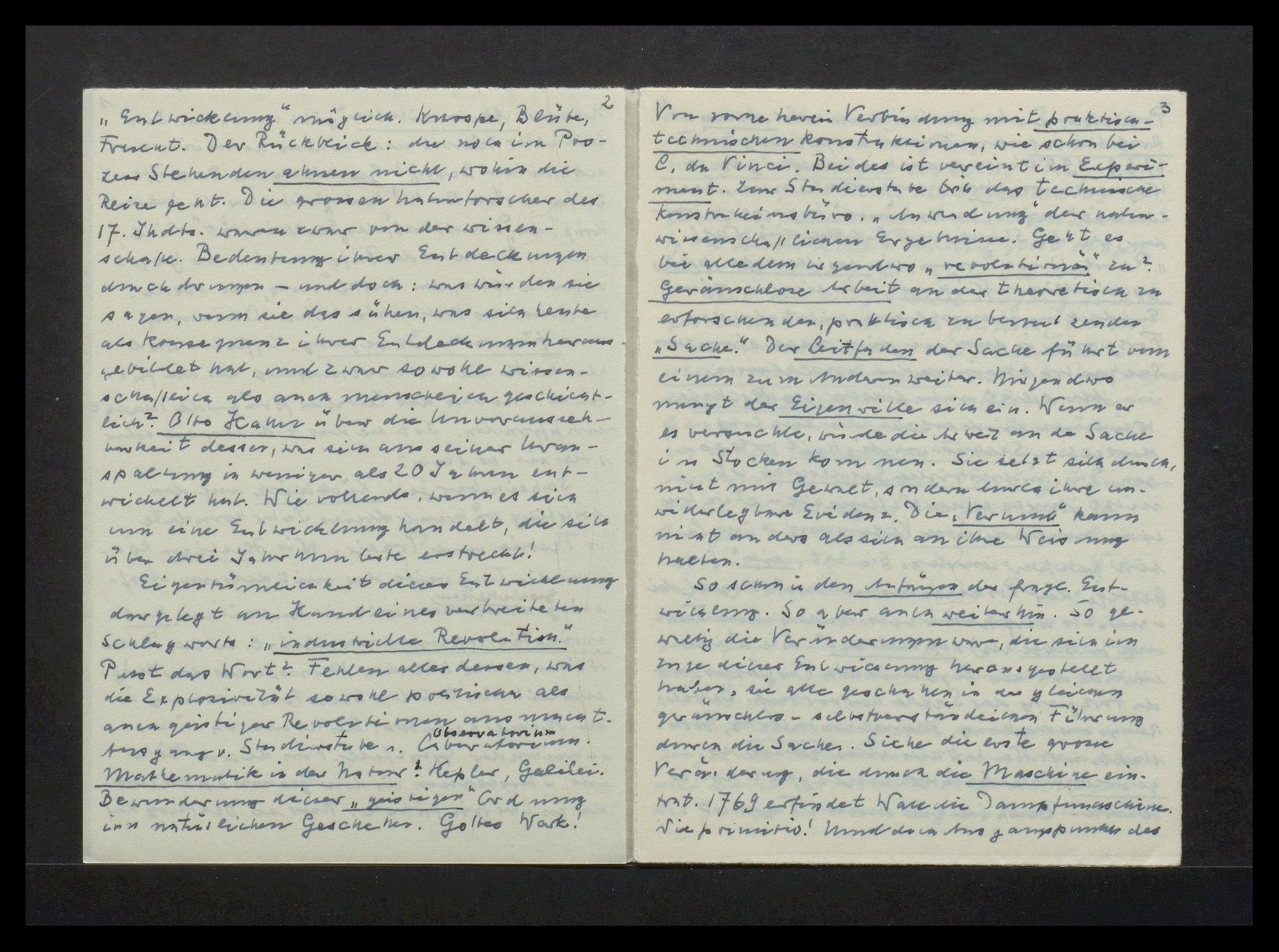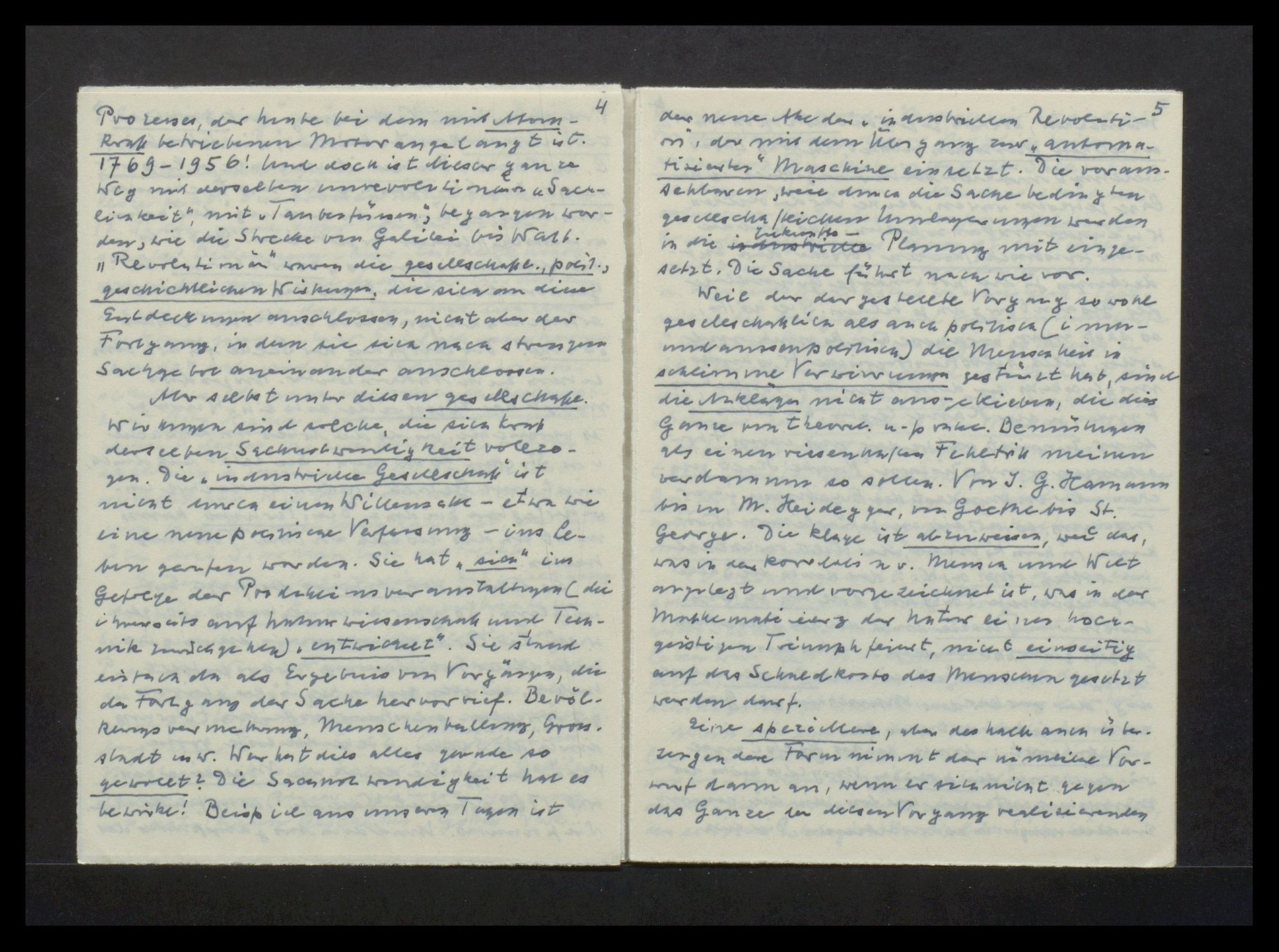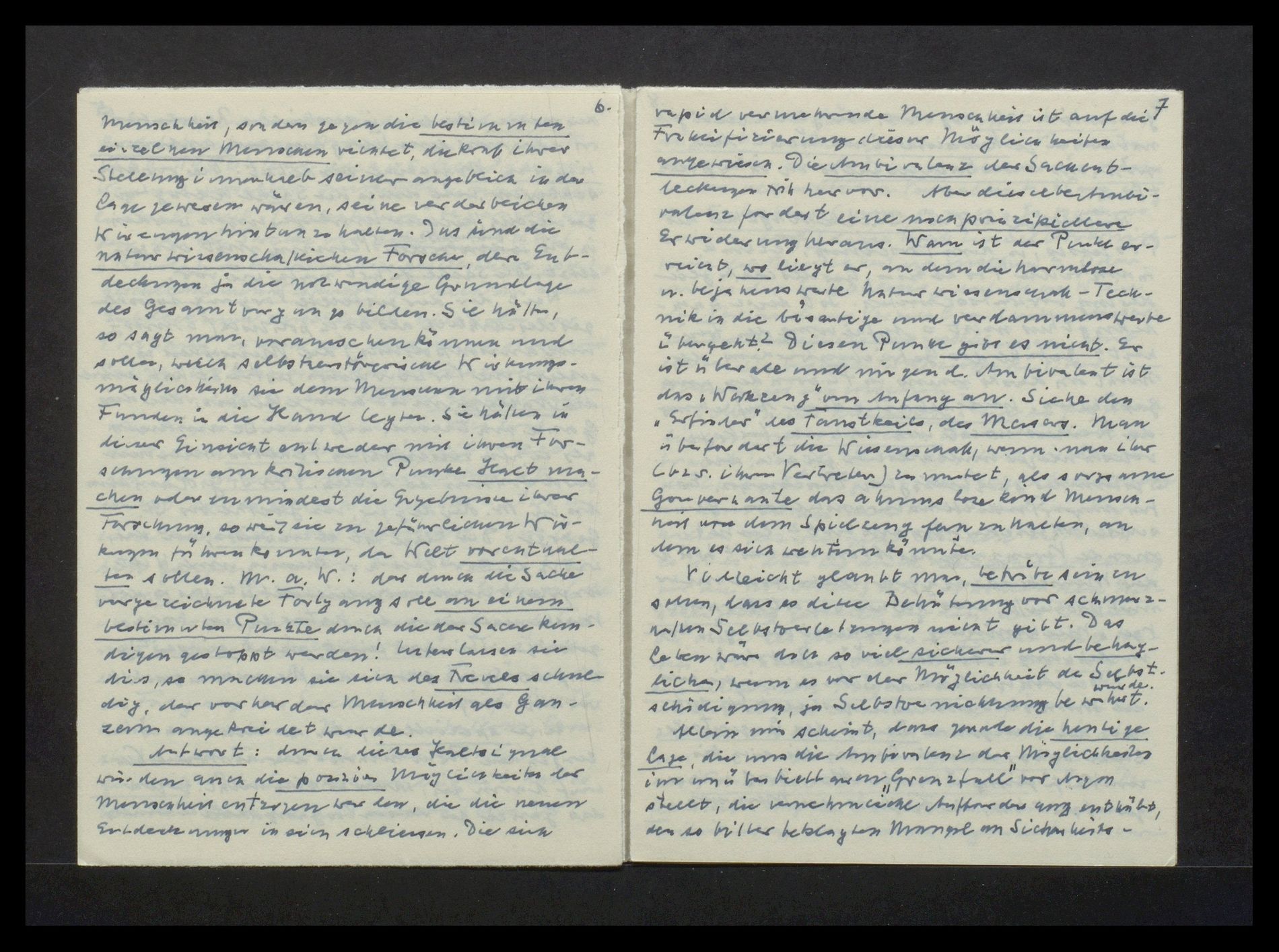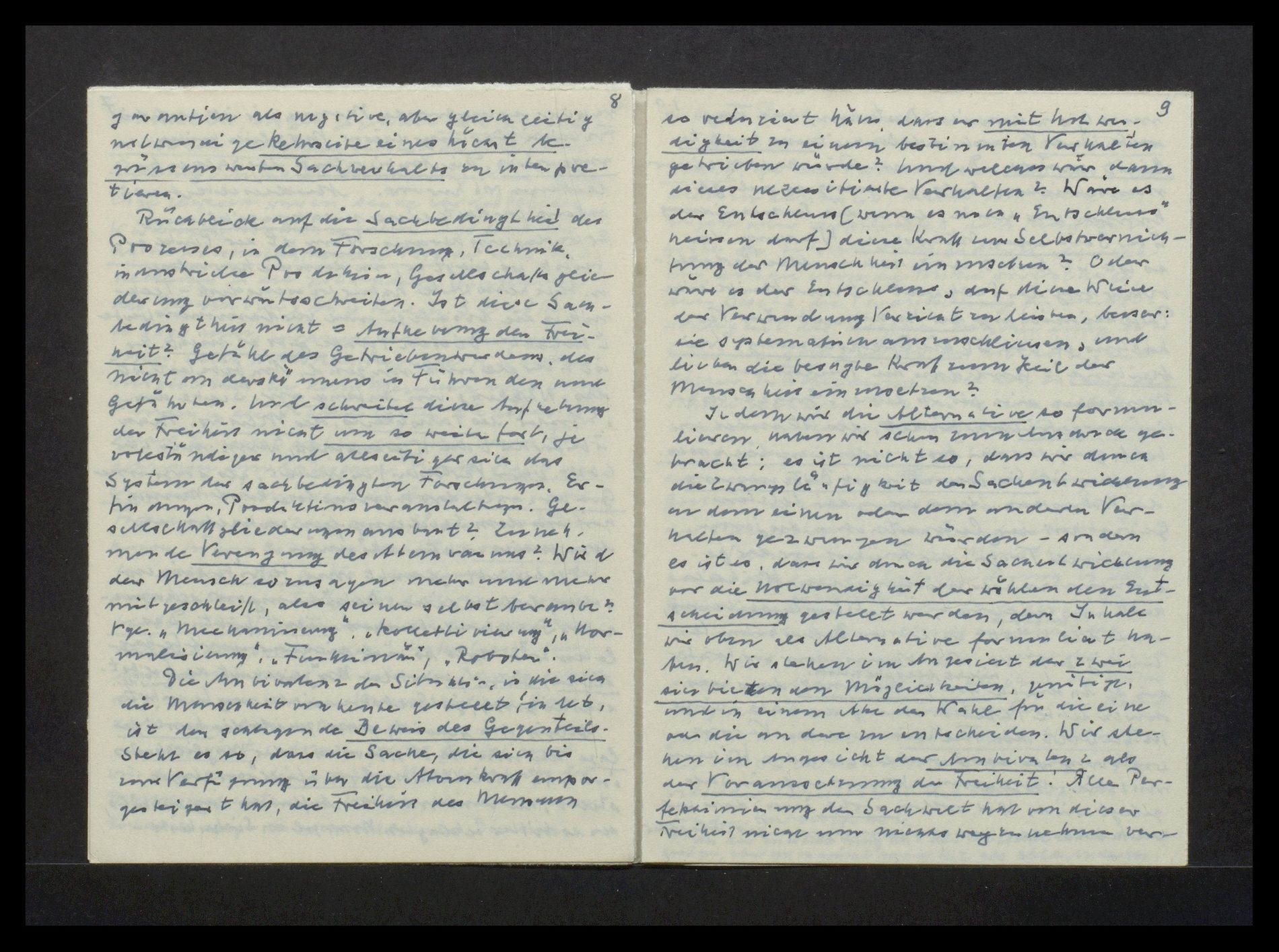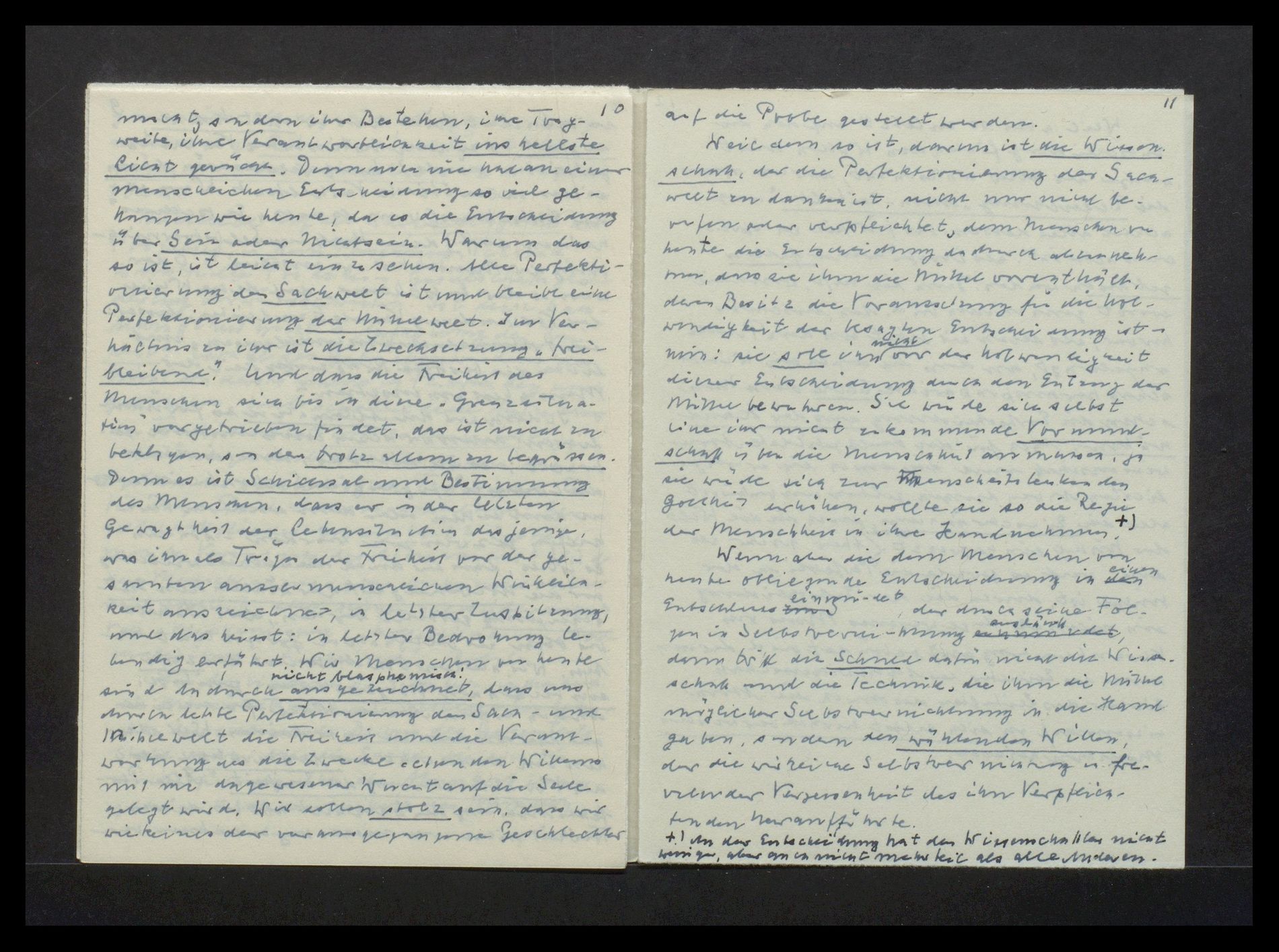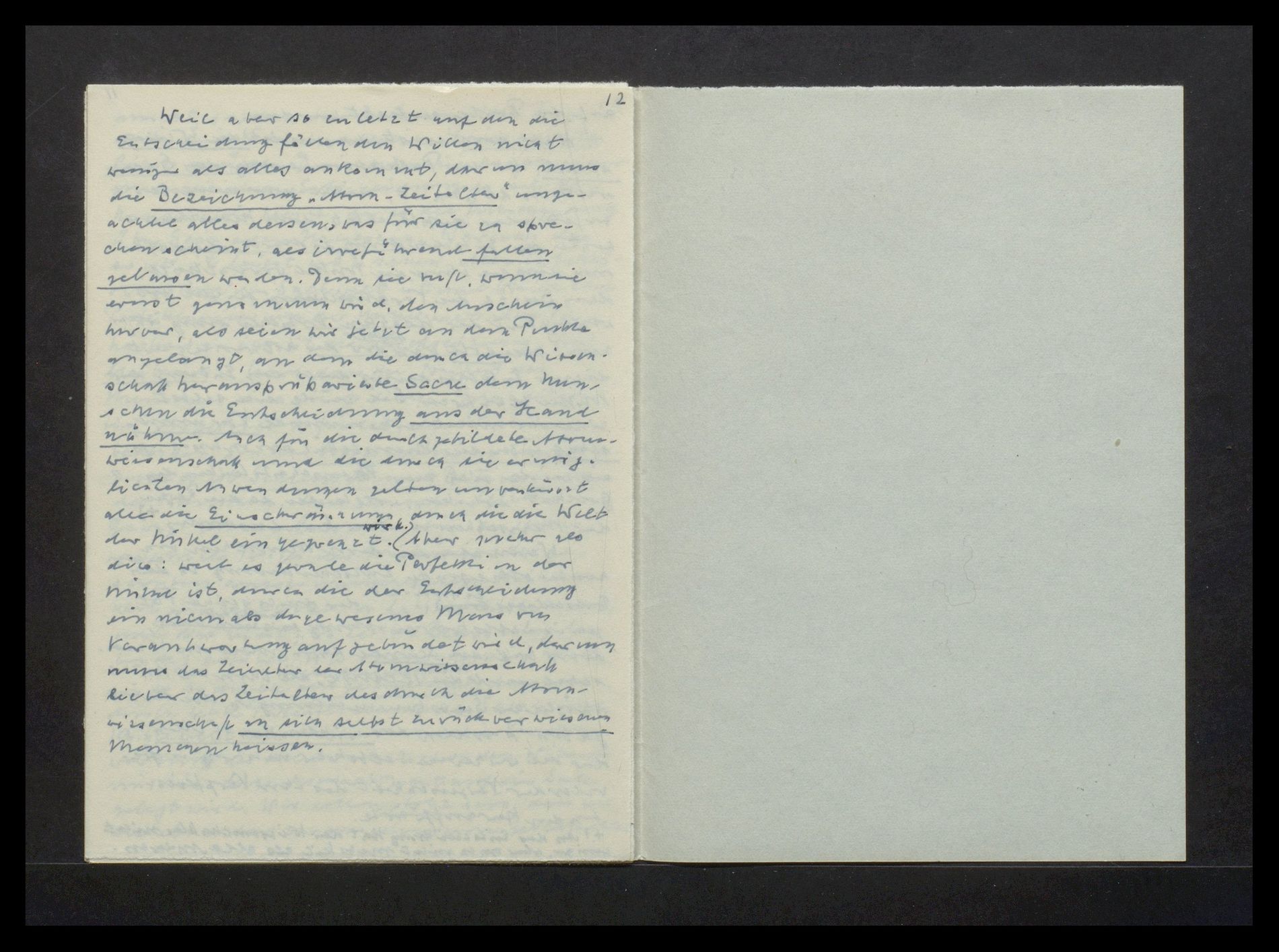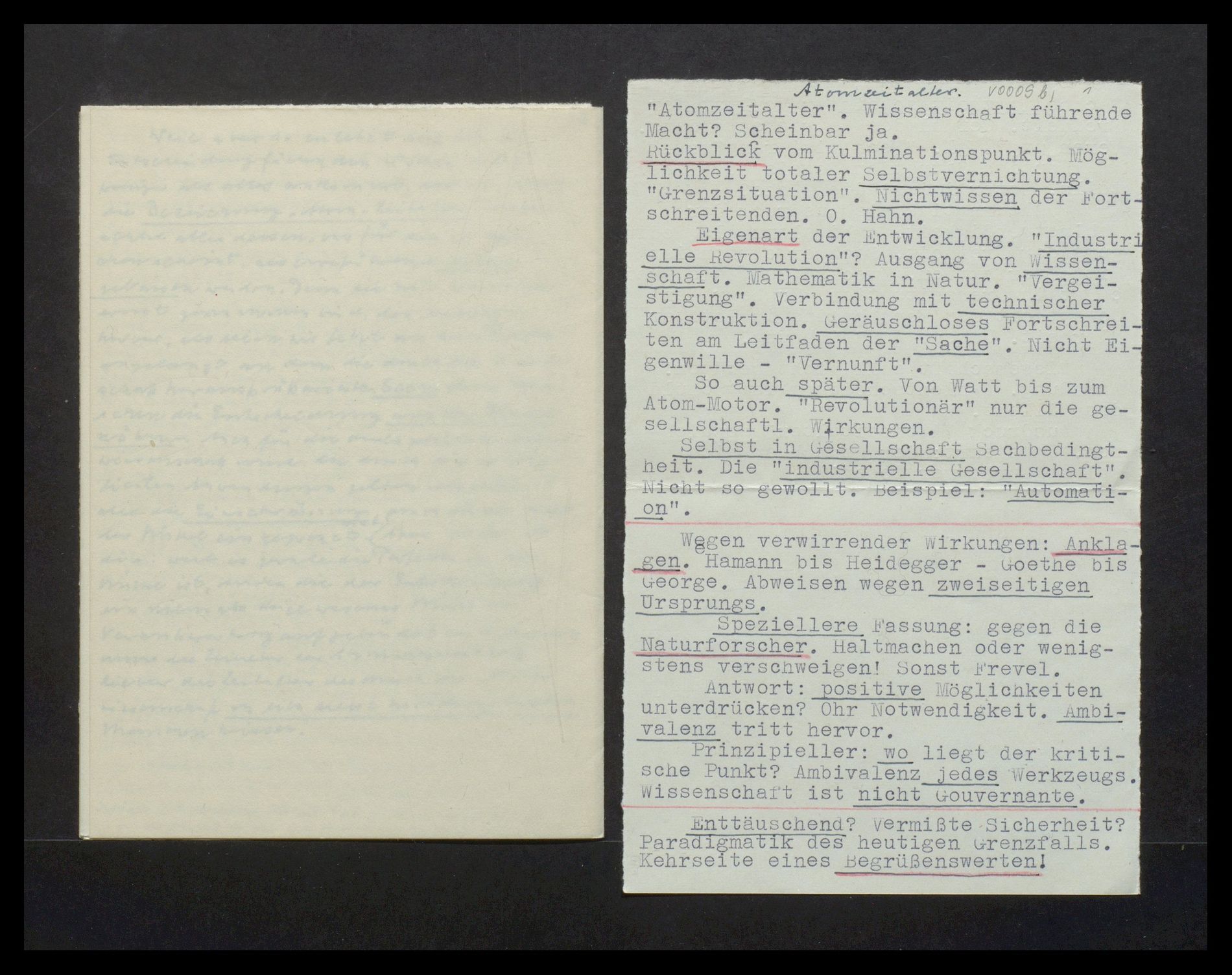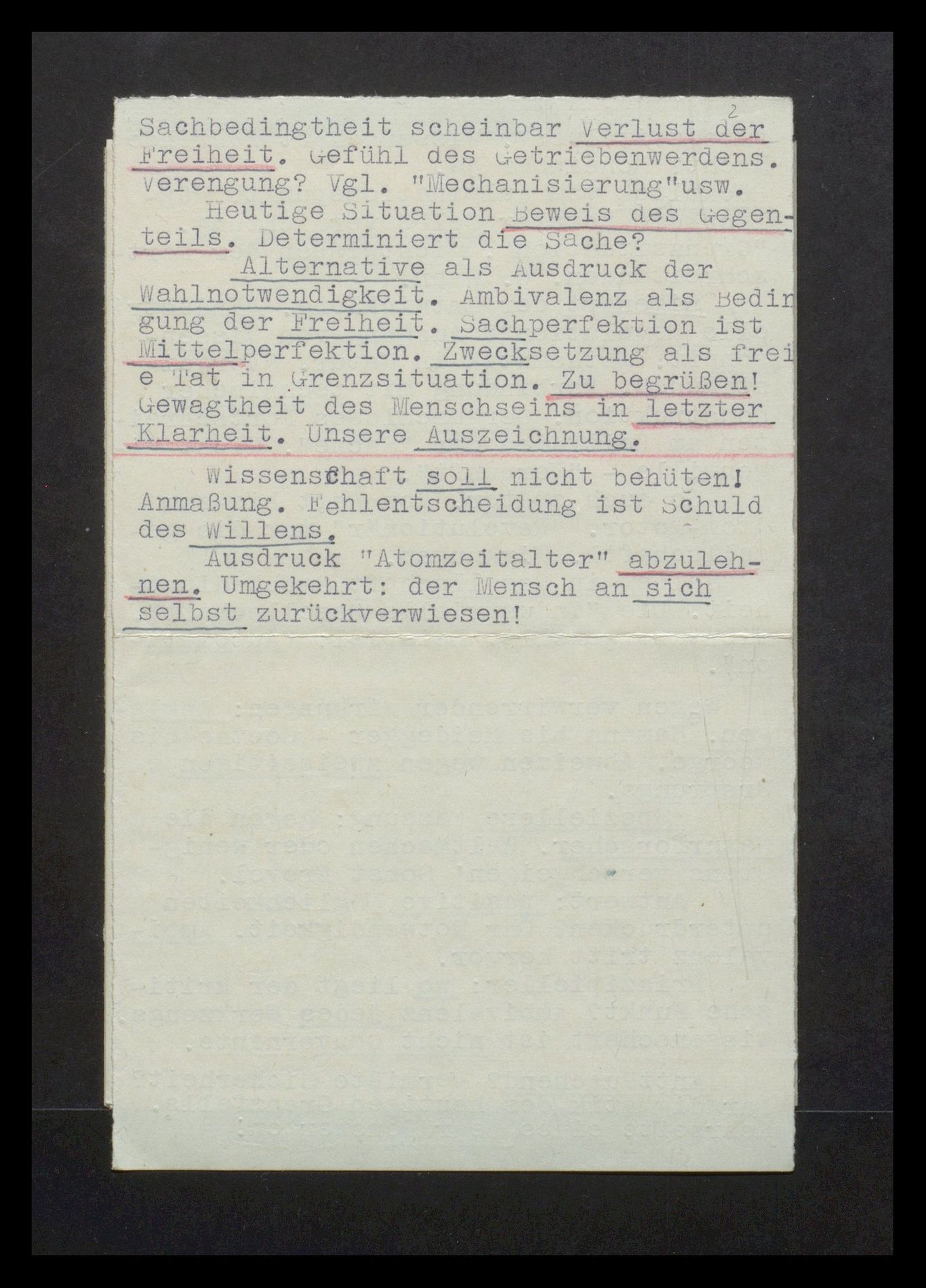| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0009 a
19.2.1956
Titelblatt
Dem Atomzeitalter entgegen. Naturwissenschaft – Segen oder Fluch?
19.2.56
Das Atomzeitalter – Schicksal und Forderung.
1
Name „Atomzeitalter“ gibt zu denken. Ein
Zeitalter benannt nach einem naturwissen-
schaftlichen Begriff! Geschichte des Begriffs.
Zum ersten Male! Kein „Zeitalter der Schwer-
kraft“, der „Dampfkraft“, der „Elektrizität“. Viel-
mehr: Zeitalter der Reformation, der Gegen-
reformation, der Aufklärung, des Absolu-
tismus, des Nationalstaates. Benennung
nach führender Bewegung. Offenbar wird
aber heute die Naturwissenschaft als die füh-
rende, mithin das Zeitalter prägende Macht
empfunden. Ist sie das? Kann sie oder
soll sie es sein?
Scheinbar ja! Rückblick auf den
Aufstieg während dreier Jahrhunderte
in Theorie und Praxis. Wir Heutigen kön-
nen die Tragweite des mit diesem Auf-
/ Geschehenen
stieg ermessen, weil wir auf einem Kul-
minationspunkt angelangt sind. Diese
Wissenschaft hat der Menschheit die Mög-
lichkeit der totalen Selbstvernichtung in
die Hand gegeben. Ein kaum zu über-
schreitender Grenzfall. Von dieser Höhe
aus überschauen wir den Gesamtprozess,
der zu ihr hinführt. Nur so Deutung der
2
„Entwicklung“ möglich. Knospe, Blüte,
Frucht. Der Rückblick: die noch im Pro-
zess Stehenden ahnen nicht, wohin die
Reise geht. Die grossen Naturforscher des
17. Jhdts. waren zwar von der wissen-
schaftl. Bedeutung ihrer Entdeckungen
durchdrungen – und doch: was würden sie
sagen, wenn sie das sähen, was sich heute
als Konsequenz ihrer Entdeckungen heraus-
gebildet hat, und zwar sowohl wissen-
schaftlich als auch menschlich geschicht-
lich? Otto Hahn über die Unvorausseh-
barkeit dessen, was sich aus seiner Uran-
spaltung in weniger als 20 Jahren ent-
wickelt hat. Wie vollends, wenn es sich
um eine Entwicklung handelt, die sich
über drei Jahrhunderte erstreckt!
Eigentümlichkeit dieser Entwicklung
dargelegt an Hand eines verbreiteten
Schlagworts: „industrielle Revolution.“
Passt das Wort? Fehlen alles dessen, was
die Explosivität sowohl politisch als
auch geistiger Revolutionen ausmacht.
Observatorium
Ausgang v. Studierstube s. Observatorium.
Mathematik in der Natur ? Kepler, Galilei.
Bewunderung dieser „geistigen“ Ordnung
natürlichen Geschehen. Gottes Werk!
3
Von vorne herein Verbindung mit praktisch-
technischen Konstruktionen, wie schon bei
L. da Vinci. Beides ist vereint im Experi-
ment. Zur Studierstube tritt das technische
Konstruktionsbüro. „Anwendung“ der natur-
wissenschaftlichen Ergebnisse. Geht es
bei alledem irgendwo „revolutionär“ zu?
Geräuschlose Arbeit an der theoretisch zu
erforschenden, praktisch zu benutzenden
„Sache“. Der Leitfaden der Sache führt vom
einem zum Anderen weiter. Nirgendwo
der Eigenwille sich ein. Wenn er
es versuchte, würde die Arbeit an der Sache
ins Stocken kommen. Sie setzt sich durch,
nicht mit Gewalt, sondern ihre un-
widerlegbare Evidenz. Die „Vernunft“ kann
nicht anders als sich an ihre Weisung
halten.
So in den Anfängen der fragl. Ent-
wicklung. So aber auch weiterhin. So ge-
waltig die Veränderungen waren, die sich im
Zuge dieser Entwicklung herausgestellt
haben, sie alle geschehen in der gleichen
geräuschlos – selbstverständlichen Führung
durch die Sachen. Siehe die erste grosse
Veränderung, die durch die Maschine ein-
trat. 1769 erfindet Watt die Dampfmaschine.
Die primitiv! Und doch Ausgangspunkt des
4
Prozesses, der heute bei dem mit Atom-
kraft betriebenen Motor angelangt ist.
1769 – 1956! Und doch ist dieser ganze
Weg mit derselben unrevolutionären „Sach-
lichkeit“, mit „Taubenfüssen“, begangen wor-
den, wie die Strecke von Galilei bis Watt.
„Revolutionär“ waren die gesellschaftl. polit.,
geschichtlichen Wirkungen, die sich an diese
Entdeckungen anschlossen, nicht aber der
Fortgang, in dem sie sich nach strengen
Sachgebot aneinander anschlossen.
Aber selbst unter diesen gesellschaftl.
Wirkungen sind solche, die sich kraft
derselben Sachnotwendigkeit vollzo-
gen. Die „industrielle Gesellschaft“ ist
nicht durch einen Willensakt – etwa wie
eine neue politische Verfassung – ins Le-
ben gerufen worden. Sie hat „sich“ im
Gefolge der Produktionsveranstaltungen (die
ihrerseits auf Naturwissenschaft und Tech-
nik zurückgehen) „entwickelt“. Sie stand
einfach da als Ergebnis von Vorgängen, die
der Fortgang der Sache hervorrief. Bevöl-
kerungsvermehrung, Menschenballung, Gross-
stadt usw. Wer hat dies alles gerade so
gewollt? Die Sachnotwendigkeit hat es
bewirkt! Beispiel aus unseren Tagen ist
5
der neue Akt der „industriellen Revoluti-
on“, der mit dem Übergang zur „automa-
tisierten“ Maschine einsetzt. Die voraus-
sehbaren, weil durch die Sache bedingten
gesellschaftlichen Umlagerungen werden
Zukunfts-
in die industrielle Planung mit einge-
setzt. Die Sache führt nach wie vor.
Weil der dargestellte Vorgang sowohl
gesellschaftlich als auch politisch (innen-
und aussenpolitisch) die Menschheit in
schlimme Verwirrungen gestürzt hat, sind
die Ankläger nicht aus-geblieben, die dies
Ganzevon theoret. u. prakt. Bemühungen
als einen riesenhaften Fehltritt meinen
verdammen so sollen. Von I. G. Hamann
bis zu M. Heidegger, von Goethe bis St.
George. Die Klage ist abzuweisen, weil das,
was in der v. Mensch und Welt
angelegt und vorgezeichnet ist, was in der
Mathematisierg der Natur einen hoch-
geistigen Triumph feiert, nicht einseitig
auf das Schuldkonto des Menschen gesetzt
werden darf.
Eine speziellere, aber deshalb auch über-
zeugendere Form nimmt der nämliche Vor-
wurf dann an, wenn er sich nicht gegen
das Ganze der diesen Vorgang realisierenden
6
Menschheit, sondern gegen die bestimmten
einzelnen Menschen richtet, die Kraft ihrer
Stellung innerhalb seiner angeblich in der
Lage gewesen wären, seine verderblichen
Wirkungen hintan zu halten. Das sind die
naturwissenschaftlichen Forscher, deren Ent-
deckungen ja die notwendige Grundlage
des Gesamtvorgangs bilden. Sie hätten,
so sagt man, voraussehen können und
sollen, welche selbstzerstörerische Wirkungs-
möglichkeiten sie dem Menschen mit ihren
Funden in die Hand legten. Sie hätten in
dieser Einsicht entweder mit ihren For-
schungen am kritischen Punkt Halt ma-
chen oder zumindest die Ergebnisse ihrer
Forschung, so weit sie zu gefährlichen Wir-
kungen führen konnten, der Welt vorenthal-
ten sollen. M. a. W.: der durch die Sache
vorgezeichnete Fortgang soll an einem
bestimmten Punkte durch die der Sache
kundigen gestoppt werden! Unterlassen sie
dies, so machen sie sich des Frevels schul-
dig, der vorher der Menschheit als Gan-
zem angekreidet wurde.
Antwort: durch dieses Haltesignal
würden auch die positiven Möglichkeiten der
Menschheit entzogen werden, die die neuen
Entdeckungen in sich schliessen. Die sich
7
rapid vermehrende Menschheit ist auf die
dieser Möglichkeiten
angewiesen. Die Ambivalenz der Sachent-
deckung tritt hervor. Aber dieselbe Ambi-
valenz fordert eine noch prinzipeller
Erwiderung heraus. Wann ist der Punkt er-
reicht, wo liegt er, an dem die harmlose
u. bejahenswerte Naturwissenschaft – Tech-
nik in die bösartige und verdammenswerte
übergeht? Diesen Punkt gibt es nicht. Er
ist überall und nirgend. Ambivalent ist
das „Werkzeug“ von Anfang an. Siehe den
„Erfinder“ des Faustkeils, des Messers. Man
überfordert die Wissenschaft, wenn man ihr
(bzw. ihren Vertretern) zumutet, als sogenannte
Gouvernante das ahnungslose Kind Mensch-
heit vor dem Spielzeug fernzuhalten, an
dem es sich wehtun könnte.
Vielleicht glaubt man, betrübt sein zu
sollen, dass es diese Behütung vor schmerz-
haften Selbstverletzungen nicht gibt. Das
Leben wäre doch so viel sicherer und behag-
licher, wenn es vor der Möglichkeit der Selbst-
schädigung, ja Selbstvernichtung bewahrt würde.
Allein mir scheint, dass gerade die heutige
Lage, die uns die Ambivalenz der Möglichkeiten
im unüberbietbaren „Grenzfall“ vor Augen
stellt, die vernehmliche Aufforderung enthält,
den so bitter beklagten Mangel an Sicherheits-
8
garantien als negative, aber gleichzeitig
notwendige Kehrseite höchst be-
grüssenswerter Sachverhalte zu interpre-
tieren.
Rückblick auf die Sachbedingtheit des
Prozesses, in dem Forschung, Technik,
industrielle Produktion, Gesellschaftsglie-
derung vorwärtsschreiten. Ist diese Sach-
bedingtheit nicht = Aufhebung der Frei-
heit? Gefühl des Getriebenwerdens, des
Nichtändernkönnens in Führenden und
Geführten. Und schreitet diese Aufhebung
der Freiheit nicht um so weiter fort, je
vollständiger und allseitiger sich das
System der sachbedingten Forschungen, Er-
findungen, Produktionsveranstaltungen. Ge-
sellschaftsgliederungen ausbaut? Zuneh-
nemende Verengung des Atems von uns? Wird
der Mensch sozusagen mehr und mehr
mitgeschleift, also seiner selbst beraubt?
Vgl. „Mechanisierung“, „Kollektivierung“, „Nor-
malisierung“, „Funktionäre“, „Roboter“.
Die Ambivalenz der Situation, in die sich
die Menschheit von heute gestellt findet,
ist der schlagende Beweis des Gegenteils.
Steht es so, dass die Sache, die sich bis
zur Verfügung über die Atomkraft empor-
gesteigert hat, die Freiheit des Menschen
9
so reduziert hätte, dass er mit Notwen-
digkeit zu einem bestimmten Verhalten
getrieben würde? Und welches wär dann
dieses Verhalten? Wäre es
der Entschluss (wenn es noch „Entschluss“
heissen darf) diese Kraft zur Selbstvernich-
tung der Menschheit einzusetzen? Oder
wäre es der Entschluss, auf diese Weise
der Verwendung Verzicht zu heissen, besser:
sie systematisch auszuschliessen, und
lieber die besagte Kraft zum Heil der
Menschheit einzusetzen?
Indem wir die Alternative so formu-
lieren, haben wir schon zum Ausdruck ge-
bracht: es ist nicht so, dass wir durch
die Zwangsläufigkeit der Sachentwicklung
zu dem einen oder dem anderen Ver-
halten gezwungen würden – sondern
es ist so, dass wir durch die Sachentwicklung
vor die Notwendigkeit der wählenden Ent-
scheidung gestellt werden, dem Inhalt
wie eben als Alternative formuliert ha-
ben. Wir stehen im Angesicht der zwei
sich bietenden Möglichkeiten, genötigt,
und in einem Akt der Wahl für die eine
oder die andere zu entscheiden. Wir ste-
hen im Angesicht der Ambivalenz als
der Voraussetzung der Freiheit! Alle Per
fektionierungen der Sachwelt hat von dieser
Freiheit nicht nur nichts wegzunehmen ver-
10
mocht, sondern ihr Bestehen, ihre Trag-
weite, ihre Verantwortlichkeit ins hellste
Licht gerückt. Dennoch nie hat an einer
menschlichen Entscheidung so viel ge-
hangen wie heute, da es die Entscheidung
über Sein oder Nichtsein. Warum das
so ist, ist leicht einzusehen. Alle Perfekti-
onierung der Sachwelt ist und bleibt eine
Perfektionierung der Mittelwelt. Im Ver-
hältnis zu ihr ist dieZwecksetzung „frei-
bleibend“! Und das die Freiheit des
Menschen sich bis in diese „Grenzsitua-
tion“ vorgetrieben findet, das ist nicht zu
beklagen, sondern trotzalledem zu begrüssen.
Denn es ist Schicksal und Bestimmung
des Menschen, dass er in der letzten
Gewagtheit der Lebenssituation dasjenige,
was ihm als Träger der Freiheit vor der ge-
samten aussermenschlichen Wirklich-
keit auszeichnet, in letzter Zuspitzung,
und das heisst: in letzter Bedrohung le-
bendig erfährt. Wir Menschen von heute
nicht blasphemisch!
sind dadurch ausgezeichnet, dass uns
<....> letzte Perfektionierung der Sach- und
<...welt> die Freiheit und die Verant-
wortung des die Zwecke setzenden Wirkens
mit nie dagewesener Wucht auf die Seele
gelegt wird. Wir sollen stolz sein, dass wir
wie keiner der vorangegangenen Geschlechter
11
auf die Probe gestellt werden.
Weil dem so ist, darum ist die Wissen-
schaft, der die Perfektionierung der Sach-
welt zu danken ist, nicht nur nicht be-
rufen oder verpflichtet, dem Menschen von
heute die Entscheidung dadurch abzuneh-
men, dass sie ihm die Mittel vorenthält,
deren Besitz die Voraussetzung für die Not-
wendigkeit der besagten Entscheidung ist –
wie: sie soll ihn nicht vor der Notwendigkeit
dieser Entscheidung durch den Entzug der
Mittel bewahren. Sie würde sich selbst
eine ihr nicht zukommende Vormund-
schaft über die Menschheit anmassen, ja
sie würde sich zur menschheitslenkenden
Gottheit erhöhen, wollte sie so die Regie
der Menschheit in ihre Hand nehmen. +)
Wenn aber die dem Menschen von
heute obliegende Entscheidung in einen
Entschluss einmündet, der durch seine Fol-
ausläuft
gen in Selbstverni-chtung einmündet,
dann tritt die Schuld dafür nicht die Wissen-
schaft und die Technik, die ihm die Mittel
möglicher Selbstvernichtung in die Hand
gaben, sondern den wählenden Willen,
der die wirkliche Selbstvernichtung in fre-
velnder Vergessenheit des ihn Verpflich-
tenden heraufführte.
+) An der Entscheidunghat der Wissenschaftler nicht
weniger, aber auch nicht mehr teil als alle Anderen.
12
Weil aber so zuletzt auf den die
Entscheidungfällenden Willen nicht
weniger als alles ankommt, darum muss
die Bezeichnung „Atom-Zeitalter“ unge-
achtet alles dessen, was für sie zu spre-
chen scheint, als irreführend fallen
gelassen werden. Denn sie ruft, wenn sie
ernst genommen wird, den Anschein
hervor, als seien wir jetzt an dem Punkte
angelangt, an dem die durch die Wissen-
schaft Sache dem Men-
schen die Entscheidung aus der Hand
nähme. Auch für die <...gebildete> Atom-
wissenschaft und die durch sie ermög-
lichten Anwendungen gelten unverkürzt
alle die Einschränkungen durch die die Welt
der Mittel eingegrenzt wird. Aber mehr als
dies: weil es gerade die Perfektion in der
<...> ist, durch die der Entscheidung
ein niemals dafewesenes Mass von
Verantwortung aufgebürdet wird, darum
muss das Zeitalter der Atomwissenschaft
lieber das Zeitalter des durch die Atom-
wissenschaft an sich selbst zurückverwiesenen
Menschen heissen.
V 0009 b
undatiert
1
Atomzeitalter
„Atomzeitalter“. Wissenschaft führende
Macht? Scheinbar ja.
Rückblick vom Kulminationspunkt. Mög-
lichkeit totaler Selbstvernichtung.
„Grenzsituation“. Nichtwissen der Fort-
schreitenden. O. Hahn.
Eigenart der Entwicklung. „industri-
elle Revolution“? Ausgang von Wissen-
schaft. Mathematik in Natur. „Vergei-
stigung“. Verbindung mit technischer
Konstruktion. Geräuschloses Fortschrei-
ten am Leitfaden der „Sache“. Nicht Ei-
genwille – „Vernunft“.
O auch später. Von Watt bis zum
Atom-Motor. „Revolutionär“ nur die ge-
sellschaftl. Wirkungen.
Selbst in Gesellschaft Sachbedingt-
heit. Die „industrielle Gesellschaft“.
Nicht so gewollt. Beispiel: „Automati-
on“.
---------------------------------------------
Wegen verwirrender Wirkungen: Ankla-
gen. Hamann bis Heidegger – Goethe bis
George. Abweisen wegen zweiseitigen
Ursprungs.
Speziellere Fassung: gegen die
Naturforscher. Haltmachen oder wenig-
stens verschweigen! Sonst Frevel.
Antwort: positive Möglichkeit. Ambi-
valenz tritt hervor.
Prinzipieller: wo liegt der kriti-
sche Punkt? Ambivalenz jedes Werkzeugs.
Wissenschaft ist nicht Gouvernante.
-----------------------------------------------
Enttäuschend? Vermißte Sicherheit?
Paradigmatik des heutigen Grenzfalls.
Kehrseite eines Begrüßenswerten!
2
Sachbedingtheit scheinbar Verlust der
Freiheit. Gefühl des Getriebenswerdens.
Verengung? Vgl. „Mechanisierung“ usw.
Heutige Situation Beweis des Gegen-
teils. Determiniert die Sache?
Alternative als Ausdruck der
Wahlnotwendigkeit. Ambivalenz als Bedin-
gung der Freiheit. Sachperfektion ist
MIttelperfektion. Zwecksetzung als frei
e Tat in Grenzsituation. Zu begrüßen!
Gewagtheit des Menschseins in letzter
Klarheit. Unsere Auszeichnung.
----------------------------------------------
Wissenschaft soll nicht behüten!
Anmaßung. Fehlentscheidung ist Schuld
des Willens.
Ausdruck „Atomzeitalter“ abzuleh-
nen. Umgekehrt: der Mensch an sich
selbst zurückzuweisen! |